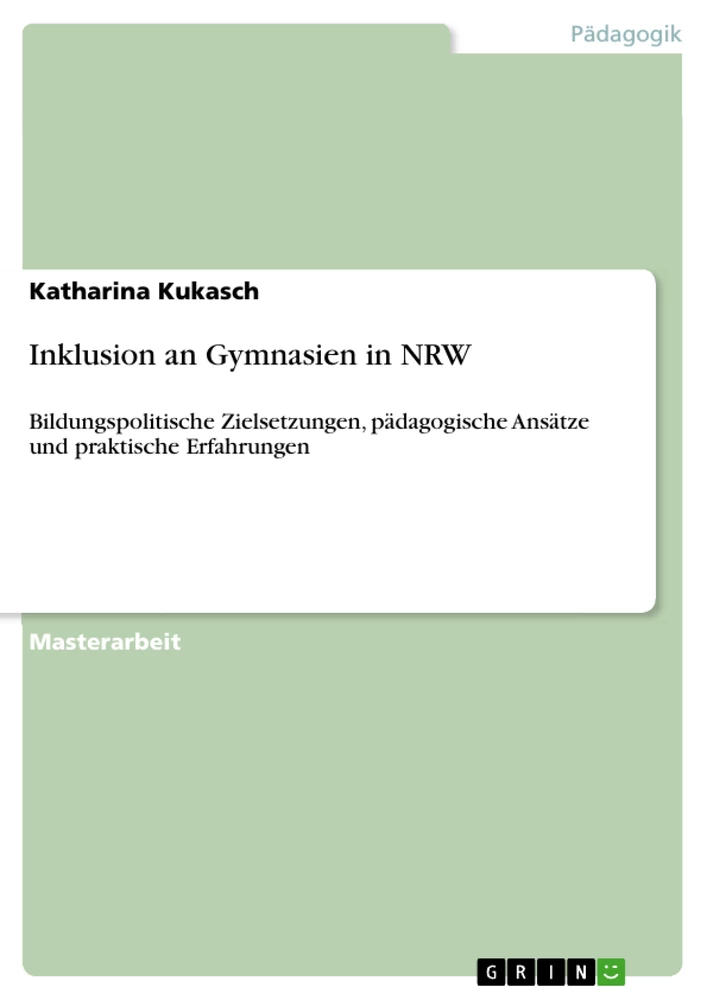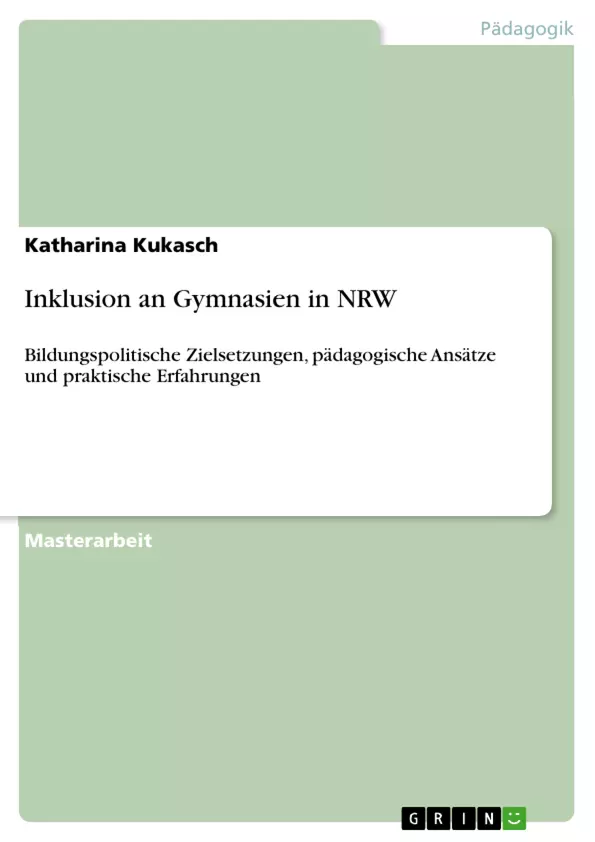Dass Gesellschaften geprägt sind von Heterogenität, ist eine Tatsache, die seit Menschenbeginn an existent ist. Neben vielen Merkmalen, wie z.B. das Geschlecht, das Alter oder der kulturelle Hintergrund, ist auch jenes eines bestimmten Handicaps ein Charakteristikum, das die Heterogenität einer Gesellschaft mitbestimmt. Es gibt Menschen, die sich durch eine körperliche oder auch geistige Beeinträchtigung von anderen unterscheiden, was durch ein bislang recht separierendes Schulsystem auch schon seit knapp drei Jahrhunderten in der Bildungspolitik Deutschlands Berücksichtigung findet. Eine neue Perspektive in Richtung eines Aufbrechens dieser Separation hin zu einem adäquaten und zufriedenstellenden Umgang mit Heterogenität, erreichte die Diskussion auf bildungspolitischer Ebene jedoch erst in den letzten Jahren. Die Meinung, Menschen mit einer geistigen oder physischen Beeinträchtigung, definiert als Menschen bzw. Kinder oder Schülerinnen und Schüler (im Folgenden abgekürzt mit SuS) mit sonderpädagogischem Förderbedarf, würden jene ohne diesen sonderpädagogischen Förderbedarf behindern, ist dahingehend umgeschwungen, dass die Heterogenität einer Gesellschaft vermehrt als Chance der gegenseitigen Bereicherung wahrgenommen worden ist. Genau um diese veränderte Sichtweise, die entgegen traditionellen Vorstellungen eines separierenden Schulsystems von SuS ohne sonderpädagogischen Förderbedarf auf der einen und SuS mit jenem sonderpädagogischem Förderbedarf auf der anderen Seite, ein inklusives Schulsystem anstrebt, geht es in der vorliegenden Arbeit. Unter Berücksichtigung des mehrgliedrigen Schulsystems in Deutschland, innerhalb dessen es sicherlich je nach Schulform noch einmal Unterschiede in der inklusiven Ausgestaltung gibt, konzentrieren sich die folgenden Ausführungen auf die Schulform Gymnasium, exemplifiziert am Land Nordrhein-Westfalen (im Folgenden abgekürzt mit NRW).
Es geht darum, zu schauen, inwieweit sich die Gymnasien in NRW auf den Weg zu einem inklusiven Schulsystem begeben haben.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretischer Hintergrund
- 2.1 Definition und Ansprüche von Inklusion
- 2.2 Historische Entwicklungen des deutschen Schulwesens - von der Exklusion zur Inklusion
- 3. Gesetzesvorgaben zur Inklusion
- 3.1 Die Bedeutung der UN-Konvention auf Bundesebene
- 3.2 Die Bedeutung der UN-Konvention auf Landesebene - ein exemplarischer Blick auf das Land NRW
- 4. Die Behindertenpolitik in NRW - statistische Grunddaten: Von der Makro- zur Mikroebene
- 5. Das politische Vorgehen des Landes NRW zur Umsetzung des neuen Inklusionsgesetzes: Was wurde politisch bzw. strukturell bereits getan und was muss noch getan werden?
- 5.1 Finanzieller und personeller Unterstützungsrahmen
- 5.2 Lehrerfortbildung
- 5.3 Lehrerausbildung
- 5.4 Neuorganisation der schulischen Abschlüsse und des Benotungssystems
- 5.5 Vernetzung, Koordination und Kooperation
- 5.6 Auslaufen der Förderschulen
- 5.7 Bauliche Veränderungen
- 5.8 Sonstige Maßnahmen
- 6. Pädagogische Ansätze zur Umsetzung von Inklusion an Gymnasien - Gelingensbedingungen
- 6.1 Multiprofessionelle Teams im Unterricht
- 6.2 Responsive Lehrer-Schüler-Beziehungen
- 6.3 Respektvolle Peer-Beziehungen
- 6.4 Differenzierende Didaktik
- 6.5 Binnendifferenzierung durch unterschiedliche didaktische Materialien
- 6.6 Pädagogische Diagnostik im Unterricht
- 6.7 Mehrperspektivischer Leistungsbegriff im Unterricht
- 7. Der Index für Inklusion als Unterstützungshilfe auf dem Weg zu einem inklusiven Bildungssystem
- 8. Praktische Herausforderungen und Erfahrungen für die bzw. mit der Umsetzung von Inklusion an Gymnasien am Beispiel der Stadt Gelsenkirchen
- 8.1 Praktische Herausforderungen und Erfahrungen aus der Perspektive der Stadt Gelsenkirchen als Schulträger
- 8.2 Praktische Herausforderungen und Erfahrungen aus Sicht des Schalker Gymnasiums in Gelsenkirchen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Umsetzung von Inklusion an Gymnasien in Nordrhein-Westfalen. Ziel ist es, den aktuellen Stand der Inklusion an Gymnasien in NRW zu beleuchten, die gesetzlichen Grundlagen zu analysieren und pädagogische Ansätze sowie praktische Herausforderungen zu erörtern.
- Theoretische Grundlagen und Definition von Inklusion
- Gesetzliche Rahmenbedingungen und politische Maßnahmen in NRW
- Pädagogische Ansätze für inklusive Beschulung an Gymnasien
- Statistische Daten zur Inklusion in NRW
- Praktische Erfahrungen und Herausforderungen an Gymnasien in Gelsenkirchen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Inklusion im deutschen Schulsystem ein und beschreibt den Wandel von einem separierenden zu einem inklusiven Schulsystem. Sie skizziert den Fokus der Arbeit auf Gymnasien in NRW und benennt die Struktur der folgenden Kapitel.
2. Theoretischer Hintergrund: Dieses Kapitel legt die begrifflichen Grundlagen für die Arbeit fest, indem es den Begriff Inklusion definiert und die damit verbundenen Ansprüche skizziert. Weiterhin wird ein historischer Überblick über die Entwicklung des deutschen Schulwesens im Hinblick auf Inklusion gegeben, um den aktuellen Stand und mögliche Fortschritte im Kontext der Inklusionsdebatte besser einzuordnen.
3. Gesetzesvorgaben zur Inklusion: Kapitel 3 befasst sich mit der rechtlichen Grundlage der Inklusion in Deutschland, insbesondere mit der Bedeutung der UN-Konvention sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene (NRW). Es analysiert die konkreten Auswirkungen der Konvention auf die Gestaltung des inklusiven Schulsystems in NRW.
4. Die Behindertenpolitik in NRW - statistische Grunddaten: Von der Makro- zur Mikroebene: Dieses Kapitel präsentiert statistische Daten zur Behindertenpolitik in NRW und analysiert den Inklusionsanteil im Ländervergleich. Der Fokus liegt auf der Verteilung von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf auf die verschiedenen Schulformen, insbesondere auf Gymnasien.
5. Das politische Vorgehen des Landes NRW zur Umsetzung des neuen Inklusionsgesetzes: Was wurde politisch bzw. strukturell bereits getan und was muss noch getan werden?: Kapitel 5 untersucht die politischen und strukturellen Maßnahmen des Landes NRW zur Umsetzung des Inklusionsgesetzes. Es analysiert bereits umgesetzte Maßnahmen und benennt weitere notwendige Schritte im Hinblick auf die Inklusion an Gymnasien. Dies umfasst Aspekte wie finanzielle und personelle Ressourcen, Lehrerfortbildung und -ausbildung, Neuorganisation von Abschlüssen und Benotung sowie Vernetzung und Kooperation.
6. Pädagogische Ansätze zur Umsetzung von Inklusion an Gymnasien - Gelingensbedingungen: Kapitel 6 konzentriert sich auf pädagogische Ansätze und Gelingensbedingungen für die inklusive Beschulung an Gymnasien. Es beleuchtet verschiedene pädagogische Maßnahmen, wie multiprofessionelle Teams, responsive Lehrer-Schüler-Beziehungen, respektvolle Peer-Beziehungen, differenzierende Didaktik, Binnendifferenzierung und pädagogische Diagnostik. Der Fokus liegt auf der Schaffung von Lernumgebungen, die den individuellen Bedürfnissen aller Schüler gerecht werden.
Schlüsselwörter
Inklusion, Gymnasium, Nordrhein-Westfalen (NRW), Sonderpädagogischer Förderbedarf, UN-Konvention, Schulgesetzgebung, pädagogische Ansätze, Differenzierung, multiprofessionelle Teams, Lehrerfortbildung, inklusives Schulsystem, Gelingensbedingungen, Herausforderungen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Inklusion an Gymnasien in Nordrhein-Westfalen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Umsetzung von Inklusion an Gymnasien in Nordrhein-Westfalen (NRW). Sie beleuchtet den aktuellen Stand der Inklusion, analysiert die gesetzlichen Grundlagen und erörtert pädagogische Ansätze sowie praktische Herausforderungen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Theoretische Grundlagen und Definition von Inklusion, gesetzliche Rahmenbedingungen und politische Maßnahmen in NRW, pädagogische Ansätze für inklusive Beschulung an Gymnasien, statistische Daten zur Inklusion in NRW und praktische Erfahrungen und Herausforderungen an Gymnasien in Gelsenkirchen. Die Arbeit betrachtet dabei verschiedene Aspekte wie die UN-Konvention, die Rolle des Landes NRW, finanzielle und personelle Ressourcen, Lehrerfortbildung, differenzierende Didaktik, multiprofessionelle Teams und die Herausforderungen für Schulträger und Schulen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in acht Kapitel: Einleitung, Theoretischer Hintergrund (Definition und Ansprüche von Inklusion, historische Entwicklung), Gesetzesvorgaben zur Inklusion (Bundes- und Landesebene), Behindertenpolitik in NRW mit statistischen Daten, Politisches Vorgehen des Landes NRW zur Umsetzung des Inklusionsgesetzes, Pädagogische Ansätze zur Umsetzung von Inklusion an Gymnasien, Der Index für Inklusion, und Praktische Herausforderungen und Erfahrungen in Gelsenkirchen (aus Sicht des Schulträgers und eines Gymnasiums).
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, den aktuellen Stand der Inklusion an Gymnasien in NRW zu beleuchten, die gesetzlichen Grundlagen zu analysieren und pädagogische Ansätze sowie praktische Herausforderungen zu erörtern. Sie soll einen umfassenden Überblick über den Inklusionsprozess im Kontext der Gymnasien in NRW liefern.
Welche konkreten Herausforderungen werden in der Arbeit betrachtet?
Die Arbeit betrachtet praktische Herausforderungen aus der Perspektive des Schulträgers und einer Schule in Gelsenkirchen. Weitere Herausforderungen beziehen sich auf finanzielle und personelle Ressourcen, Lehrerfortbildung und -ausbildung, die Neuorganisation von Abschlüssen und Benotung, Vernetzung und Kooperation sowie bauliche Veränderungen.
Welche pädagogischen Ansätze werden diskutiert?
Die Arbeit diskutiert pädagogische Ansätze wie multiprofessionelle Teams im Unterricht, responsive Lehrer-Schüler-Beziehungen, respektvolle Peer-Beziehungen, differenzierende Didaktik, Binnendifferenzierung durch unterschiedliche didaktische Materialien, pädagogische Diagnostik im Unterricht und einen mehrperspektivischen Leistungsbegriff im Unterricht.
Welche Rolle spielt die UN-Konvention?
Die UN-Konvention spielt eine zentrale Rolle, da sie die rechtliche Grundlage für Inklusion bildet. Die Arbeit analysiert ihre Bedeutung sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene (NRW) und deren Auswirkungen auf das inklusive Schulsystem.
Welche statistischen Daten werden verwendet?
Die Arbeit präsentiert statistische Daten zur Behindertenpolitik in NRW, fokussiert auf die Verteilung von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf auf verschiedene Schulformen, insbesondere Gymnasien, um den Inklusionsanteil im Ländervergleich zu analysieren.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Inklusion, Gymnasium, Nordrhein-Westfalen (NRW), Sonderpädagogischer Förderbedarf, UN-Konvention, Schulgesetzgebung, pädagogische Ansätze, Differenzierung, multiprofessionelle Teams, Lehrerfortbildung, inklusives Schulsystem, Gelingensbedingungen, Herausforderungen.
- Citar trabajo
- B.A. Katharina Kukasch (Autor), 2014, Inklusion an Gymnasien in NRW, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/301063