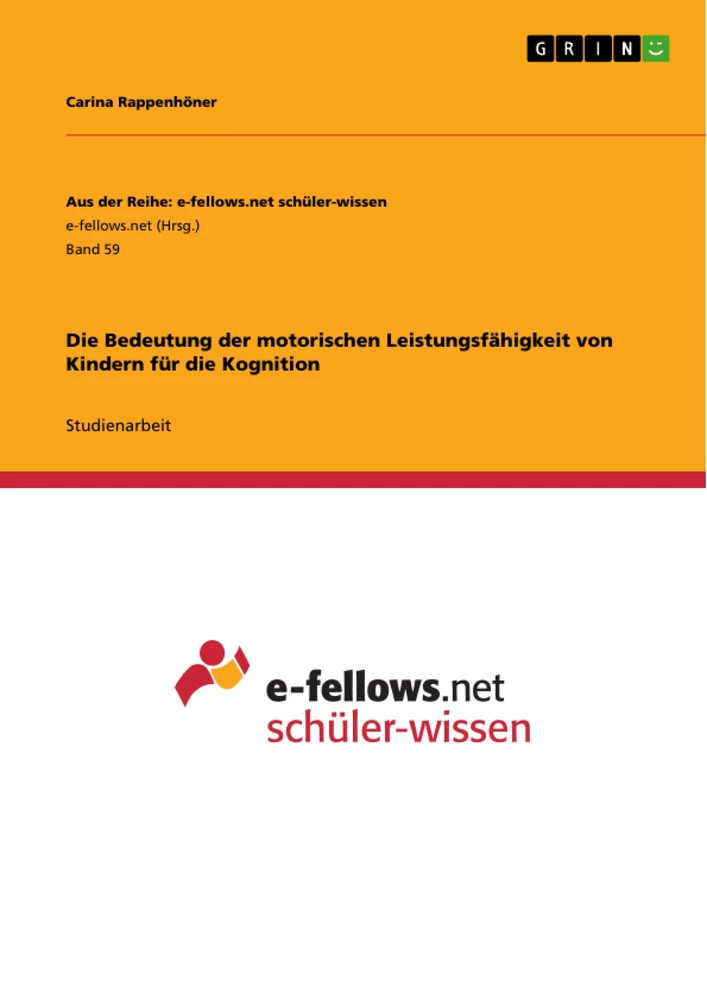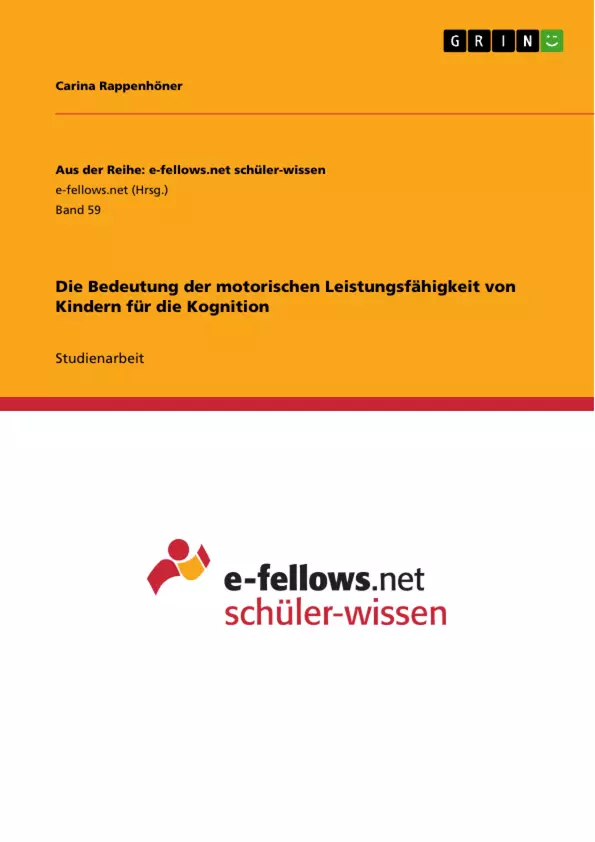Der Frage nach einem Zusammenhang von motorischer Leistungsfähigkeit und kognitiven Variablen wird schon lange nachgegangen. Vor allem im Kindes- und Jugendalter würde das Vorhandensein eines Zusammenhangs strukturelle Veränderungen in Kindergarten und Schule nach sich ziehen müssen.
In dieser Hausarbeit wird anhand der CoMiK-Studie von Julia Everke (2009) ein Bewegungsförderungsprogramm für Kindergartenkinder vorgestellt und dessen überwiegend positive Effekte auf bestimmte motorische Fertigkeiten und Transfereffekte auf kognitive Leistungen erläutert.
Das Motorik-Modul des Kinder- und Jugendgesundheitssurvey des Robert Koch - Institutes soll zudem die Bedeutung der Risikofaktoren Übergewicht beziehungsweise Adipositas und mangelndem Gesundheitszustand für die motorische Leistungsfähigkeit bei Vier- bis Zehnjährigen aufzeigen.
Somit wird die Relevanz von körperlicher Aktivität deutlich und Möglichkeiten zur Förderung von Bewegung in Bildungseinrichtungen können vorgestellt werden.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Zusammenfassung..
- 1 Erläuterung der Fragestellung..
- 1.1 Biologische Erklärungen zum Zusammenhang von Motorik und Kognition..........
- 1.2 Begriffsdefinitionen: Übergewicht und Adipositas........
- 2 CoMiK-Studie: Ein Bewegungsförderungsprogramms für
Kindergartenkinder…..\n
- 2.1 zugrundeliegende Fragestellung..
- 2.2 Konzeption........
- 2.3 Ergebnisse.
- 3 Motorik-Modul: Motorische Leistungsfähigkeit und Gesundheit von Kindern..
- 3.1 zugrundeliegende Fragestellung..
- 3.2 Konzeption.
- 3.3 Ergebnisse.......
- 4 Schlussfolgerungen.....
- 4.1 Ziele und Präventionsmaßnahmen..
- 4.2 Möglichkeiten zur Bewegungsförderung in Bildungseinrichtungen..
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit dem Zusammenhang von motorischer Leistungsfähigkeit und kognitiven Fähigkeiten bei Kindern, insbesondere im Kindergartenalter. Die Arbeit analysiert zwei empirische Studien: die CoMiK-Studie und das Motorik-Modul des Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS). Die Hauptaufgabe der Arbeit ist es, die Bedeutung von Bewegung für die kognitive Entwicklung von Kindern aufzuzeigen und anhand der Studien die Effekte von Bewegungsförderungsprogrammen auf motorische und kognitive Fähigkeiten zu beleuchten.
- Der Einfluss von Bewegung auf die kognitive Entwicklung von Kindern
- Die Rolle der CoMiK-Studie und des Motorik-Moduls (MoMo) des KiGGS
- Die Bedeutung von Übergewicht und Adipositas für die motorische Leistungsfähigkeit
- Die Entwicklung und Umsetzung von Präventionsmaßnahmen in Bildungseinrichtungen
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Das erste Kapitel beleuchtet den Zusammenhang zwischen Motorik und Kognition, wobei biologische Erklärungen und Begriffsdefinitionen zu Übergewicht und Adipositas erläutert werden. Im zweiten Kapitel wird die CoMiK-Studie vorgestellt, ein Bewegungsförderungsprogramm für Kindergartenkinder, welches die motorischen und kognitiven Fähigkeiten der teilnehmenden Kinder positiv beeinflusste. Das dritte Kapitel behandelt das Motorik-Modul (MoMo) des KiGGS, das sich mit der motorischen Leistungsfähigkeit von Vier- bis Zehnjährigen auseinandersetzt und die Bedeutung von Übergewicht und Adipositas in diesem Kontext beleuchtet. Das vierte Kapitel zieht Schlussfolgerungen aus den beiden Studien und stellt Präventionsmaßnahmen sowie Möglichkeiten zur Bewegungsförderung in Bildungseinrichtungen vor.
Schlüsselwörter (Keywords)
Motorik, Kognition, Kinder, Bewegungsförderung, Übergewicht, Adipositas, CoMiK-Studie, Motorik-Modul (MoMo), KiGGS, Präventionsmaßnahmen, Bildungseinrichtungen.
Häufig gestellte Fragen
Gibt es einen Zusammenhang zwischen Motorik und Kognition?
Ja, Studien wie die CoMiK-Studie zeigen, dass eine gute motorische Leistungsfähigkeit positive Transfereffekte auf kognitive Leistungen bei Kindern haben kann.
Wie beeinflusst Übergewicht die motorische Leistungsfähigkeit?
Daten des Robert Koch-Instituts verdeutlichen, dass Übergewicht und Adipositas erhebliche Risikofaktoren sind, die die motorische Entwicklung von Kindern einschränken.
Was wurde in der CoMiK-Studie untersucht?
Die Studie untersuchte ein Bewegungsförderungsprogramm für Kindergartenkinder und dessen Auswirkungen auf motorische Fertigkeiten und geistige Leistungen.
Was ist das Motorik-Modul (MoMo) des KiGGS?
Es ist ein Teil des Kinder- und Jugendgesundheitssurveys, der die motorische Leistungsfähigkeit und den Gesundheitszustand von Kindern im Alter von vier bis zehn Jahren analysiert.
Wie kann Bewegung in Bildungseinrichtungen gefördert werden?
Durch gezielte Präventionsmaßnahmen und die Integration von Bewegungsprogrammen in den Alltag von Kindergärten und Schulen kann die kognitive Entwicklung unterstützt werden.
- Citation du texte
- Carina Rappenhöner (Auteur), 2015, Die Bedeutung der motorischen Leistungsfähigkeit von Kindern für die Kognition, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/301140