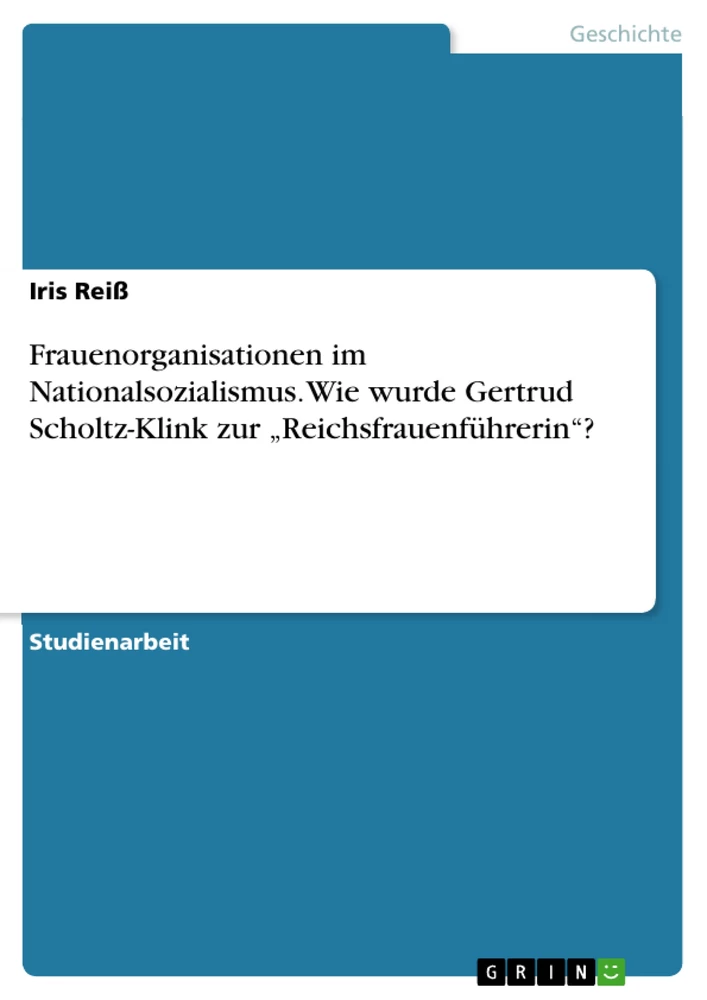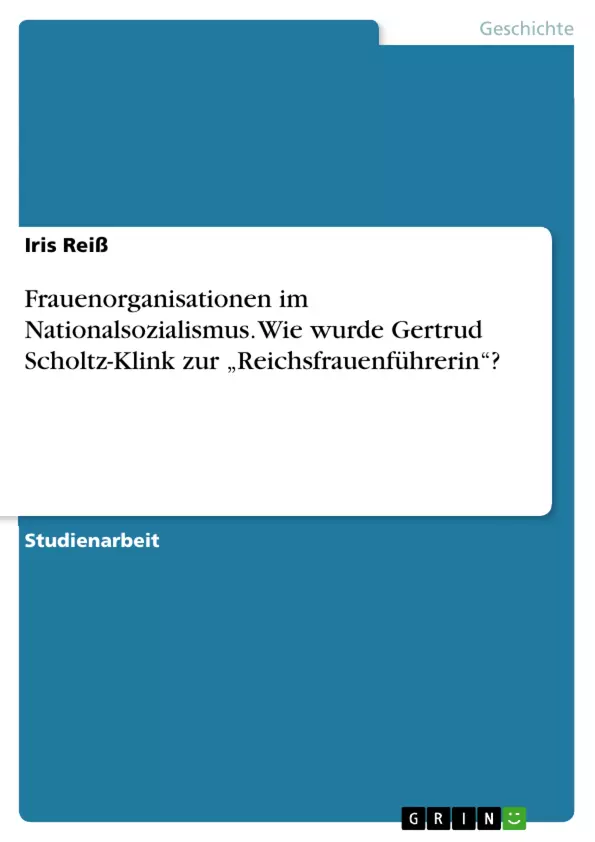Das NS-Bild der Frau war keineswegs ein unbekanntes, originelles; es war ein konservatives Bild, das aus dem bürgerlichen Milieu stammte. Die Nationalsozialisten fügten dem noch eine mythische Komponente hinzu, wenn sie die Frau als rein naturbestimmtes Wesen darstellten. Aufgrund der im Nationalsozialismus herrschenden Meinung der biologischen „Andersartigkeit“ von Frauen und Männern bestand das Prinzip der geschlechtsspezifischen Lebensbereiche. Demnach hatten Frauen und Männer unterschiedliche, von einander getrennte Verpflichtungen gegenüber der Gesellschaft und dem Staat. Für die Frau galten Haushalt, Ehemann und Kinder als ihr Lebensbereich. Der Dienst am Staat bestand in der Verstärkung des Heeres und die Erhaltung der „arischen Rasse“ durch die Geburt möglichst vieler Kinder. [...] Das nationalsozialistische Frauenbild verlangte also förmlich den völligen Ausschluss der Frauen aus der Parteienorganisation. Dieses Ignorieren der Frauen führte aber dazu, dass sich Frauen mehr oder weniger frei organisierten und vielfältige Zusammenschlüsse mit den unterschiedlichsten Zielen entstehen konnten, die um die Gunst der Parteiführung konkurrierten, aber erst wahrgenommen wurden, als die Lage ob der vielen Konkurrenten schon recht chaotisch war. Eine der wichtigsten, ersten Organisationen war der 1924 von Elsbeth Zander gegründete „Völkische Frauenorden“. [...] Im November 1934 wurde Gertrud Scholtz-Klink von Hitler persönlich und offiziell zur „Reichsfrauenführerin“ ernannt und war somit ranghöchste Frau im Dritten Reich. Der Titel „Reichsfrauenführerin“ war eigens für Scholtz-Klink erfunden worden, da man sie nicht in die bestehenden Strukturen der NSDAP, die auf Männer als Führungskräfte ausgelegt war, eingliedern wollte. Sie sollte kein Amt mit führender, politischer Rolle bekleiden. Außerdem galt dieser Titel auch als Zustimmung der Partei zu Scholtz-Klinks Hegemonie und als Mitteilung an die Öffentlichkeit, dass die Suche nach einer geeigneten „Führerin“ abgeschlossen sei.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Das nationalsozialistische Frauenbild
- 2. Geschichte der Frauenorganisationen
- 2.1. Die Kampfjahre
- 2.2. Die NS-Herrschaft 1933 - 1945
- 3. Reichsfrauenführerin Gertrud Scholtz-Klink
- 3.1. Der politische Aufstieg
- 3.2. Die Kriegszeit
- 3.2.1. Stellung innerhalb der NSDAP
- 3.3 Bilanz
- 4. Formaler Aufbau der Organisation
- 4.1. Verhältnis NSF - DFW
- 4.2. Struktur, Vermittlung, Zahlen
- 4.2.1. Gliederung
- 4.2.2 Veranstaltungen, Vermittlung
- 4.2.3. Rechtliche Stellung, Mitgliederzahlen, Finanzen
- 5. Österreich
- Schlußbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit der Rolle von Frauenorganisationen im Nationalsozialismus, mit besonderem Fokus auf die Reichsfrauenführerin Gertrud Scholtz-Klink. Die Arbeit analysiert das nationalsozialistische Frauenbild und die Geschichte der Frauenorganisationen, untersucht den politischen Aufstieg und die Rolle von Scholtz-Klink während der NS-Herrschaft, beleuchtet den formalen Aufbau der Organisation und deren Einfluss in Österreich.
- Das nationalsozialistische Frauenbild und dessen ideologische Grundlage
- Die Geschichte der Frauenorganisationen im Nationalsozialismus
- Die Rolle der Reichsfrauenführerin Gertrud Scholtz-Klink
- Der Einfluss der Frauenorganisationen auf die Gesellschaft
- Die Organisation und Struktur der Frauenorganisationen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt zentrale Begriffe und Grundprinzipien des Nationalsozialismus vor, die den roten Faden durch die Arbeit bilden. Das erste Kapitel widmet sich dem nationalsozialistischen Frauenbild, das als konservativ und naturbestimmt beschrieben wird. Die Frau wird in den Haushalt, die Ehe und die Kindererziehung eingebunden und ihre Rolle als Hüterin der „arischen Rasse“ betont.
Das zweite Kapitel beleuchtet die Geschichte der Frauenorganisationen im Nationalsozialismus, beginnend mit den Kampfjahre und der NS-Herrschaft von 1933 bis 1945. Es werden die verschiedenen Organisationen und ihre Entwicklung innerhalb des NS-Regimes dargestellt.
Das dritte Kapitel konzentriert sich auf die Reichsfrauenführerin Gertrud Scholtz-Klink. Es wird ihr politischer Aufstieg, ihre Rolle während der Kriegszeit und ihre Stellung innerhalb der NSDAP analysiert.
Das vierte Kapitel befasst sich mit dem formalen Aufbau der Frauenorganisationen, inklusive des Verhältnisses zwischen NSF und DFW, der Gliederung, den Veranstaltungen und der rechtlichen Stellung der Organisation.
Das fünfte Kapitel beleuchtet die Situation der Frauenorganisationen in Österreich.
Schlüsselwörter
Nationalsozialismus, Frauenorganisationen, Gertrud Scholtz-Klink, Reichsfrauenführerin, Frauenbild, NS-Ideologie, „Volksgemeinschaft“, „Führerprinzip“, Rasse, Kindererziehung, Haushalt, Familie, Organisation, Struktur, Österreich.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Gertrud Scholtz-Klink?
Gertrud Scholtz-Klink war die ranghöchste Frau im Dritten Reich. Sie wurde 1934 von Hitler zur „Reichsfrauenführerin“ ernannt und leitete die NS-Frauenschaft (NSF) sowie das Deutsche Frauenwerk (DFW).
Wie sah das nationalsozialistische Frauenbild aus?
Es war ein konservatives Bild, das die Frau primär in den Bereichen Haushalt, Ehe und Kindererziehung sah. Die biologische „Andersartigkeit“ begründete den Ausschluss aus der aktiven Politik.
Warum wurde der Titel „Reichsfrauenführerin“ neu geschaffen?
Der Titel wurde erfunden, um Scholtz-Klink eine formale Führungsposition zu geben, ohne sie in die männerdominierte Machtstruktur der NSDAP-Kernorganisation integrieren zu müssen.
Was war die Aufgabe der NS-Frauenschaft (NSF)?
Die NSF diente der ideologischen Schulung und Organisation der Frauen im Sinne der „Volksgemeinschaft“. Sie sollte Frauen für ihre Aufgaben als Mütter und Hausfrauen im NS-Staat mobilisieren.
Welche Rolle spielten Frauen für die „arische Rasse“?
Frauen wurden als Hüterinnen des „Erbstroms“ betrachtet. Ihr Dienst am Staat bestand darin, durch die Geburt möglichst vieler Kinder die Erhaltung der „arischen Rasse“ zu sichern.
Hatten Frauen im Nationalsozialismus politische Macht?
Formell hatten sie kaum politische Macht. Scholtz-Klink hatte zwar einen hohen Titel, besetzte aber kein Amt mit echter politischer Entscheidungsbefugnis innerhalb der NSDAP-Hierarchie.
- Citation du texte
- Iris Reiß (Auteur), 2014, Frauenorganisationen im Nationalsozialismus. Wie wurde Gertrud Scholtz-Klink zur „Reichsfrauenführerin“?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/301844