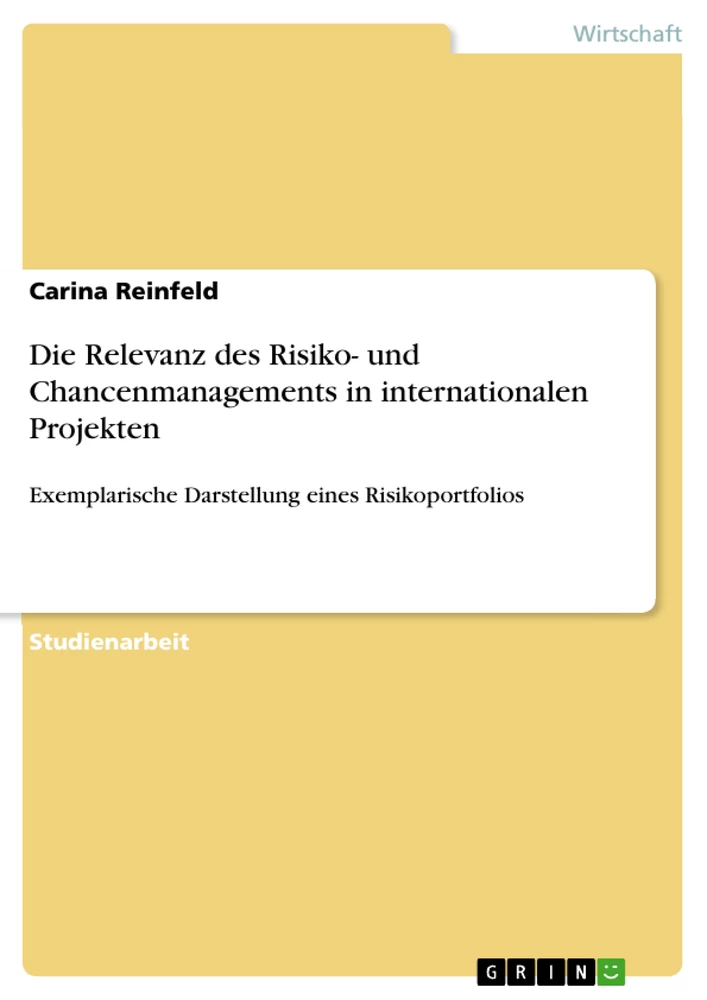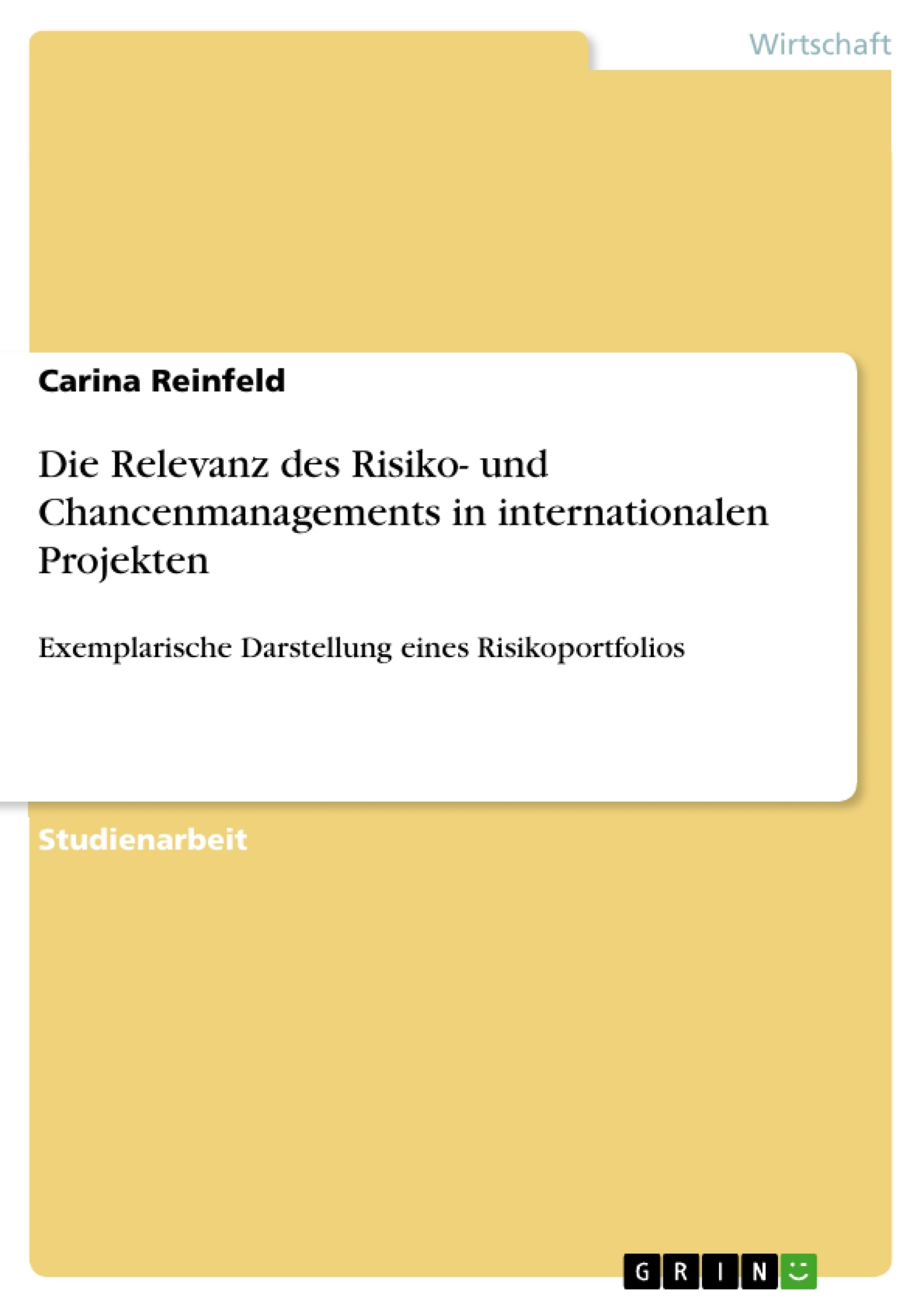Die heutigen Märkte sind geprägt durch den Wandel vom Anbieter- zum Käufermarkt, Turbulenz und zunehmender Intransparenz im globalen Wettbewerb.
Um wettbewerbsfähig zu sein, zu bleiben und einen Wettbewerbsvorteil aufbauen zu können, gehen Unternehmen häufiger internationale Kooperationen ein, bauen langfristige Geschäftsbeziehungen zu ausländischen Unternehmen auf oder nutzen vielversprechende Fusionen mit Unternehmen im Ausland. Wie eine Studie des Instituts für Mittelstandsforschung Bonn beweist, unterhielten in der Auswertungsperiode von 2009 bis 2011 37% der deutschen Unternehmen direkte Auslandskontakte und erwirtschafteten bis zu 40% des Gesamtumsatzes im Ausland. Diese internationale Entwicklung von Unternehmen wird in den meisten Fällen durch komplexe Projekte gesteuert.
Neben den gewinnversprechenden Chancen, die durch die internationale Tätigkeit von Unternehmen begründet sind, bergen jegliche internationale Projekte zum Teil existenzgefährdende unternehmensinterne und externe makro- oder mikroökonomische Risiken. Der Projekterfolg ist demnach beeinflusst von Unsicherheit in Entscheidungssituationen durch bekannte und ggf. auch unbekannte Variablen, die sich auf den Projektverlauf auswirken. Ein präzises Risiko- und Chancenmanagement (RCM) ist in Projekten unabdingbar, um die relevanten Risiken eindeutig zu identifizieren und im Anschluss analysieren, bewerten, zielorientiert steuern und kontrollieren zu können.
Folgende These lässt sich aufgrund dieser Kenntnisse aufstellen: RCM als begleitender Prozess des Projektmanagements unterstützt einen erfolgreichen Projektverlauf, ist aber unter Berücksichtigung des Faktors der Subjektivität nicht der alleinige Erfolgsfaktor.
In der folgenden Ausarbeitung werden vorab die für das Verständnis der Ausführungen relevanten Begriffe definiert. Des Weiteren wird die Positionierung des RCM im Rahmen des Prozesses des Projektmanagements dargestellt. Mittels eines konstruierten Fallbeispiels werden die Ausführungen in die Praxis übertragen und anhand der exemplarischen Erstellung eines Risikoportfolios erläutert. Die Arbeit schließt mit einer kritischen Würdigung der Ergebnisse sowie der damit einhergehenden Überprüfung der Eingangsthese ab.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Die Relevanz des Risiko- und Chancenmanagements vor dem Hintergrund der Internationalisierung von Unternehmen
- 2. Begriffsdefinitionen
- 2.1 Risiko
- 2.2 Chance
- 2.3 Internationalisierung
- 3. Risiko- und Chancenmanagement als begleitender Prozess des Projektmanagements
- 3.1 Idealtypischer Verlauf des Projektmanagement-Prozesses
- 3.2 Die Position des Risiko- und Chancenmanagements im Projektmanagement
- 4. Fallbeispiel: Exemplarische Erstellung eines Risikoportfolios
- 4.1 Ausgangssituation und Projektvorstellung
- 4.2 Darstellung und Erläuterung des Risikoportfolios
- 4.3 Handlungsempfehlung anhand des Risikoportfolios
- 5. Kritische Würdigung und Überprüfung der These
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung des Risiko- und Chancenmanagements (RCM) in internationalen Projekten. Ziel ist es, die Rolle des RCM im Projektmanagementprozess zu verdeutlichen und seine Bedeutung für den Projekterfolg aufzuzeigen. Die Arbeit basiert auf einem konstruierten Fallbeispiel, das die praktische Anwendung des RCM illustriert.
- Die Relevanz des RCM im Kontext der Internationalisierung von Unternehmen
- Die Definition von Risiko, Chance und Internationalisierung
- Die Integration des RCM in den Projektmanagementprozess
- Die exemplarische Erstellung und Interpretation eines Risikoportfolios
- Kritische Bewertung des RCM und seiner Auswirkungen auf den Projekterfolg
Zusammenfassung der Kapitel
1. Die Relevanz des Risiko- und Chancenmanagements vor dem Hintergrund der Internationalisierung von Unternehmen: Dieses Kapitel beleuchtet den zunehmenden Trend zur Internationalisierung von Unternehmen und die damit verbundenen Herausforderungen. Es argumentiert, dass die steigende Komplexität internationaler Projekte ein präzises RCM notwendig macht, um potenzielle Risiken und Chancen zu identifizieren und zu managen. Der Wandel vom Anbieter- zum Käufermarkt und die zunehmende Intransparenz des globalen Wettbewerbs werden als wesentliche Gründe für die erhöhte Bedeutung des RCM hervorgehoben. Die Ausführungen werden durch empirische Daten über die Auslandstätigkeiten deutscher Unternehmen untermauert, welche die Notwendigkeit eines effektiven Risikomanagements unterstreichen. Das Kapitel legt den Grundstein für die weitere Untersuchung der Rolle des RCM im Projektmanagement.
2. Begriffsdefinitionen: Dieses Kapitel liefert präzise Definitionen der zentralen Begriffe: Risiko, Chance und Internationalisierung. Diese Definitionen bilden die Grundlage für das Verständnis der nachfolgenden Ausführungen und gewährleisten eine einheitliche Terminologie. Die klare Abgrenzung der Begriffe ist essentiell für eine präzise Analyse und Anwendung des RCM im Kontext internationaler Projekte. Eine eindeutige Definition von „Risiko“ beispielsweise ermöglicht eine fundierte Risikobewertung und -steuerung.
3. Risiko- und Chancenmanagement als begleitender Prozess des Projektmanagements: Dieses Kapitel beschreibt die Integration des RCM in den typischen Projektmanagementprozess. Es verdeutlicht die Position des RCM innerhalb der verschiedenen Projektphasen und betont seine Bedeutung als integraler Bestandteil für den Projekterfolg. Es wird ein idealtypischer Verlauf des Projektmanagementprozesses dargestellt, in den das RCM eingebettet wird. Die genaue Platzierung und die Interaktion des RCM mit anderen Projektmanagement-Aspekten werden analysiert, um seine Wirksamkeit zu unterstreichen.
4. Fallbeispiel: Exemplarische Erstellung eines Risikoportfolios: Dieses Kapitel präsentiert ein detailliertes Fallbeispiel, das die praktische Anwendung des RCM illustriert. Die Erstellung eines Risikoportfolios wird Schritt für Schritt erläutert, angefangen von der Ausgangssituation und Projektvorstellung bis hin zur Ableitung von Handlungsempfehlungen. Das Fallbeispiel dient als praxisorientierte Veranschaulichung der theoretischen Konzepte der vorherigen Kapitel und macht die Relevanz des RCM für reale Projekte deutlich. Die Analyse des Risikoportfolios und die daraus abgeleiteten Empfehlungen bieten einen konkreten Einblick in die Anwendung des RCM in der Praxis.
Schlüsselwörter
Risiko- und Chancenmanagement (RCM), Internationalisierung, Projektmanagement, Risikoportfolio, internationale Projekte, Risikoidentifikation, Risikosteuerung, Wettbewerbsfähigkeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Risiko- und Chancenmanagement in internationalen Projekten
Was ist der Hauptfokus dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Bedeutung des Risiko- und Chancenmanagements (RCM) in internationalen Projekten. Der Fokus liegt auf der Rolle des RCM im Projektmanagementprozess und seiner Bedeutung für den Projekterfolg. Ein konstruiertes Fallbeispiel veranschaulicht die praktische Anwendung.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Relevanz des RCM im Kontext der Internationalisierung, Definitionen von Risiko, Chance und Internationalisierung, die Integration des RCM in den Projektmanagementprozess, die Erstellung und Interpretation eines Risikoportfolios sowie eine kritische Bewertung des RCM und seiner Auswirkungen auf den Projekterfolg.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in fünf Kapitel gegliedert: Kapitel 1 beleuchtet die Relevanz des RCM im Kontext der Internationalisierung. Kapitel 2 liefert Definitionen zentraler Begriffe. Kapitel 3 beschreibt die Integration des RCM in den Projektmanagementprozess. Kapitel 4 präsentiert ein detailliertes Fallbeispiel mit der Erstellung eines Risikoportfolios. Kapitel 5 bietet eine kritische Würdigung.
Was wird im Kapitel über die Relevanz des RCM erläutert?
Dieses Kapitel zeigt den zunehmenden Trend zur Internationalisierung und die damit verbundenen Herausforderungen auf. Es argumentiert für ein präzises RCM aufgrund der steigenden Komplexität internationaler Projekte und untermauert dies mit empirischen Daten über Auslandstätigkeiten deutscher Unternehmen.
Was beinhaltet das Kapitel zu den Begriffsdefinitionen?
Dieses Kapitel liefert präzise Definitionen von Risiko, Chance und Internationalisierung, um eine einheitliche Terminologie und eine fundierte Analyse zu gewährleisten. Eine klare Abgrenzung der Begriffe ist essentiell für die Anwendung des RCM.
Wie wird das RCM in den Projektmanagementprozess integriert (Kapitel 3)?
Kapitel 3 beschreibt die Integration des RCM in den typischen Projektmanagementprozess, verdeutlicht dessen Position in den Projektphasen und betont seine Bedeutung als integraler Bestandteil für den Projekterfolg. Ein idealtypischer Verlauf des Projektmanagementprozesses mit eingebettetem RCM wird dargestellt.
Was wird im Fallbeispiel (Kapitel 4) gezeigt?
Das Fallbeispiel illustriert die praktische Anwendung des RCM durch die schrittweise Erstellung eines Risikoportfolios. Es beginnt mit der Ausgangssituation und Projektvorstellung und führt zur Ableitung von Handlungsempfehlungen. Die Analyse des Risikoportfolios und die daraus abgeleiteten Empfehlungen bieten einen konkreten Einblick in die praktische Anwendung des RCM.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Risiko- und Chancenmanagement (RCM), Internationalisierung, Projektmanagement, Risikoportfolio, internationale Projekte, Risikoidentifikation, Risikosteuerung und Wettbewerbsfähigkeit.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Studierende, Wissenschaftler und Praktiker im Bereich Projektmanagement, insbesondere im Kontext der Internationalisierung von Unternehmen. Sie bietet einen umfassenden Überblick über das RCM und seine Anwendung in der Praxis.
- Citation du texte
- Carina Reinfeld (Auteur), 2015, Die Relevanz des Risiko- und Chancenmanagements in internationalen Projekten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/301859