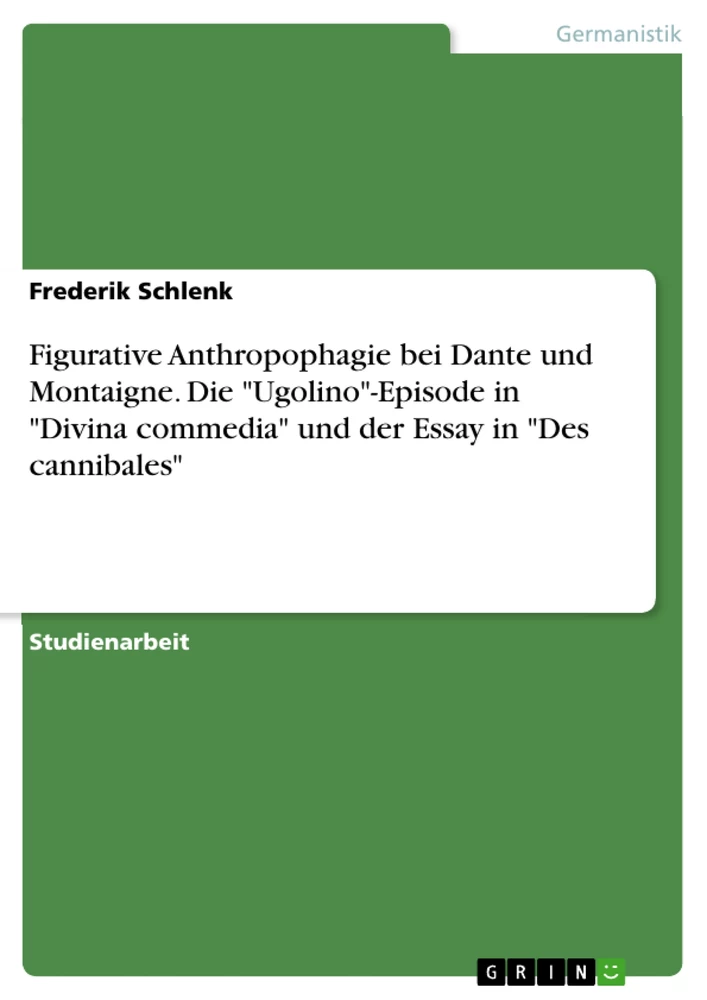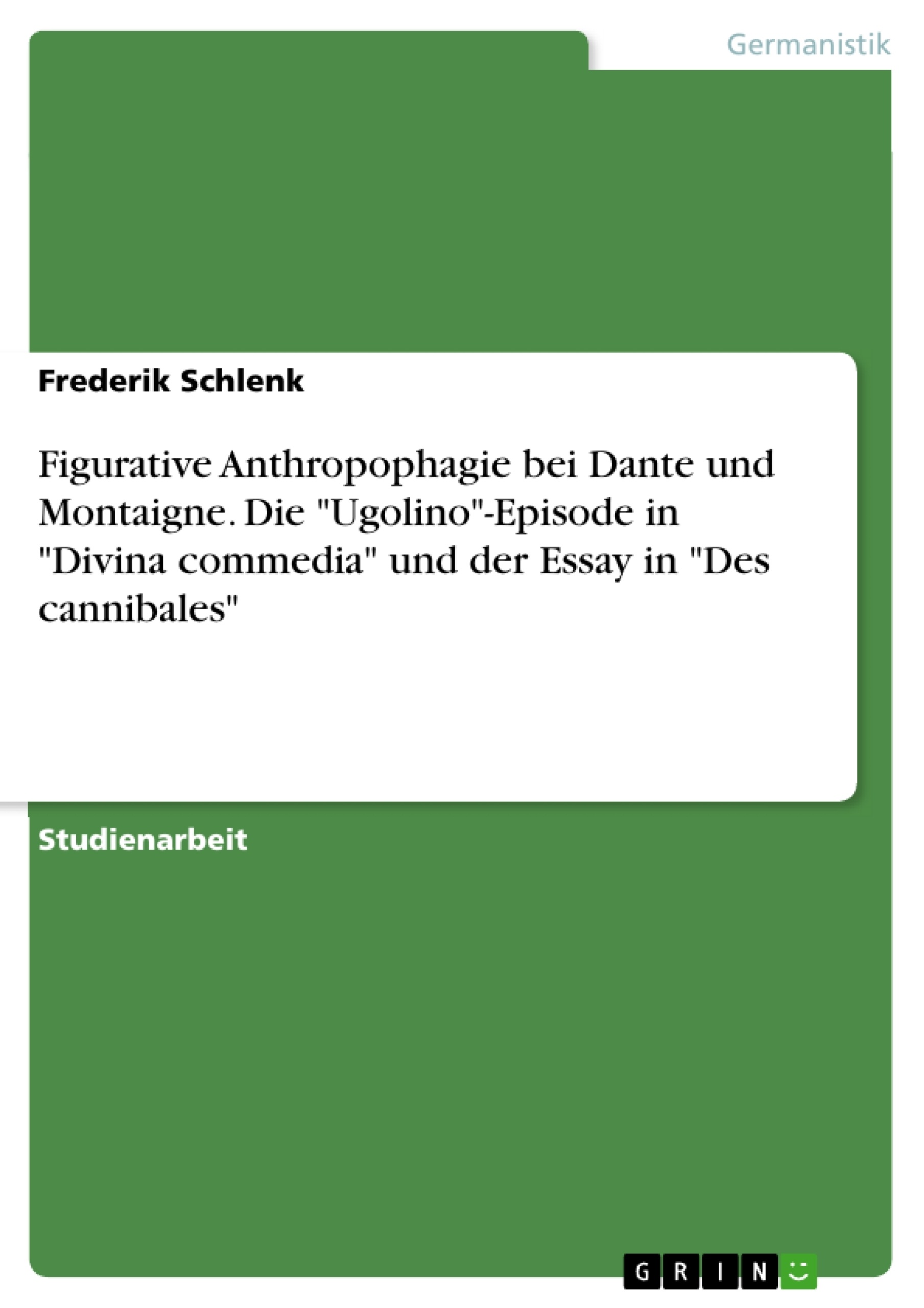Bei Dante scheint es schwer vorstellbar, dass der anthropophage Akt anders als allegorisch gemeint ist. Und ebenso klar scheint es zu sein, dass es nur um die individuelle Sünde bzw. die individuelle Strafe geht, die einem bestimmten Fall des Vergehens (dem Verrat) zugeordnet wird. Das niedrigste Allgemein-Menschliche wird an einem besonders grausamen Fall exemplifiziert.
Bei Montaigne hingegen scheint es sich gerade umgekehrt zu verhalten: Hier wird das Grausame als das Zufällige, Normale und Unspektakuläre dargestellt, das jederzeit durch eine andere Grausamkeit, die Menschen einander zuzufügen imstande sind, ersetzt werden kann. Das Grausame erscheint somit nur als Ausdruck eines Missverstehens, dessen Grund in einer individuellen Unfähigkeit liegt, das Allgemein-Menschliche höher zu schätzen.
Diese verschiedenen Sichtweisen auf ein und dasselbe, literarisch behandelte Motiv (die Anthropophagie) gilt es an den Texten zu entdecken und auf ihre jeweilige sprachliche Ausgestaltung hin zu betrachten. Der erklärte Anspruch dieser Hausarbeit besteht darin, die religiösen, philosophischen und ästhetischen Konnotationen der von Dante und Montaigne verwendeten stilistischen und textimmanenten Deutungsmöglichkeiten des Anthropophagie-Motivs zu benennen und auf dem Hintergrund einer vergleichenden Analyse zu entfalten. Im abschließenden komparatistischen Teil werde ich die wichtigsten Ergebnisse dieser Textanalysen noch einmal hervorheben
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Figurative Anthropophagie bei Dante und Montaigne
- Dantes "Ugolino-Episode": Textumfeld und realgeschichtliche Hintergründe
- Poetologische und philosophische Deutungsansätze der Anthropophagie-Allegorie bei Dante
- Montaignes Essay "Des cannibales": Zeitgeschichtlicher Bezugsrahmen
- Kulturtheoretische, topographische und ethnographische Deutungsansätze
- Komparatistischer Lösungsansatz und Vergleich
- Bibliographie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert die Figurative Anthropophagie in Dantes "Divina Commedia" und Montaignes "Des cannibales". Sie untersucht die jeweiligen literarischen und historischen Kontexte, die poetologischen und philosophischen Deutungsansätze sowie die kulturtheoretischen Aspekte der Thematik. Im Mittelpunkt steht ein komparatistischer Vergleich der beiden Werke.
- Die Darstellung der Anthropophagie in der "Divina Commedia" und "Des cannibales"
- Der Vergleich der literarischen und historischen Kontexte der beiden Werke
- Die Analyse der poetologischen und philosophischen Deutungsansätze der Anthropophagie-Allegorie bei Dante
- Die Untersuchung der kulturtheoretischen, topographischen und ethnographischen Deutungsansätze in Montaignes Essay
- Die Entwicklung eines komparatistischen Lösungsansatzes und die Gegenüberstellung der Ergebnisse der Textanalysen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Figurativen Anthropophagie bei Dante und Montaigne ein und stellt die beiden Autoren sowie ihre jeweiligen Lebensumstände und literarischen Werke vor. Im Anschluss werden die "Ugolino-Episode" aus Dantes "Inferno" und Montaignes Essay "Des cannibales" im Detail analysiert. Dabei werden die jeweiligen literarischen und historischen Kontexte der Werke beleuchtet sowie die poetologischen und philosophischen Deutungsansätze der Anthropophagie-Allegorie bei Dante und die kulturtheoretischen, topographischen und ethnographischen Deutungsansätze in Montaignes Essay untersucht. Abschließend werden die Ergebnisse der Textanalysen in einem komparatistischen Vergleich zusammengeführt.
Schlüsselwörter
Figurative Anthropophagie, Dante, Montaigne, "Divina Commedia", "Inferno", "Des cannibales", Poetik, Philosophie, Kulturtheorie, Vergleichende Literaturwissenschaft, Komparatistik.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das zentrale Motiv dieser vergleichenden Analyse?
Das zentrale Motiv ist die Anthropophagie (Kannibalismus), die in den Werken von Dante und Montaigne unterschiedlich dargestellt wird.
Wie deutet Dante den Akt des Kannibalismus in der Ugolino-Episode?
Bei Dante wird die Anthropophagie primär allegorisch als Ausdruck individueller Sünde und Strafe für Verrat interpretiert.
Welchen Ansatz verfolgt Montaigne in seinem Essay „Des cannibales“?
Montaigne nutzt das Motiv kulturtheoretisch und ethnographisch, um das Grausame als Teil des menschlichen Zustands und als Spiegelbild der eigenen Gesellschaft darzustellen.
In welchem Werk findet man die Ugolino-Episode?
Die Episode ist Teil des "Inferno" in Dantes Hauptwerk "Divina Commedia" (Die Göttliche Komödie).
Was ist das Ziel des komparatistischen Teils der Arbeit?
Ziel ist es, die religiösen, philosophischen und ästhetischen Konnotationen des Motivs gegenüberzustellen und Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede herauszuarbeiten.
- Quote paper
- Frederik Schlenk (Author), 2005, Figurative Anthropophagie bei Dante und Montaigne. Die "Ugolino"-Episode in "Divina commedia" und der Essay in "Des cannibales", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/302656