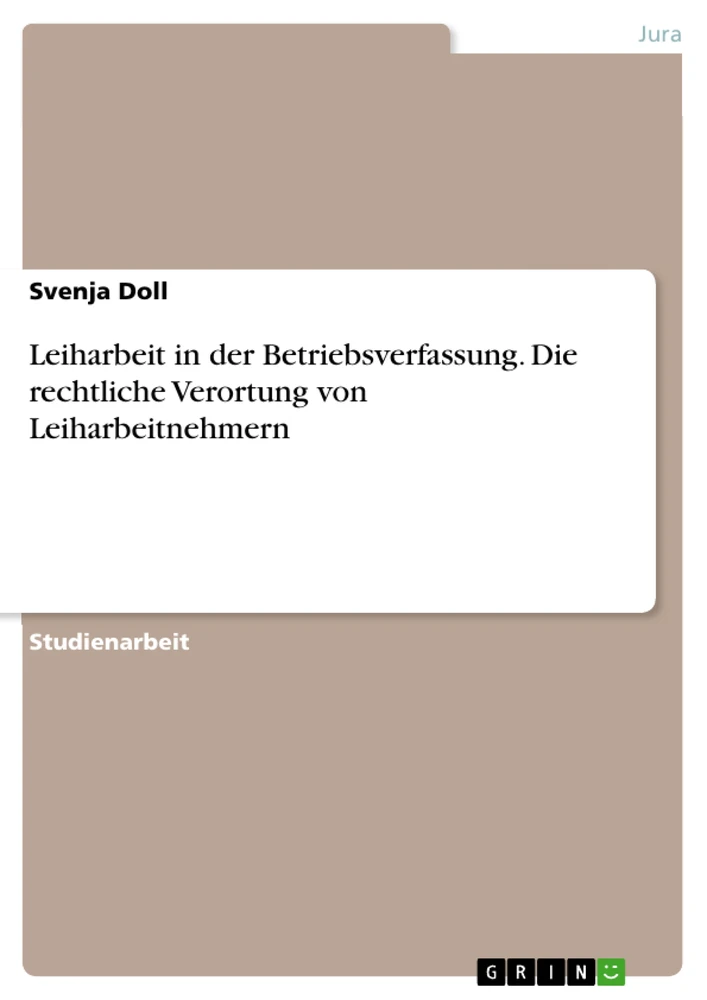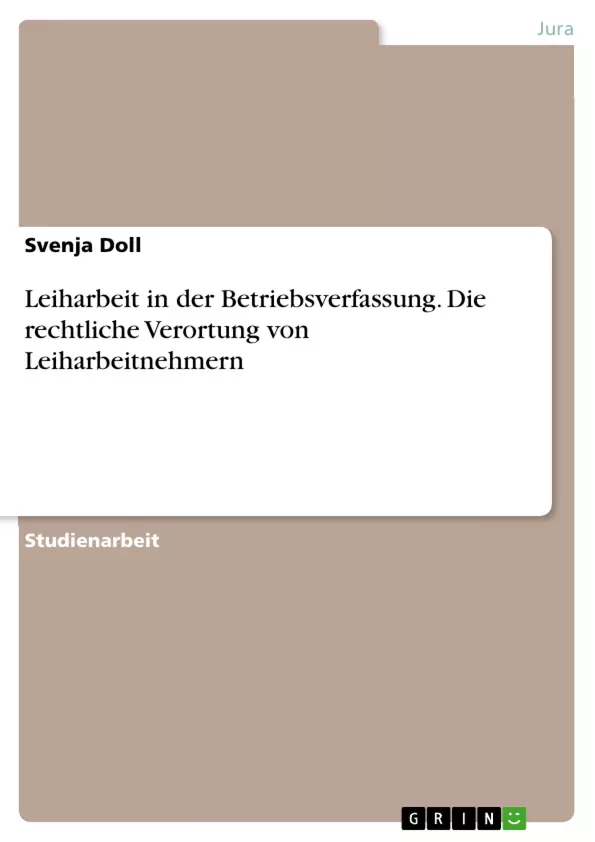In den vergangenen Jahren veränderte sich die betriebsverfassungsrechtliche Position des Leiharbeitnehmers grundlegend. Ausgehend vom Bundesarbeitsgericht wurde eine Distanz zu Beschlüssen deutlich, welche den Leiharbeitnehmer in der Betriebsverfassung bisher mit dem allgemeinen, betriebsverfassungsrechtlichen Arbeitnehmerbegriff gleichsetzten. Es ist gegenwärtig der Fall, dass die Rechtsprechung im Betriebsverfassungsgesetz weitestgehend reformiert wurde. Man ist also auf der Suche nach einer eindeutigeren, abgrenzenden Definition für den Leiharbeitnehmer, in der dessen gesonderte Stellung besser hervorgehoben werden kann. Gleichzeitig soll der allgemeine Arbeitnehmerbegriff wie bisher erhalten bleiben.
In der allgemeinen Auffassung der Rechtsprechung driften die Ansichten zum Thema Leiharbeitnehmerschaft zunehmend auseinander. Nicht zuletzt der kontrovers gesehene „Fall Amazon“ gab Anregung zur Diskussion um die Stellung von Leiharbeitnehmern in der Belegschaft eines Betriebes.
Wie also lässt sich der Leiharbeitnehmer konkret betriebsverfassungsrechtlich zuordnen? Was sind die Grundsätze der Betriebszugehörigkeit? Und welche Lösungsansätze gibt es in der Rechtsprechung?
Die Darlegung verschiedener Ansichten zu diesen Rechtsfragen soll den Kernpunkt dieser Arbeit darstellen.
Zu Beginn ist es erst einmal wichtig sich anzuschauen, wie der betriebsverfassungsrechtliche Arbeitnehmerbegriff eigentlich definiert ist, um möglicherweise eine Abgrenzung zum Leiharbeitnehmer herausarbeiten zu können, bevor man dann in die eigentliche Problematik der Zuordnung einsteigt. Nachdem die Position des Leiharbeitnehmers im Wesentlichen erläutert wurde, soll näher darauf eingegangen werden, welche Rechte ihm denn, sowohl im Verleihbetrieb, als auch im Entleihbetrieb zustehen. Dies insoweit, wie es zur Verdeutlichung der sich wandelnden Betrachtung des Leiharbeitnehmers einschlägig ist.
Hierbei ist, besonders bei Mitbestimmungs- und Mitwirkungsrechten, die Vielzahl von Schwellenwerten im Betriebsverfassungsgesetz zu berücksichtigen. Inwiefern dort durch gesetzliche Formulierungen die Leiharbeitnehmer miteinbezogen beziehungsweise herausgelassen werden, wird ebenfalls zum Gegenstand dieser Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Hauptteil
- 1. Allgemeines
- a) Der betriebsverfassungsrechtliche Arbeitnehmerbegriff
- b) Kennzeichen der Arbeitnehmerüberlassung
- aa) Gewerbsmäßige Arbeitnehmerüberlassung
- bb) Nicht gewerbsmäßige Arbeitnehmerüberlassung
- c) Generelle Regelungen des Betriebsverfassungsgesetzes
- 2. Definition & Zuordnung des Leiharbeitnehmers
- a) Allgemeiner Leiharbeitnehmerbegriff
- b) Problematik der Zuordnung des Leiharbeitnehmers
- aa) Rechtsprechung
- bb) Auslegung des § 14 AÜG und Meinungsstreit
- 3. Rechte des Leiharbeitnehmers
- a) Rechte des Leiharbeitnehmers im Verleihbetrieb
- b) Rechte des Leiharbeitnehmers im Entleihbetrieb
- aa) Wahlrechte
- bb) Organisatorische Berücksichtigung
- cc) Mitwirkungs- und Beschwerderechte
- dd) Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates
- 1. Allgemeines
- III. Schluss
- a) Zusammenfassung
- b) Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Position des Leiharbeitnehmers in der Betriebsverfassung und analysiert die sich verändernde Rechtsprechung in Bezug auf dessen Zuordnung und Rechte. Die Arbeit beleuchtet die unterschiedlichen Ansichten zur Definition des Leiharbeitnehmers im betriebsverfassungsrechtlichen Kontext und untersucht die Herausforderungen, die sich aus der Position des Leiharbeitnehmers in Bezug auf seine betriebsverfassungsrechtliche Zuordnung ergeben.
- Der betriebsverfassungsrechtliche Arbeitnehmerbegriff und seine Abgrenzung zum Leiharbeitnehmer
- Die Problematik der Zuordnung des Leiharbeitnehmers im Kontext der Rechtsprechung
- Die Rechte des Leiharbeitnehmers im Verleihbetrieb und Entleihbetrieb
- Die Rolle des Betriebsrates in Bezug auf die Mitbestimmungs- und Mitwirkungsrechte von Leiharbeitnehmern
- Die Bedeutung des § 14 AÜG und die unterschiedlichen Auslegungen in der Rechtsprechung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Hintergrund der Arbeit dar und skizziert die sich wandelnde Rechtsprechung in Bezug auf den Leiharbeitnehmer in der Betriebsverfassung. Das Hauptteil widmet sich zunächst dem betriebsverfassungsrechtlichen Arbeitnehmerbegriff und den Kennzeichen der Arbeitnehmerüberlassung. Anschließend wird der Leiharbeitnehmerbegriff definiert und die Problematik seiner Zuordnung im Rahmen der Rechtsprechung untersucht. Im weiteren Verlauf werden die Rechte des Leiharbeitnehmers im Verleihbetrieb und im Entleihbetrieb beleuchtet, wobei ein besonderer Fokus auf Wahl-, Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte gelegt wird. Der Schluss fasst die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammen und zieht ein Fazit.
Schlüsselwörter
Leiharbeitnehmer, Betriebsverfassung, Arbeitnehmerbegriff, Zuordnung, Rechte, Betriebszugehörigkeit, Rechtsprechung, § 14 AÜG, Mitbestimmung, Mitwirkung, Wahlrechte, Verleihbetrieb, Entleihbetrieb
Häufig gestellte Fragen
Wie ist der Arbeitnehmerbegriff im Betriebsverfassungsgesetz definiert?
Der Begriff umfasst alle Personen, die in einem privatrechtlichen Arbeitsverhältnis zum Arbeitgeber stehen und in den Betrieb eingegliedert sind.
Welche Rechte haben Leiharbeitnehmer im Entleihbetrieb?
Sie haben unter anderem Mitwirkungs- und Beschwerderechte sowie aktive Wahlrechte bei Betriebsratswahlen, sofern sie länger als drei Monate im Betrieb sind.
Was regelt § 14 des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG)?
Dieser Paragraf regelt die Stellung der Leiharbeitnehmer in Bezug auf das Betriebsverfassungsgesetz, insbesondere ihre Zuordnung zum Verleih- oder Entleihbetrieb.
Zählen Leiharbeitnehmer bei Schwellenwerten im Betrieb mit?
Dies ist ein zentraler Streitpunkt der Rechtsprechung; oft werden sie bei der Größe des Betriebsrats oder bei Mitbestimmungsrechten berücksichtigt.
Was war die Bedeutung des "Fall Amazon" für die Leiharbeit?
Der Fall gab Anstoß zu einer kontroversen Diskussion über die dauerhafte Eingliederung und die rechtliche Stellung großer Gruppen von Leiharbeitnehmern.
- Citation du texte
- Svenja Doll (Auteur), 2014, Leiharbeit in der Betriebsverfassung. Die rechtliche Verortung von Leiharbeitnehmern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/303385