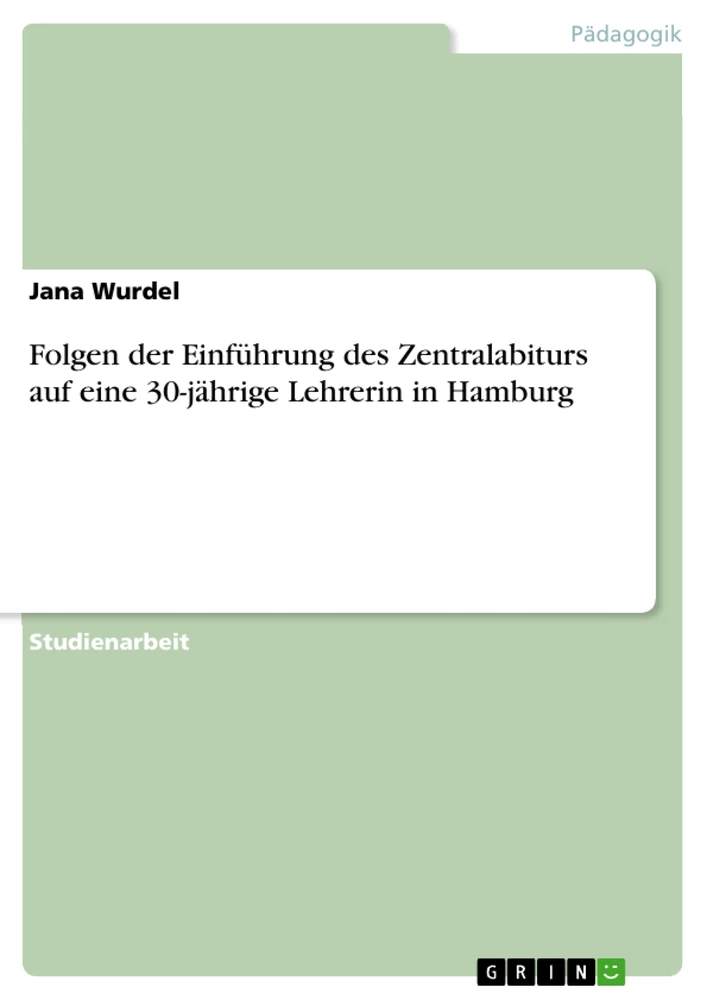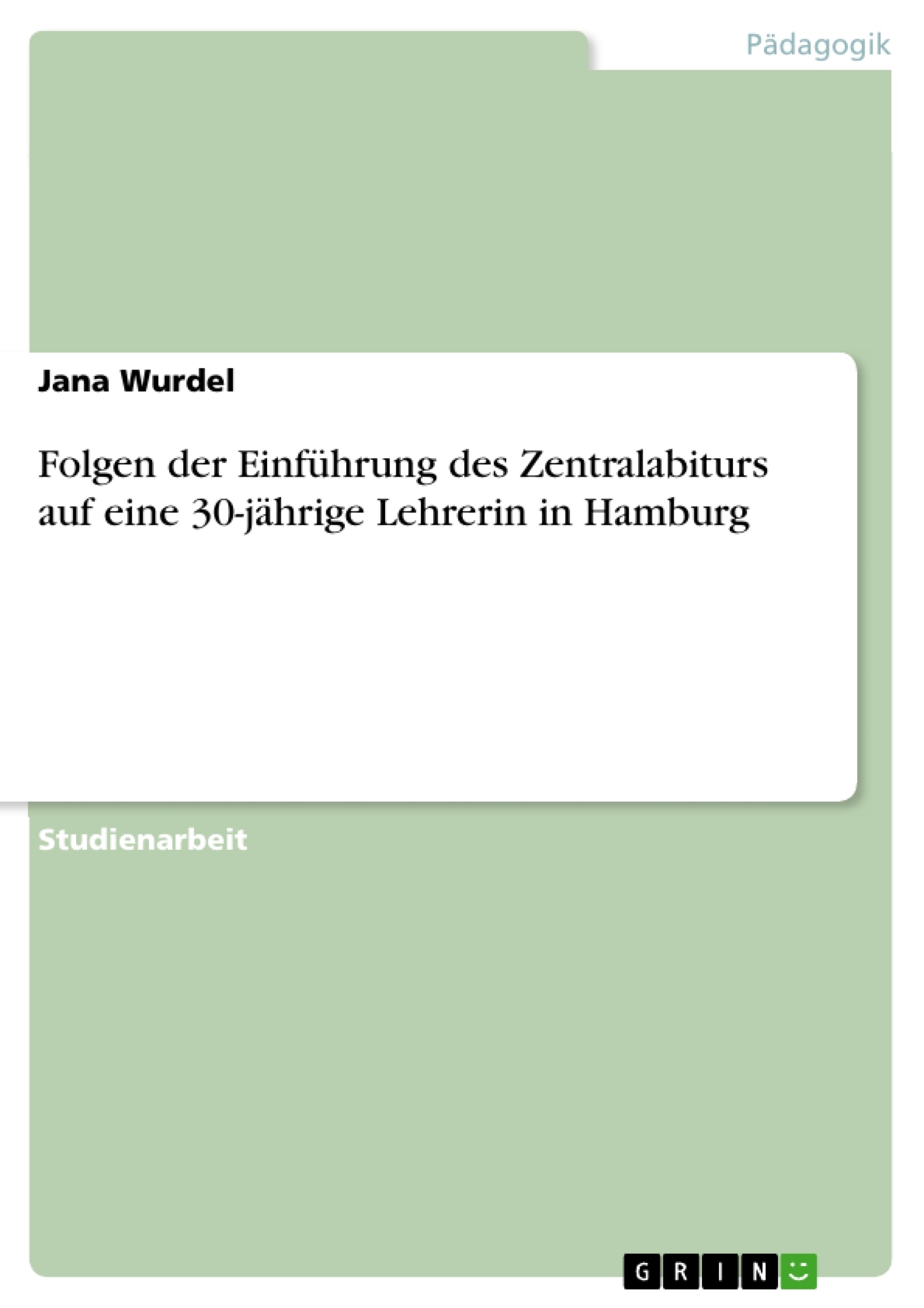Schon seit einigen Jahren wird in den Medien kritisch über unser Bildungssystem diskutiert. So ist die PISA-Studie aus 2000 sicherlich eine der Hauptursachen, warum es zur Einführung des Zentralabiturs gekommen ist. Unter Berücksichtigung des sozialen Umfelds von Kindern, den Regionen, in denen sie leben und Migrationshintergrund, oder nicht, lassen sich teilweise große Bildungsunterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern und Ländern aufzeigen. Wie kann man nun also Gerechtigkeit und somit auch Vergleichbarkeit schaffen? Mit gleichen Bedingungen für alle?
Es muss einen Standard, eine Norm geben, an der sich alle orientieren können und müssen. Am 25.06.2002 beschloss die Kultus-Minister-Konferenz (KMK) schließlich die Einführung nationaler Bildungsstandards für bestimmte Jahrgangsstufen und Abschlussarbeiten. Der Hamburger Schulsenator Ties Rabe, welcher auch amtierender Präsident der KMK ist, erklärte am 22.05.2012 über die Internetseite www.hamburg.de: „Zentrale Abiturprüfungen in allen Fächern schaffen Gerechtigkeit und Klarheit...“. Ist das aber wirklich so? Welche Veränderungen gehen nun tatsächlich mit der Einführung des Zentralabiturs einher? Diese Hausarbeit soll sich dem Thema dieser Veränderungen widmen. Im Fokus steht die Hansestadt Hamburg und beispielhaft die Erfahrungen einer Gymnasiallehrerin mit der Umstellung.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Theorierahmen Fragestellung, Hypothesen
- 2.1 Theorierahmen: Individualisierungsthese nach Ulrich Beck
- 2.1.1 Herleitung der Forschungsfrage
- 2.1.2 Forschungslücke
- 2.1.3 Forschungsfrage formulieren
- 2.1.4 Ableitung der Hypothesen
- 3 Methoden
- 3.1 Qualitative Sozialforschung
- 3.2 Feldzugang: Das Experteninterview
- 3.3 Qualitative Inhaltsanalyse nach Phillip Mayring
- 3.4 Interpretation der Ergebnisse
- 4 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit den Auswirkungen der Einführung des Zentralabiturs auf eine 30-jährige Gymnasiallehrerin in Hamburg. Sie untersucht die Veränderungen, die mit der Umstellung einhergehen und wie sich diese auf die Arbeit der Lehrerin auswirken. Die Arbeit stützt sich auf die Individualisierungsthese von Ulrich Beck, die den Fokus auf die Herauslösung des Menschen aus historisch vorgegebenen Sozialformen und die zunehmende Selbstbestimmung im Lebenslauf legt.
- Einfluss der PISA-Studie auf das deutsche Bildungssystem
- Einführung von Bildungsstandards und Zentralabitur
- Veränderungen in der Arbeit von Gymnasiallehrern
- Individualisierungsthese und ihre Relevanz im Bildungsbereich
- Erfahrungen einer Gymnasiallehrerin mit der Umstellung auf das Zentralabitur
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problematik der Bildungsungleichheit in Deutschland dar und führt in die Thematik der Einführung des Zentralabiturs ein. Kapitel 2 beleuchtet den theoretischen Rahmen der Arbeit, die Individualisierungsthese von Ulrich Beck. Hier werden die Forschungsfrage und die Hypothesen der Arbeit entwickelt. Kapitel 3 beschreibt die Methoden der qualitativen Sozialforschung, die in dieser Arbeit angewendet werden. Dazu gehören das Experteninterview und die qualitative Inhaltsanalyse. Kapitel 4 fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und zieht ein Fazit.
Schlüsselwörter
Zentralabitur, Bildungsstandards, Individualisierungsthese, Ulrich Beck, PISA-Studie, Gymnasiallehrer, Experteninterview, Qualitative Inhaltsanalyse, Bildungsreform, Vergleichbarkeit, Mobilität, Leistungsgesellschaft, Bildungsabhängigkeit.
Häufig gestellte Fragen
Warum wurde das Zentralabitur in Hamburg eingeführt?
Die Einführung geht maßgeblich auf die Ergebnisse der PISA-Studie 2000 zurück, um mehr Gerechtigkeit, Vergleichbarkeit und einheitliche Bildungsstandards zu schaffen.
Welche theoretische Grundlage nutzt die Hausarbeit?
Die Arbeit stützt sich auf die Individualisierungsthese von Ulrich Beck, die gesellschaftliche Wandlungsprozesse und die Selbstbestimmung im Lebenslauf beschreibt.
Wie wirkt sich das Zentralabitur auf die Arbeit von Lehrkräften aus?
Die Untersuchung zeigt Veränderungen in der Unterrichtsgestaltung und den Prüfungsanforderungen, die beispielhaft anhand eines Experteninterviews mit einer Hamburger Gymnasiallehrerin analysiert werden.
Welche Forschungsmethode wurde in der Arbeit angewendet?
Es wurde eine qualitative Sozialforschung durchgeführt, konkret ein Experteninterview, das mittels qualitativer Inhaltsanalyse nach Philipp Mayring ausgewertet wurde.
Sorgen zentrale Prüfungen tatsächlich für mehr Gerechtigkeit?
Dies ist eine zentrale Forschungsfrage der Arbeit. Während die Politik dies bejaht, untersucht die Arbeit kritisch die realen Auswirkungen auf den Schulalltag und die pädagogische Freiheit.
- Citation du texte
- Jana Wurdel (Auteur), 2012, Folgen der Einführung des Zentralabiturs auf eine 30-jährige Lehrerin in Hamburg, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/303414