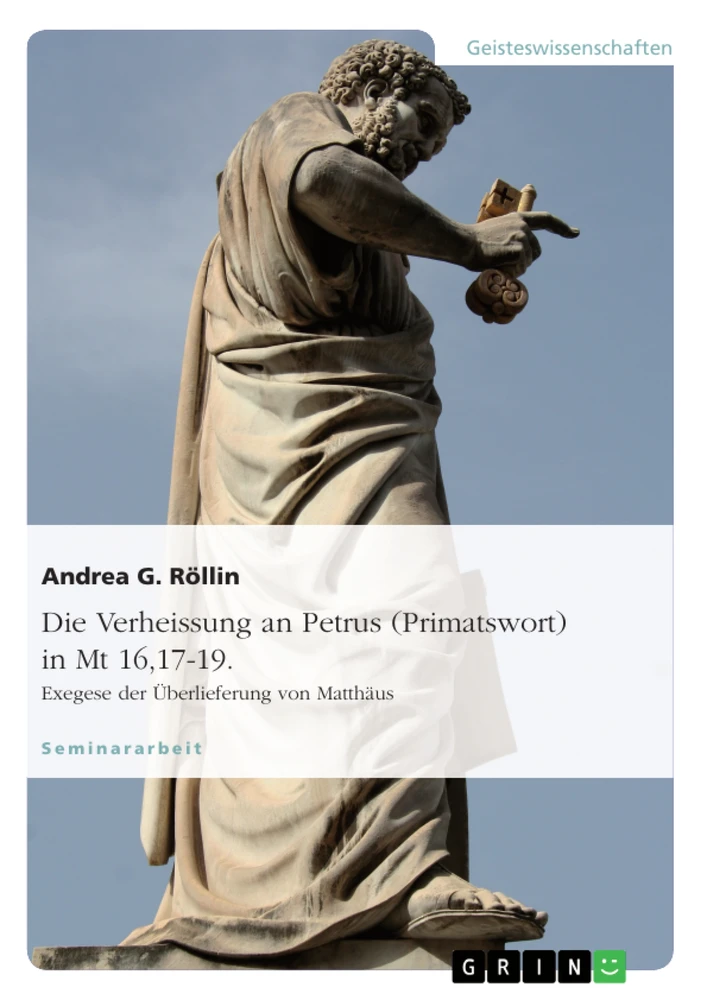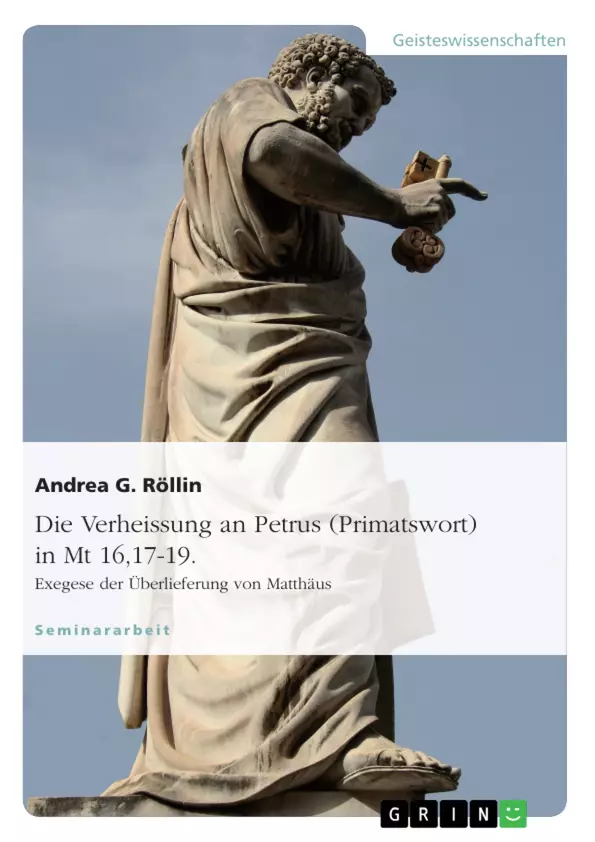Diese Proseminararbeit geht insbesondere den Fragen nach, ob Mt 16,17-19 auf den irdischen Jesus von Nazareth zurückgehen oder nicht, ob sie möglicherweise Teil des nachösterlichen Auferstehungsglaubens sind, warum sie der Evangelist Matthäus wohl überliefert hat und wie dieses sogenannte Primatswort textgerecht zu interpretieren ist.
Inhaltsverzeichnis
- Der Text von Mt 16,17-19 in eigener Übersetzung
- Textabgrenzung
- Textgliederung
- Kontexteinordnung
- Unklarheit des Textursprungs als eines der textkritischen Phänomen
- Mittels der Methode der Textanalyse
- Mittels der formgeschichtlichen Methode
- Mittels der traditionsgeschichtlichen Methode
- Mittels der redaktionsgeschichtlichen Methode
- Zusammenfassende Interpretation
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Analyse des Textes Mt 16,17-19, der die sogenannte Petrus-Verheißung beinhaltet. Die Zielsetzung ist es, die textkritischen Aspekte dieses Abschnitts zu untersuchen und dessen Entstehung sowie Bedeutung im Kontext der Evangelien zu ergründen. Der Fokus liegt auf der Klärung des Ursprungs des Textes, insbesondere der Frage nach seiner Echtheit und historischen Zuordnung zu Jesus.
- Analyse der textkritischen Phänomene im Text Mt 16,17-19
- Untersuchung der Echtheitsfrage und des Ursprungs der Petrus-Verheißung
- Einordnung des Textes in den Kontext der Evangelien, insbesondere Matthäus
- Anwendung verschiedener textanalytischer Methoden zur Interpretation des Abschnitts
- Bedeutung des Textes für das Verständnis des Petrusamtes in der frühen Kirche
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Dieser Abschnitt bietet eine eigene Übersetzung des Textes Mt 16,17-19.
- Kapitel 2: Hier wird der Text anhand der Verszählung abgegrenzt und seine Position im Kontext der umrahmenden Jüngergespräche erörtert. Es wird hervorgehoben, dass die Verse 17-19 als Einschub in die in Mt 16,13-16.20 wiedergegebene markinische Caesareaszene gelten.
- Kapitel 3: Es wird die textliche Struktur von Mt 16,17-19 analysiert. Der Text wird in drei Strophen unterteilt, wobei jede Strophe aus drei Zeilen besteht. Dabei wird der antithetische Parallelismus innerhalb der Strophen hervorgehoben.
- Kapitel 4: In diesem Kapitel erfolgt die Einordnung des Textes in den Gesamtkontext des Matthäusevangeliums. Es werden Verbindungen zu anderen Abschnitten des Evangeliums hergestellt und die Bedeutung des Textes für die christologische Lehre Matthäus' beleuchtet.
- Kapitel 5: Hier wird das textkritische Phänomen der Unklarheit des Textursprungs von Mt 16,17-19 untersucht. Es wird festgestellt, dass der Text nur in Matthäus vorkommt und dessen Eigengut darstellt. Es wird argumentiert, dass der Text zwar kein spätes Fälschung ist, aber dennoch nicht zum Bestand des ältesten Evangeliums gehört und nachträglich aufgenommen wurde.
- Kapitel 6: Dieses Kapitel stellt eine Untersuchung des Textursprungs mittels verschiedener textanalytischer Methoden vor, darunter die Textanalyse selbst, die form-, traditions- und redaktionsgeschichtliche Methode. Ziel ist es, die Echtheitsfrage des Textes zu klären und seine historische Zuordnung zu Jesus zu überprüfen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen des Textes Mt 16,17-19, darunter Petrus-Verheißung, Echtheit, Textkritik, formgeschichtliche Methode, traditionsgeschichtliche Methode, redaktionsgeschichtliche Methode, Matthäus-Evangelium, Caesareaszene, Messiasbekenntnis, Petrusamt und frühchristliche Theologie. Im Zentrum steht die Analyse der textkritischen Phänomene und die Frage nach der historischen Zuordnung des Textes zu Jesus.
Häufig gestellte Fragen
Geht die Petrus-Verheißung (Mt 16,17-19) auf den historischen Jesus zurück?
Die Forschung ist uneinig. Während einige den Text als echtes Jesuswort sehen, betrachten andere ihn als nachösterliche Bildung der matthäischen Gemeinde oder als späteres Eigengut des Evangelisten.
Was bedeutet der Begriff „Primatswort“?
Es bezeichnet die Verheißung Jesu an Simon Petrus, ihn zum „Fels“ zu machen, auf dem die Kirche gebaut wird, und ihm die „Schlüssel des Himmelreichs“ zu übergeben.
Warum findet sich dieser Text nur im Matthäus-Evangelium?
Es handelt sich um „Sondergut“ des Matthäus. Er fügte diese Verse vermutlich in die markinische Vorlage der Caesareaszene ein, um die Rolle des Petrus in seiner spezifischen Gemeinde zu stärken.
Welche Rolle spielt der antithetische Parallelismus in Mt 16,17-19?
Der Text ist hochgradig strukturiert in drei Strophen. Der Parallelismus (z. B. binden/lösen) unterstreicht die Vollmacht, die Petrus übertragen wird, und deutet auf einen semitischen Sprachhintergrund hin.
Welche exegetischen Methoden werden zur Untersuchung des Textes genutzt?
Zur Analyse werden die Textkritik, die Formgeschichte, die Traditionsgeschichte sowie die Redaktionsgeschichte angewandt, um den Ursprung und die theologische Absicht zu klären.
- Quote paper
- Dr.iur. Andrea G. Röllin (Author), 2015, Die Verheissung an Petrus (Primatswort) in Mt 16,17-19. Exegese der Überlieferung von Matthäus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/303839