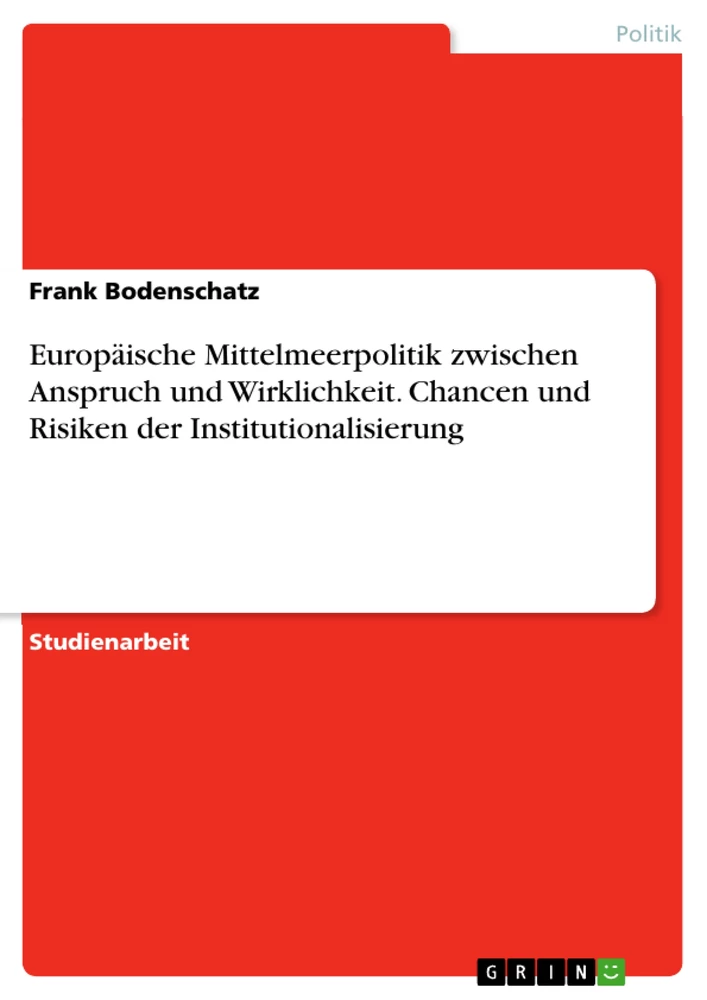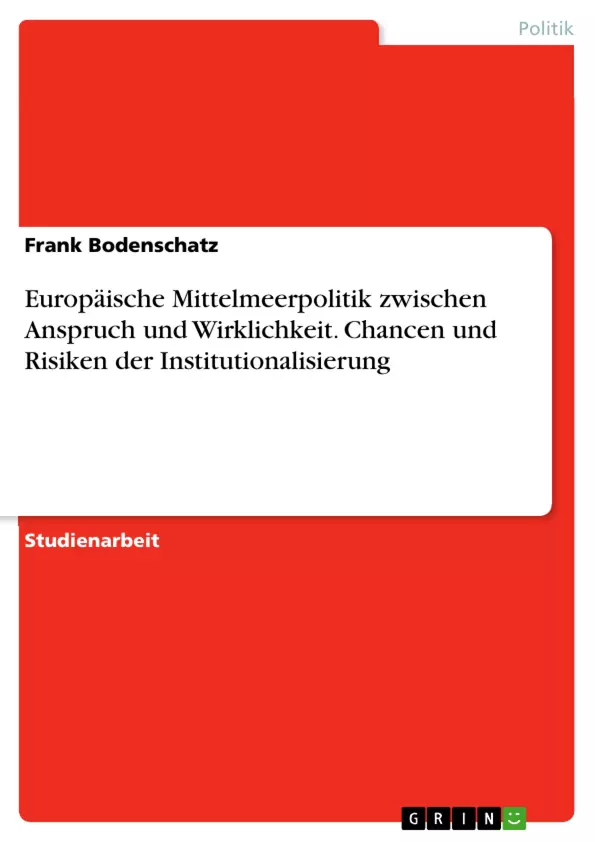Mit dem Fall des Eisernen Vorhangs endete der Ost-West-Konflikt. Der Kampf der Ideologien wurde vom „Kampf der Kulturen“ abgelöst, welcher seinen Schauplatz unter anderem im Mittelmeerraum haben sollte – so zumindest die umstrittene Prophezeiung von Samuel P. Huntington.
Tatsächlich wurde von den südlichen EU-Ländern mit Blick auf Nordafrika schon damals ein Bedrohungsszenario skizziert, welches letztlich den Anlass dafür gab, auf eine gemeinsam koordinierte Mittelmeerpolitik hinzuwirken. Als Ergebnis der Konferenz von Barcelona entstand im Jahre 1995 unter Einbindung der Mittelmeerdrittländer zunächst die „Euro-Mediterrane Partnerschaft“, 13 Jahre später folgte die „Union für den Mittelmeerraum“.
Beide Projekte gelten mittlerweile als weitgehend gescheitert. So sei etwa die Mittelmeerunion „[heute] nahezu von der politischen Bildfläche verschwunden“. Doch wie konnte es dazu kommen?
Das Anliegen dieser Arbeit ist es, die Entwicklung der institutionalisierten EU-Mittelmeerpolitik von ihren Anfängen zu Beginn der 1990er Jahre bis in die Gegenwart nachzuzeichnen, die offensichtlichen Diskrepanzen zwischen Anspruch und Wirklichkeit herauszuarbeiten und mögliche Perspektiven für die Zukunft aufzuzeigen. In diesem Kontext gilt es, die Frage zu klären, inwiefern Chancen und Risiken der Institutionalisierung miteinander korrelieren und in welchen Bereichen bzw. unter welchen Bedingungen sich der einst viel beachtete Ansatz doch noch zu einem Erfolgsmodell entwickeln kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Aufbau und Methodik
- Forschungsstand
- Die „Euro-Mediterrane Partnerschaft“ (EMP)
- Entstehung, Ziele und Intentionen
- Institutionen und Instrumente
- Praxis
- Die „Union für die Mittelmeerregion“ (UfM)
- Entstehung, Ziele und Intentionen
- Institutionen und Instrumente
- Praxis
- Südliche Partnerschaft am Scheideweg? Gegenwart und Zukunft der UfM
- Bilanz der bisherigen EU-Mittelmeerpolitik
- Aktuelle Probleme und Herausforderungen
- Zukunftsszenarien
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Entwicklung der institutionalisierten EU-Mittelmeerpolitik von ihren Anfängen bis in die Gegenwart. Sie untersucht die Diskrepanzen zwischen Anspruch und Wirklichkeit und beleuchtet mögliche Perspektiven für die Zukunft. Die Arbeit befasst sich mit der Frage, inwiefern Chancen und Risiken der Institutionalisierung miteinander korrelieren und unter welchen Bedingungen sich die EU-Mittelmeerpolitik zu einem Erfolgsmodell entwickeln könnte.
- Analyse der „Euro-Mediterranen Partnerschaft“ (EMP) und der „Union für die Mittelmeerregion“ (UfM)
- Bewertung der bisherigen EU-Mittelmeerpolitik
- Identifizierung aktueller Probleme und Herausforderungen
- Entwicklung von Zukunftsszenarien für die EU-Mittelmeerpolitik
- Beurteilung der Chancen und Risiken der Institutionalisierung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problemstellung und den Aufbau der Arbeit dar. Kapitel 2 beleuchtet die „Euro-Mediterrane Partnerschaft“ (EMP) und Kapitel 3 die „Union für die Mittelmeerregion“ (UfM). Beide Kapitel analysieren Entstehung, Ziele, Institutionen, Instrumente und Praxis der jeweiligen Projekte. Kapitel 4 widmet sich der Gegenwart und Zukunft der UfM, indem es eine Bilanz der bisherigen EU-Mittelmeerpolitik zieht, aktuelle Probleme und Herausforderungen beleuchtet und verschiedene Zukunftsszenarien vorstellt.
Schlüsselwörter
EU-Mittelmeerpolitik, Euro-Mediterrane Partnerschaft (EMP), Union für die Mittelmeerregion (UfM), Institutionalisierung, Chancen, Risiken, Anspruch, Wirklichkeit, Nord-Süd-Dialog, Mittelmeerdrittländer (MDL), Arabischer Frühling, Zukunftsszenarien.
Häufig gestellte Fragen
Was war die "Euro-Mediterrane Partnerschaft" ( Barcelona-Prozess)?
Ein 1995 gestartetes Projekt zur Zusammenarbeit zwischen der EU und Mittelmeerdrittländern in den Bereichen Politik, Wirtschaft und Soziales.
Was unterscheidet die "Union für den Mittelmeerraum" von der EMP?
Die 2008 gegründete Mittelmeerunion zielte auf eine stärkere Institutionalisierung und konkrete Projektzusammenarbeit ab, leidet aber unter politischen Blockaden.
Warum gelten die EU-Mittelmeerprojekte als weitgehend gescheitert?
Gründe sind politische Konflikte (z.B. Nahostkonflikt), mangelndes Interesse einiger Mitgliedstaaten und die Diskrepanz zwischen großen Versprechen und geringer Umsetzung.
Welchen Einfluss hatte der Arabische Frühling auf die Mittelmeerpolitik?
Er stellte die bisherige Stabilitätspolitik der EU in Frage und zwang zu einer Neuausrichtung der Partnerschaften mit Blick auf Demokratisierung und Menschenrechte.
Welche Zukunftsszenarien gibt es für die Mittelmeerunion?
Die Arbeit diskutiert Szenarien von der vollständigen Bedeutungslosigkeit bis hin zu einem reformierten Erfolgsmodell durch engere, interessengeleitete Kooperation.
- Citation du texte
- Frank Bodenschatz (Auteur), 2013, Europäische Mittelmeerpolitik zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Chancen und Risiken der Institutionalisierung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/304018