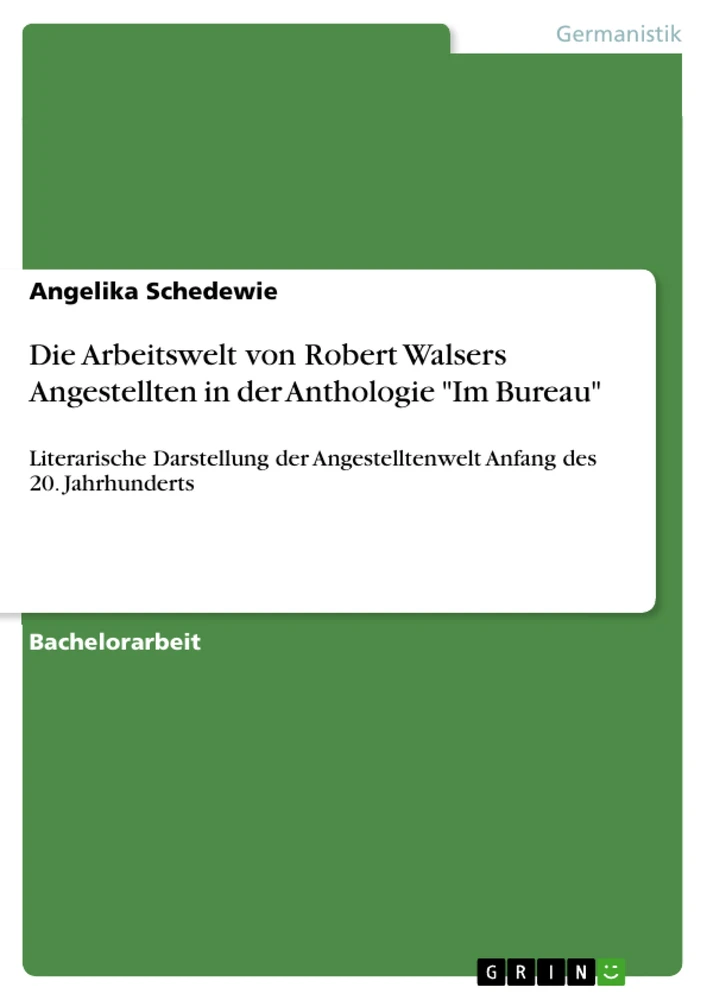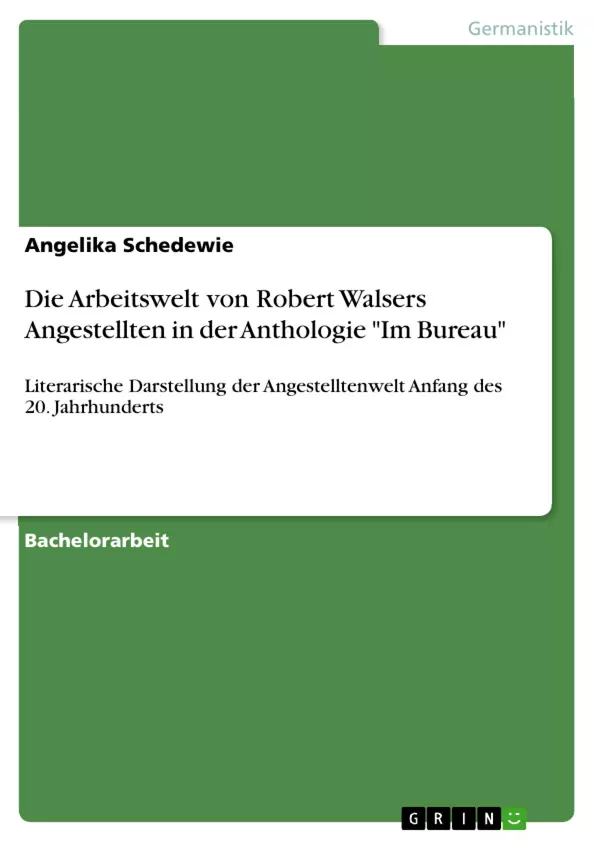Seit gut 20 Jahren arbeite ich in der freien Wirtschaft als Angestellte eines internationalen Unternehmens. Der Büroalltag, dessen Kultur und Mitarbeiter haben mich über die Jahre geprägt und gefördert und sind Teil meines Lebens geworden. So weckte das mir bisher unbekannte Genre der „Büroromane“ schnell meine Neugierde und der Wunsch entstand, die literarische Darstellung der Bürowelt und das Angestelltendasein in den Mittelpunkt meiner Examensarbeit zu stellen.
Bereits im 19. Jahrhundert wurden Angestellte und Beamte zu Protagonisten in der Literatur; Nikolai Gogols "Der Mantel" (1842) und Italo Svevos "Ein Leben" (1892) sind frühe Beispiele
dafür. In Schweden spiegelten Elin Wägner in ihrem Debütroman "Norrtullsligan" (1908) und Ernst L. Ekman in dem Roman "Kontor" (1939) die Bürowelt wieder, während in der deutsch-sprachigen Literatur u. a. Irmgard Keun in "Gilgi – eine von uns" (1931) und Martin Kessel in "Herrn Brechers Fiasko" (1931) literarisch das Angestellten-Leben und ihren Alltag festhielten.
In der Vielzahl geeigneter Primärliteratur entdeckte ich "Im Bureau" (2011) – eine von Reto Sorg und Lucas Marco Gisi posthum und thematisch gebündelte Sammlung von Texten des deutsch-schweizerischen Autors Robert Walser (1878-1956), die den Büroalltag des frühen 20. Jahrhunderts in kurzen literarischen Portraits beleuchtet. Obwohl die Geschichten dieser Anthologie vor einhundert Jahren geschrieben wurden, spürte ich eine Verbindung zu meinem eigenen Arbeitsalltag und erkannte Kollegen und Situationen in der fiktiven Welt wieder. Walser war selbst viele Jahre in der Bank und im Versicherungswesen tätig, und so ahnte ich einen unausweichlichen autobiographischen Einfluss in den Texten, was das Werk für mich noch interessanter machte.
Der Fokus meiner Arbeit liegt auf diesen Betrachtungen von Walser, wo das Büroleben, seine Umgebung und die Menschen dieses Milieus beleuchtet werden. Für die Untersuchung wird zudem Sekundärliteratur, die auf den Angestelltenalltag dieser Zeitperiode eingeht, verwendet, wie z. B. die von Siegfried Kracauer (1889-1966) deutsche soziologische Studie "Die Angestellten" (1929). [...]
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- Der Autor und das Werk
- Eingrenzung der Arbeit
- Ziel der Untersuchung und Begründung
- Methode
- Gliederung der Arbeit
- ROBERT WALSER, Im Bureau – ANALYSE DES MATERIALS
- Der Commis (1902)
- Ein Vormittag (1907)
- Das Büebli (1908)
- Germer (1910)
- Helblings Geschichte (1913)
- Der arme Mann (1916)
- Poetenleben (1916)
- Helbling (1917)
- Der Sekretär (1917)
- Der junge Dichter (1918)
- Erich (1925)
- Acht Uhr (1926)
- Herren und Angestellte (1928)
- Aus dem Leben eines Commis (1928/29)
- Die Verkäuferin (1931/32)
- AUSWERTUNG/SCHLUSS
- Zusammenfassung der Ergebnisse
- Abschließende Bemerkungen
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der literarischen Darstellung der Angestelltenwelt im frühen 20. Jahrhundert durch Robert Walser. Die Hauptzielsetzung ist die Untersuchung der fiktiven Angestelltenfiguren in Walsers Anthologie „Im Bureau“ und deren Interaktion mit Vorgesetzten und Kollegen sowie ihre Einstellung zur eigenen Berufsrolle. Darüber hinaus soll analysiert werden, ob die soziologischen Erkenntnisse von Siegfried Kracauer in der Studie „Die Angestellten“ sich in Walsers Texten widerspiegeln.
- Die Darstellung von Angestellten als Stereotype mit charakterlichen Differenzierungen.
- Die Analyse der Interaktionen zwischen Angestellten und Vorgesetzten im Hinblick auf Konformität und Rebellion.
- Die Darstellung der horizontalen Beziehungen zwischen Kollegen, geprägt von Neid, Missgunst und Isolation.
- Die Rolle der inneren Haltung zu Konflikten, sowohl problem- als auch lösungsfokussiert, und deren Einfluss auf das Handlungsvermögen der Figuren.
- Der Vergleich von Walsers literarischen Beobachtungen mit den soziologischen Erkenntnissen von Siegfried Kracauer.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit analysiert die einzelnen Texte aus Walsers Anthologie „Im Bureau“ chronologisch und untersucht die verschiedenen Typen von Angestellten. Sie beleuchtet die Beziehungen der Figuren zu Vorgesetzten und Kollegen, sowie ihre Einstellungen zum eigenen Beruf und zu sich selbst.
Im ersten Kapitel „Der Commis“ werden die vielfältigen Rollen dargestellt, in die sich der Commis im Berufsalltag verwandelt, um Anerkennung zu erlangen, beispielsweise als Schauspieler, Streber oder Opfer. Kapitel „Ein Vormittag“ stellt den konformen Mitarbeiter, den Streber und den Rebellen als Typen dar, die sich durch ihr Verhalten im Büroalltag abgrenzen. „Das Büebli“ präsentiert die Figur des Strebers, der sich durch Anpassung und Leistung eine Karriere erhoffen will. „Germer“ stellt den Burnout-Kandidaten dar, der durch Stress und Überforderung seine Emotionen nicht mehr kontrollieren kann. In „Helblings Geschichte“ schildert Helbling selbst seine Trägheit und Arbeitscheu, die ihn zu einem Außenseiter machen. „Der arme Mann“ zeigt die Armut des Selbstvertrauens und die fehlende Vision eines Angestellten. „Poetenleben“ beleuchtet den jungen Mann, der sich in seinem Beruf fehl am Platz fühlt und eine andere Berufung verfolgt. „Helbling“ beschreibt den Rebellen Helbling, der durch dreiste Provokationen seine Stelle verliert. „Der Sekretär“ schildert den Aufstieg und Fall eines Mannes, der auf seinem Ruhm als Schriftsteller baut, aber im Geschäftsleben scheitert. „Der junge Dichter“ zeigt einen Mann, der sich nicht entscheiden kann, was er beruflich machen möchte und in Träumen versinkt. „Erich“ stellt den inneren Konflikt eines Angestellten dar, der sich sowohl im Beruf als auch im Leben nicht am richtigen Platz fühlt. „Acht Uhr“ beschreibt die beiden Taktgeber des Angestelltenlebens: Acht Uhr früh, die zum Arbeiten zwingt, und Acht Uhr abends, die zum Vergnügen einlädt. „Herren und Angestellte“ reflektiert über die Unterschiede zwischen Führungskräften und Angestellten und deren Sehnsucht nach dem jeweils anderen Leben. „Aus dem Leben eines Commis“ beleuchtet die Transformation eines stellenlosen Commis, der durch Erfahrung und Selbstfindung eine neue Stelle findet. „Die Verkäuferin“ schildert die Beziehung zwischen einem Chef und seiner Angestellten, die auf gegenseitiger Anerkennung und Wertschätzung basiert.
Schlüsselwörter
Angestellte, Büroalltag, Robert Walser, Im Bureau, Angestelltenfiguren, Interaktion, Vorgesetzte, Kollegen, Berufsrolle, Siegfried Kracauer, Die Angestellten, Typologie, Konformität, Rebellion, Problemfokussiert, Lösungsfokussiert, Zeitlosigkeit, Aktualität.
- Citation du texte
- Angelika Schedewie (Auteur), 2015, Die Arbeitswelt von Robert Walsers Angestellten in der Anthologie "Im Bureau", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/304487