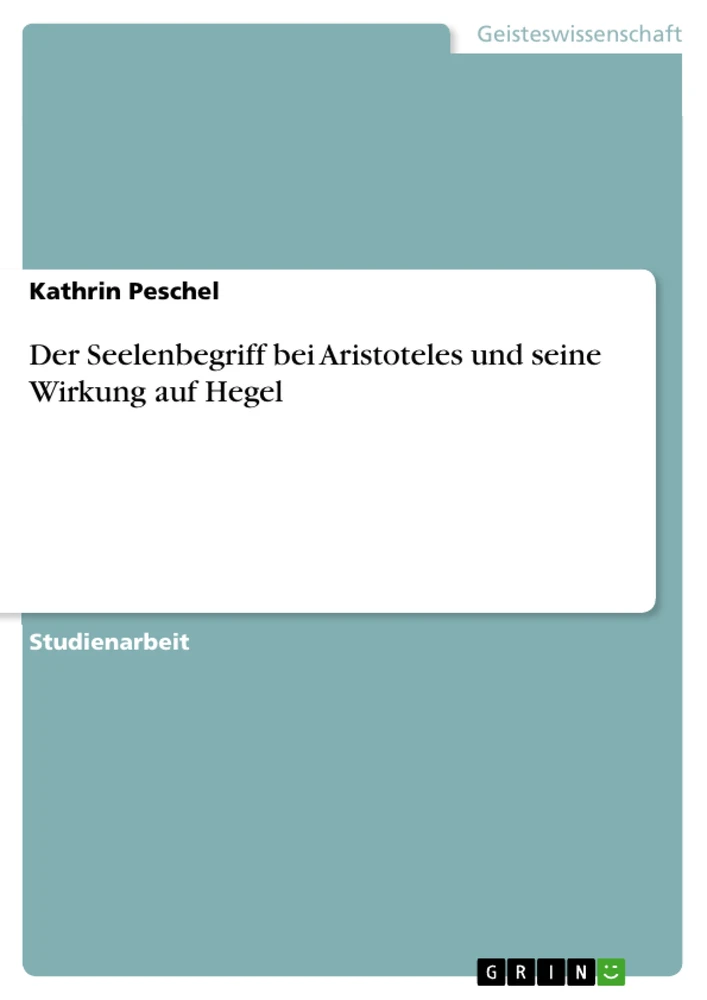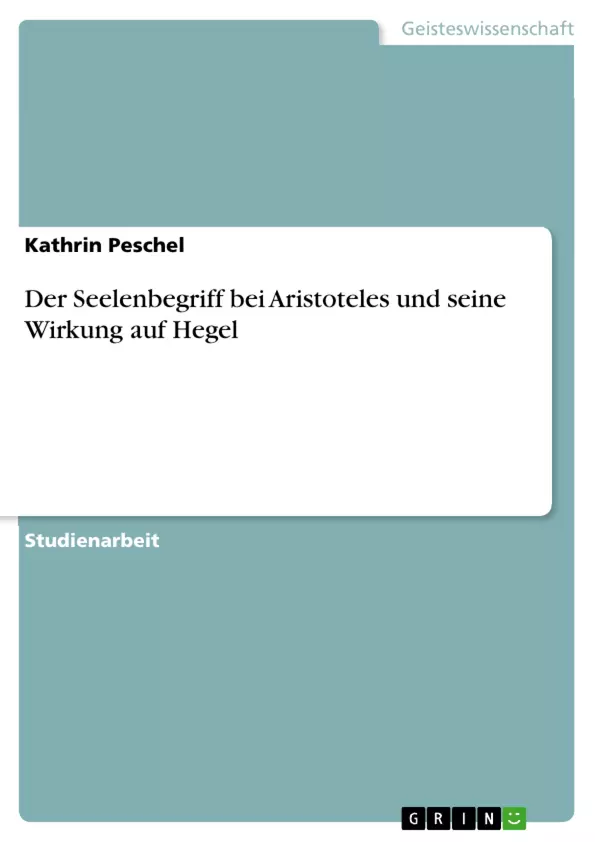In dieser Arbeit soll der Frage nachgegangen werden, was Aristoteles in den Seelentheorien seiner Vorgänger kritisiert, wie er selbst die Seele beschreibt und inwiefern er mit seinen Überlegungen Georg Wilhelm Friedrich Hegel beim Verfassen seiner Enzyklopädie und Philosophie des Geistes beeinflusst. Im Zusammenhang mit dem Seelenbegriff geht auch das Leib-Seele-Problem einher. Es sollen die Ansichten der Antike mit denen des deutschen Idealismus aufgezeigt werden.
Gekoppelt an die Ethik soll die Ausarbeitung der Seelenlehre des Aristoteles in dieser Arbeit daher anhand der "Nikomachischen Ethik" und "De anima" erfolgen. Die wichtigsten Theorien werden auf Hegel projiziert und die Unterschiede dargelegt. In erster Linie sollen dafür Hegels Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie herangezogen werden und mit seinen Theorien aus der Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften (1830) erweitert werden. Mit Sekundärliteratur erfolgt dabei die Darstellung der von Hegel übernommenen Ansichten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Aristoteles' Seelenbegriff
- Nikomachische Ethik
- De anima
- Wirkung auf Hegel
- Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie
- Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit setzt sich zum Ziel, Aristoteles' Kritik an den Seelenlehren seiner Vorgänger zu untersuchen und seine eigene Beschreibung der Seele zu beleuchten. Des Weiteren soll die Frage geklärt werden, inwiefern Aristoteles' Überlegungen Georg Wilhelm Friedrich Hegel bei der Entwicklung seiner Enzyklopädie und Philosophie des Geistes beeinflusst haben. Dabei wird insbesondere auf das Leib-Seele-Problem eingegangen und die Ansichten der Antike mit denen des deutschen Idealismus verglichen. Die Ausarbeitung der Seelenlehre des Aristoteles wird anhand der Nikomachischen Ethik und De anima erfolgen, wobei die wichtigsten Theorien auf Hegel projiziert und die Unterschiede aufgezeigt werden.
- Aristoteles' Kritik an den Seelenlehren seiner Vorgänger
- Aristoteles' eigene Beschreibung der Seele
- Der Einfluss von Aristoteles auf Hegel
- Das Leib-Seele-Problem im Vergleich zwischen Antike und deutschem Idealismus
- Die Seelenlehre des Aristoteles im Kontext der Nikomachischen Ethik und De anima
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die lange Geschichte der Beschäftigung mit der Frage nach der Seele und stellt die zentrale Rolle dieses Begriffs für die Anthropologie heraus. Die Arbeit befasst sich insbesondere mit den Theorien von Aristoteles und Hegel, wobei die Frage nach dem Einfluss des ersteren auf den letzteren im Vordergrund steht.
Das Kapitel über Aristoteles' Seelenbegriff analysiert die Nikomachische Ethik und De anima. Es wird gezeigt, wie Aristoteles die Seele in verschiedene Teile gliedert, wobei er zwischen einem unvernünftigen und einem vernünftigen Teil unterscheidet. Dieser Aufbau der Seele findet sich auch in Hegels Philosophie wieder.
Das Kapitel über Hegels Auseinandersetzung mit Aristoteles beleuchtet die Rezeption von Aristoteles' Ideen in Hegels Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie und in der Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften. Es wird deutlich, inwiefern Hegels eigene Philosophie durch Aristoteles beeinflusst wurde.
Der Text bietet eine umfassende Analyse von Aristoteles' Seelenlehre und zeigt die Bedeutung seiner Ideen für die Entwicklung der Philosophie des Geistes. Es werden die wichtigsten Theorien des griechischen Philosophen und die Weiterentwicklungen in Hegels Werk aufgezeigt, ohne jedoch die Schlussfolgerungen oder zentralen Argumente der Arbeit zu verraten.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem Seelenbegriff bei Aristoteles und seiner Wirkung auf Hegel. Zentrale Themen sind die Kritik an den Seelenlehren der Vorgänger, die Beschreibung der Seele in unterschiedliche Teile, das Leib-Seele-Problem und die Rezeption von Aristoteles' Ideen in der Philosophie des Geistes.
Häufig gestellte Fragen
Was kritisiert Aristoteles an den Seelentheorien seiner Vorgänger?
Aristoteles setzt sich kritisch mit den Ansätzen früherer Naturphilosophen auseinander, um seine eigene Definition der Seele als Form des Körpers abzugrenzen.
Wie beeinflusste Aristoteles die Philosophie von Hegel?
Hegel griff in seiner "Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften" und der "Philosophie des Geistes" auf aristotelische Konzepte zurück, insbesondere bei der Gliederung der Seele.
Was ist das Leib-Seele-Problem im Kontext dieser Arbeit?
Es wird der Vergleich zwischen den antiken Ansichten des Aristoteles und den Theorien des deutschen Idealismus bei Hegel hinsichtlich der Verbindung von Körper und Geist untersucht.
Welche Werke des Aristoteles werden primär analysiert?
Die Untersuchung stützt sich maßgeblich auf die "Nikomachische Ethik" und die Schrift "De anima".
Wie gliedert Aristoteles die menschliche Seele?
Aristoteles unterscheidet zwischen einem unvernünftigen Teil (vegetativ/strebend) und einem vernünftigen Teil der Seele.
- Citation du texte
- Kathrin Peschel (Auteur), 2014, Der Seelenbegriff bei Aristoteles und seine Wirkung auf Hegel, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/304491