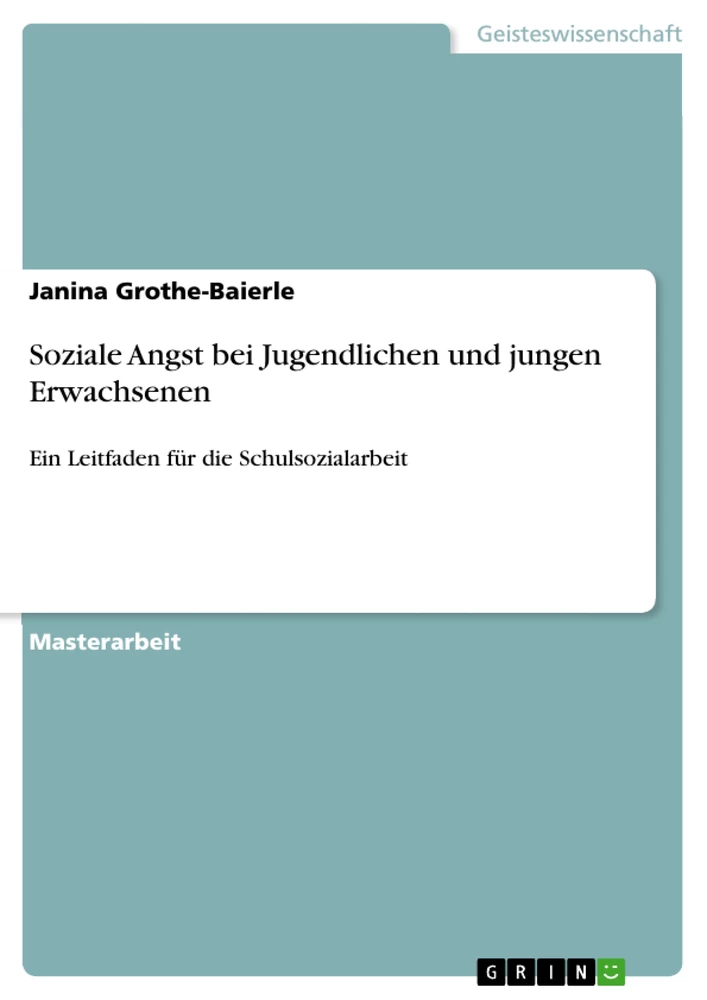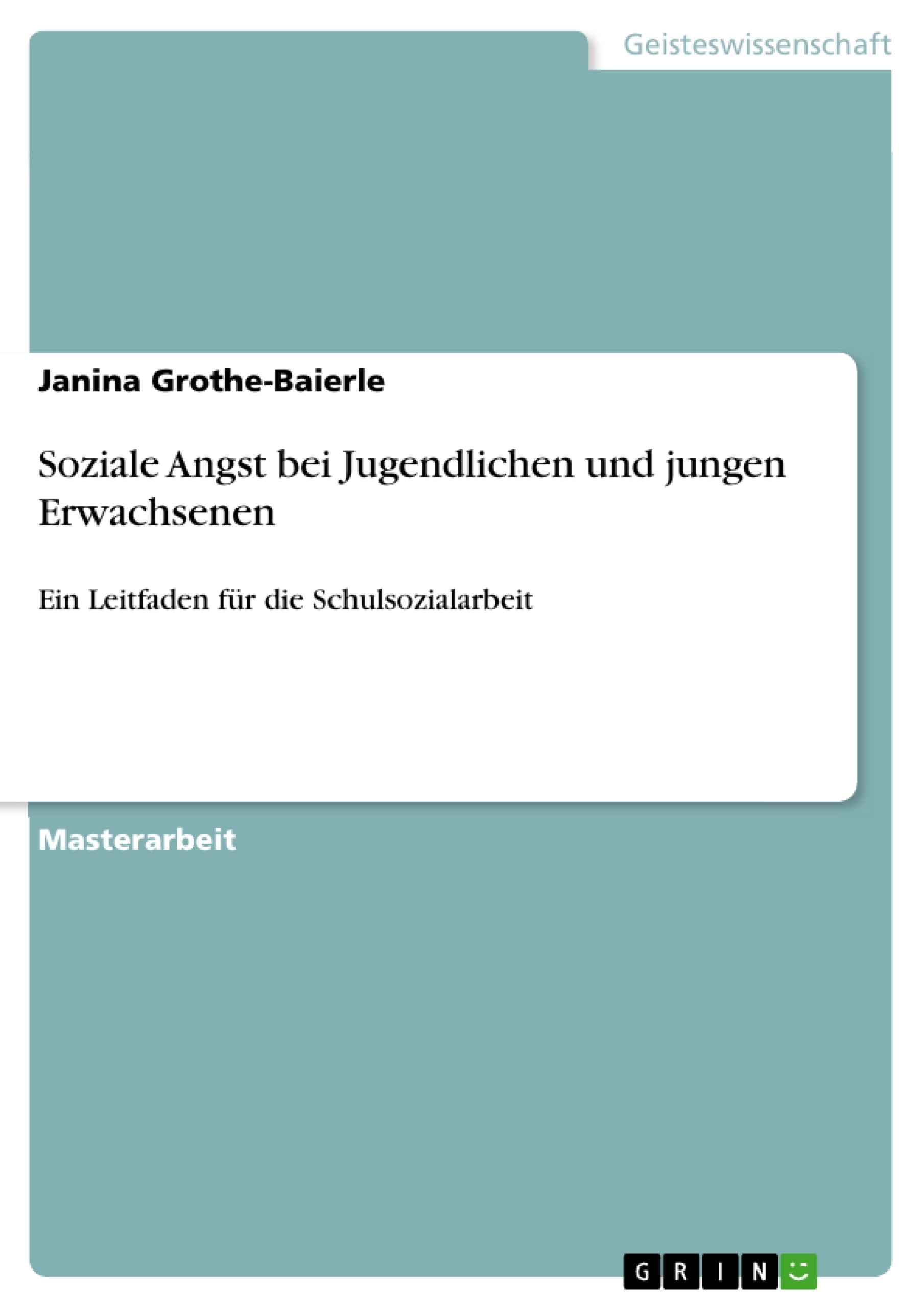„60 Augenpaare starren mich an, wenn ich an der Tafel etwas erklären muss. Das halte ich nicht aus, am liebsten würde ich abhauen.“ (Report Psychologie 15.04.2014) Bei meiner Arbeit als Schulsozialarbeiterin an einem Berufskolleg begegneten mir immer wieder Schülerinnen und Schüler, die über ähnliche Erfahrungen und Erlebnisse berichteten. Viele erlebten Unsicherheit in sozialen Situationen, hatten Angst, vor größeren Gruppen zu sprechen; Angst, nach einem Praktikumsplatz zu fragen; Angst, vor Prüfungen und teilweise auch Angst, telefonischen Kontakt mit Institutionen aufzunehmen. Diese Ängste können sich sehr belastend auf das Leben der Jugendlichen und jungen Erwachsenen auswirken und führten mitunter zu starkem Vermeidungsverhalten. Teilweise trauten sich die Betroffenen bei Krankheiten nicht, in der Schule anzurufen oder vermeiden den Schulbesuch vollständig, was sich negativ auf ihre Zukunftschancen auswirkte. Meine Beobachtungen werden durch Studien zur sozialen Phobie bestätigt. Nach Angaben von der wissenschaftliche Geschäftsführerin der Verhaltenstherapieambulanz Frankfurt Dr. Regina Steil ist die soziale Phobie „eine der häufigsten psychischen Erkrankungen im Jugend- und jungen Erwachsenenalter, wobei soziale Ängste mit einem hohen Risiko für einen vorzeitigen Schulabbruch einhergehen“ (iDW, 19.09.2012). Circa 5 bis 10% aller Jugendlichen erkranken im Laufe ihres Lebens nach Angaben des Informationsdienst Wissenschaft (iDW) an einer sozialen Phobie (ebd.).Die folgende Arbeit wird sich zunächst umfassend mit der Theorie sozialer Angst in ihren unterschiedlichen Ausprägungsformen beschäftigen, auf die Verbreitung im Jugendalter näher eingehen und dann die Zusammenhänge von sozialer Angst und Schule aufzeigen. Sie schließt mit einem umfangreichen Leitfaden für die Beratung im Rahmen der Schulsozialarbeit ab, der zunächst auf die Beratung älterer Jugendlicher und junger Erwachsener (16 bis 25 Jahre) ausgelegt ist, jedoch auch an jüngere Jugendliche durch eine „kindlichere“ Ausgestaltung angepasst werden kann. Viele der Hinweise im Beratungsleitfaden können auch in anderen Beratungsformen (Z.B. in der psychologische Beratungsstelle etc.) Anwendung finden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Besonderheiten des Jugendalters und des jungen Erwachsenenalters
- 3. Soziale Angst
- 3.1 Symptomatik und Klassifikation
- 3.1.1 Klinische Formen sozialer Angst
- 3.1.1.1 Soziale Phobie bzw. soziale Angststörung
- 3.1.1.2 Ängstliche bzw. vermeidend-selbstunsichere Persönlichkeitsstörung
- 3.1.2 Subklinische Formen sozialer Angst
- 3.1.2.1 Subklinische soziale Ängste
- 3.1.2.2 Schüchternheit
- 3.1.3 Zusammenfassung
- 3.1.1 Klinische Formen sozialer Angst
- 3.2 Epidemiologie und Komorbidität im Jugendalter und jungen Erwachsenenalter
- 3.2.1 Prävalenz
- 3.2.2 Erstmanifestation, Verlauf und Prognose
- 3.2.3 Komorbidität
- 3.2.4 Inzidenz und Persistenz
- 3.2.5 Folgen
- 3.2.6 Hilfesuchverhalten und Behandlungserfolge
- 3.2.7 Zusammenfassung und Folgerungen
- 3.3 Ätiologie
- 3.3.1 Biologische Vulnerabilitätsfaktoren
- 3.3.1.1 Heritabilität
- 3.3.1.2 Persönlichkeitseigenschaften
- 3.3.1.3 Neurobiologische Aspekte
- 3.3.2 Psychologische und familiäre Vulnerabilitätsfaktoren
- 3.3.2.1 Bindungs- und Erziehungsstil
- 3.3.2.2 Psychische Vorerkrankungen
- 3.3.3 Störungsspezifische Faktoren
- 3.3.3.1 Soziale Kompetenz
- 3.3.3.2 Sensibilität für Gesichtsausdruck und Blickkontakt
- 3.3.3.3 Kognitive Prozesse
- 3.3.3.3.1 Theoretische Grundlagen und allgemeine Befunde
- 3.3.3.3.2 Befunde aus Studien
- 3.3.4 Faktoren der individuellen Lebensbiografie, Lebensereignisse
- 3.3.5 Soziodemografische Faktoren
- 3.3.6 Zusammenfassung und Folgerungen
- 3.3.1 Biologische Vulnerabilitätsfaktoren
- 3.1 Symptomatik und Klassifikation
- 4. Soziale Angst im Zusammenhang mit dem Lebens- und Lernort Schule
- 4.1 Auswirkungen schulischer Bedingungen auf soziale Angst
- 4.2 Soziale Angst und Schulangst
- 4.3 Auswirkungen von sozialer Angst auf den Schulerfolg
- 4.4 Zusammenfassung und Folgerungen
- 5. Beratung der sozialen Angst in der Schule
- 5.1 Ausgangsbedingungen und Setting im Kontext Schule
- 5.1.1 Einbeziehung des Lehrerkollegiums
- 5.1.2 Niederschwelligkeit und Freiwilligkeit des Angebotes
- 5.2 Ein Beratungsleitfaden
- 5.2.1 Phase 1 – Schaffung günstiger Ausgangsbedingungen
- 5.2.1.1 Entwicklung einer „therapeutischen Allianz“
- 5.2.1.2 Problembezogene Informationssammlung
- 5.2.1.3 Organisatorische Aspekte
- 5.2.2 Phase 2: Aufbau von Änderungsmotivation und vorläufige Auswahl von Änderungsbereichen
- 5.2.2.1 Aufbau von Beratungsmotivation (speziell Änderungsmotivation)
- 5.2.2.2 Vorläufige Auswahl von Änderungsbereichen
- 5.2.3 Phase 3 - Verhaltensanalyse und funktionales Bedingungsmodell
- 5.2.4 Phase 4 - Vereinbaren von Beratungszielen
- 5.2.5 Phase 5 – Planung, Auswahl und Durchführung spezieller Methoden
- 5.2.5.1 Kognitive Umstrukturierung
- 5.2.5.2 Verhaltensexperimente und Verhaltensmodifikation
- 5.2.6 Phase 6 - Evaluation
- 5.2.7 Phase 7 - Endphase – Erfolgsoptimierung und Abschluss der Therapie
- 5.2.7.1 Stabilisierung und Transfer
- 5.2.7.2 Beendigen / Ausblenden der Kontakte
- 5.2.1 Phase 1 – Schaffung günstiger Ausgangsbedingungen
- 5.3 Zusammenfassung
- 5.1 Ausgangsbedingungen und Setting im Kontext Schule
- 6. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht soziale Angst bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Kontext der Schulsozialarbeit. Ziel ist es, einen Beratungsleitfaden zu entwickeln, der Schulsozialarbeitern Hilfestellung bei der Beratung von betroffenen Jugendlichen bietet. Der Fokus liegt auf der praktischen Anwendung von Interventionsmethoden.
- Symptomatik und Klassifizierung sozialer Angst
- Epidemiologie und Komorbidität im Jugendalter
- Ätiologie und Risikofaktoren sozialer Angst
- Auswirkungen sozialer Angst auf Schule und Schulerfolg
- Entwicklung eines Beratungsleitfadens für die Schulsozialarbeit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in das Thema soziale Angst bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein und beschreibt die Relevanz des Themas im Kontext der Schulsozialarbeit. Es skizziert den Aufbau der Arbeit und die Forschungsfragen, die im weiteren Verlauf beantwortet werden sollen. Die Einleitung legt den Grundstein für das Verständnis der komplexen Problematik und der Notwendigkeit eines praxisorientierten Beratungsansatzes.
2. Besonderheiten des Jugendalters und des jungen Erwachsenenalters: Dieses Kapitel beleuchtet die entwicklungspsychologischen Besonderheiten des Jugend- und jungen Erwachsenenalters, die für das Verständnis des Auftretens und des Verlaufs sozialer Angst von großer Bedeutung sind. Es werden die Herausforderungen und Veränderungen dieser Lebensphasen thematisiert, die die Entstehung und Aufrechterhaltung sozialer Ängste beeinflussen können. Der Fokus liegt auf den spezifischen Vulnerabilitäten und Ressourcen, die in diesen Entwicklungsphasen eine Rolle spielen.
3. Soziale Angst: Das zentrale Kapitel behandelt ausführlich die sozialen Angststörungen und verwandte Phänomene. Es beschreibt die Symptomatik, die verschiedenen Formen (klinisch und subklinisch), die epidemiologischen Aspekte, sowie die Ursachen (Ätiologie) von sozialer Angst. Dieses Kapitel bildet die theoretische Grundlage der Arbeit und liefert ein umfassendes Verständnis der Störung. Es integriert verschiedene Perspektiven (biologische, psychologische, soziale Faktoren) um ein ganzheitliches Bild der sozialen Angst zu vermitteln.
4. Soziale Angst im Zusammenhang mit dem Lebens- und Lernort Schule: Dieser Abschnitt untersucht den Einfluss des schulischen Kontextes auf die soziale Angst und umgekehrt. Er analysiert, wie schulische Bedingungen soziale Ängste beeinflussen können (z.B. Leistungsdruck, soziale Beziehungen) und wie soziale Ängste wiederum den Schulerfolg beeinträchtigen. Die Darstellung betont die Wechselwirkung zwischen dem individuellen Erleben und dem sozialen Umfeld der Schule.
5. Beratung der sozialen Angst in der Schule: Das Kapitel präsentiert einen detaillierten Beratungsleitfaden für Schulsozialarbeiter. Es beschreibt die Ausgangsbedingungen, den Aufbau einer therapeutischen Beziehung, die Phasen der Beratung (von der Problemdefinition bis zur Evaluation) und die Anwendung spezifischer Methoden (kognitive Umstrukturierung, Verhaltensexperimente). Dieses Kapitel ist der praktische Kern der Arbeit und bietet konkrete Handlungsanweisungen für die Praxis.
Schlüsselwörter
Soziale Angst, Jugendliche, Junge Erwachsene, Schulsozialarbeit, Beratung, Beratungsleitfaden, Ätiologie, Epidemiologie, Komorbidität, Kognitive Umstrukturierung, Verhaltensexperimente, Schulerfolg, Psychosoziale Beratung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Soziale Angst bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Kontext der Schulsozialarbeit
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet eine umfassende Übersicht über soziale Angst bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen, mit besonderem Fokus auf die Rolle der Schulsozialarbeit. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und ein Glossar mit Schlüsselbegriffen. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung eines praktischen Beratungsleitfadens für Schulsozialarbeiter.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Das Dokument behandelt folgende Themen im Detail: Die Symptomatik und Klassifizierung sozialer Angst (einschließlich klinischer und subklinischer Formen), Epidemiologie und Komorbidität im Jugendalter, die Ätiologie (Ursachen) sozialer Angst (biologische, psychologische, soziale Faktoren), die Auswirkungen sozialer Angst auf Schule und Schulerfolg, und schließlich einen detaillierten Beratungsleitfaden für die Schulsozialarbeit, inklusive konkreter Methoden wie kognitiver Umstrukturierung und Verhaltensexperimenten.
Für wen ist dieses Dokument gedacht?
Dieses Dokument richtet sich primär an Schulsozialarbeiter, die mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit sozialer Angst arbeiten. Es kann aber auch für Lehrer, Eltern, und andere Fachkräfte im Bereich der Jugendhilfe von Interesse sein, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen möchten. Die praxisorientierte Ausrichtung des Beratungsleitfadens macht es für Personen mit direktem Bezug zur Arbeit mit Jugendlichen besonders relevant.
Welche Arten von sozialer Angst werden unterschieden?
Das Dokument unterscheidet zwischen klinischen Formen der sozialen Angst (soziale Phobie bzw. soziale Angststörung, ängstliche bzw. vermeidend-selbstunsichere Persönlichkeitsstörung) und subklinischen Formen (subklinische soziale Ängste, Schüchternheit). Es wird ausführlich auf die Unterschiede und Gemeinsamkeiten eingegangen.
Wie wird die Ätiologie (Ursachen) von sozialer Angst erklärt?
Die Ätiologie sozialer Angst wird multifaktoriell betrachtet, also unter Einbezug verschiedener Einflussfaktoren: Biologische Vulnerabilitätsfaktoren (Heritabilität, Persönlichkeitseigenschaften, neurobiologische Aspekte), psychologische und familiäre Vulnerabilitätsfaktoren (Bindungsstil, Erziehungsstil, psychische Vorerkrankungen), störungsspezifische Faktoren (soziale Kompetenz, Sensibilität für Gesichtsausdruck, kognitive Prozesse), Faktoren der individuellen Lebensbiografie, soziodemografische Faktoren. Das Dokument bietet einen umfassenden Überblick über diese verschiedenen Perspektiven.
Was beinhaltet der Beratungsleitfaden für Schulsozialarbeiter?
Der Beratungsleitfaden gliedert sich in mehrere Phasen: Schaffung günstiger Ausgangsbedingungen (Aufbau einer therapeutischen Allianz, Informationssammlung), Aufbau von Änderungsmotivation, Verhaltensanalyse und funktionales Bedingungsmodell, Vereinbaren von Beratungszielen, Planung und Durchführung spezifischer Methoden (kognitive Umstrukturierung, Verhaltensexperimente), Evaluation und Abschluss der Beratung (Stabilisierung, Transfer). Der Leitfaden bietet somit eine strukturierte Anleitung für die praktische Arbeit mit betroffenen Jugendlichen.
Welche Methoden werden im Beratungsleitfaden vorgestellt?
Der Beratungsleitfaden stellt insbesondere die kognitive Umstrukturierung und Verhaltensexperimente als Interventionsmethoden vor. Diese werden detailliert beschrieben und ihre Anwendung im Kontext der Schulsozialarbeit erläutert.
Welche Auswirkungen hat soziale Angst auf den Schulerfolg?
Das Dokument analysiert die negativen Auswirkungen sozialer Angst auf den Schulerfolg. Soziale Ängste können zu Schulvermeidung, Leistungseinbußen und Schwierigkeiten im sozialen Umfeld der Schule führen. Der Zusammenhang zwischen sozialer Angst und Schulangst wird ebenfalls beleuchtet.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Soziale Angst, Jugendliche, Junge Erwachsene, Schulsozialarbeit, Beratung, Beratungsleitfaden, Ätiologie, Epidemiologie, Komorbidität, Kognitive Umstrukturierung, Verhaltensexperimente, Schulerfolg, Psychosoziale Beratung.
- Quote paper
- Janina Grothe-Baierle (Author), 2015, Soziale Angst bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/304614