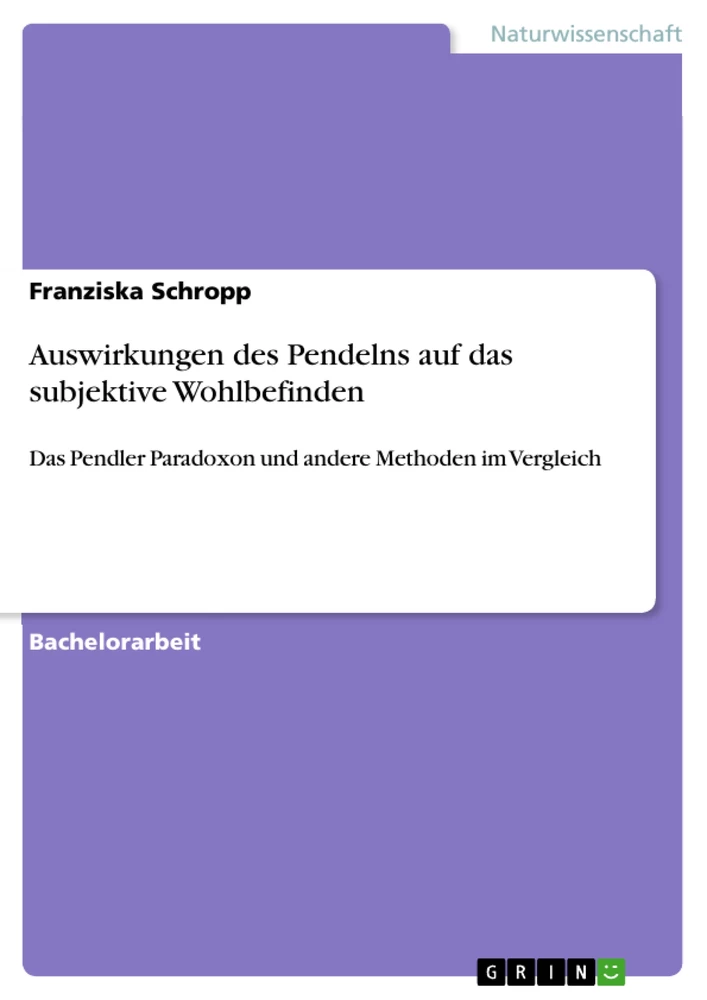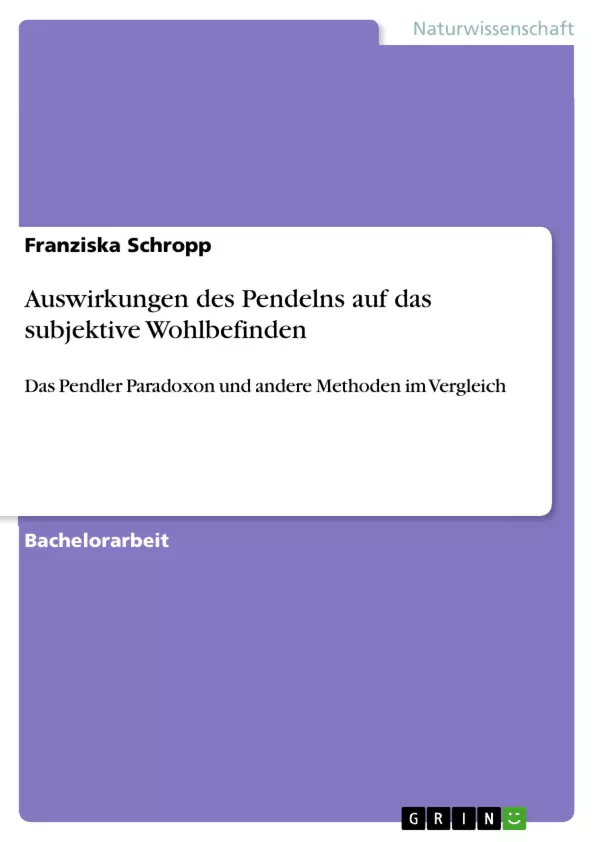Die Wissenschaftler Stutzer und Frey haben 2008 eine Veröffentlichung mit dem Titel „Stress that doesn’t pay: the Commuting Paradox“ im Scandinavian Journal of Economics publiziert. In diesem Paper wird die Hypothese aufgestellt, dass ein rational denkendes Individuum nur dann die Bürde des Pendelns auf sich nimmt, wenn es in entsprechender Form dafür entschädigt wird. In den Daten aus Deutschland haben die
Autoren jedoch einen negativen Zusammenhang zwischen der Pendeldauer und der berichteten Zufriedenheit mit dem Leben festgestellt. Diese Beobachtung widerspricht der klassischen Gleichgewichtsannahme: die Individuen nehmen also das Pendeln auf sich ohne dafür in ausreichender Weise entschädigt zu werden. Diesen Zustand definieren Stutzer und Frey als das „Pendler Paradoxon“.
Im Weiteren sollen zwei weitere Paper analysiert und diskutiert werden. „It’s driving her mad: Gender differences in the effects of commuting on psychological health“ (2011) von Roberts, Hodgson und Dolan untersucht den Zusammenhang zwischen
Pendeln und der psychologischen Gesundheit anhand von Daten aus Großbritannien. Die Methodik einer Fixed Effects Analyse ähnelt dem Vorgehen der Autoren von 2008, jedoch wird eine andere interessante Beobachtung in ihren Daten gemacht und diskutiert: Während Frauen im Durchschnitt weniger pendeln als Männer wird ihre psychologische Gesundheit davon negativ beeinflusst – die der Männern jedoch nicht. Das im letzten Jahr veröffentlichte Paper „Does active commuting improve psychological wellbeing?“ von Martin, Goryakin und Suhrcke untersucht, ob der
Zusammenhang zwischen dem Wohlbefinden und der Pendeldauer durch die Wahl des Reisemodus (Pendeln per Auto, Zug, Fahrrad etc.) beeinflusst wird. Das aktuellste
Paper baut seine Methode parallel zu Roberts et al. auf und vergleicht sich oft mit Diesem. [...]
Inhaltsverzeichnis
- VORWORT
- DIE GRUNDLAGEN VERSTEHEN
- Die Glücksforschung
- Das Pendeln
- Physische und psychische Bürde
- Mit dem Pendeln verbundener Nutzen
- ,,STRESS THAT DOESN'T PAY: THE COMMUTING PARADOX\" (2008) VON FREY BRUNO S. UND STUTZER ALOIS
- Das gemeinsame Forschungsgebiet der Autoren
- Das Pendler Paradoxon: die zentrale Forschungsfrage
- Empirische Analyse: der Effekt von Pendeln auf das subjektive Wohlbefinden
- Daten und deskriptive Statistik
- Strategie für den empirischen Test
- Pooled Modell
- Fixed Effects Modell
- Berücksichtigung der Variablen Pendelstrecke und Transportmittel
- Kalkulation der fehlenden Entschädigung für das Pendeln
- Erklärungen für das Vorliegen des Paradoxons
- Ist eine vollständige Kompensation auf Haushaltsebene gegeben?
- Gibt es eine vollständige Kompensation in bestimmten Lebensbereichen?
- Fehlt eine vollständige Kompensation aufgrund von Friktionen auf dem Markt?
- Resümee der Forschungsarbeit von Frey und Stutzer
- ,,IT'S DRIVING HER MAD: GENDER DIFFERENCES IN THE EFFECTS OF COMMUTING ON PSYCHOLOGICAL HEALTH“ (2011) VON ROBERTS, HODGSON UND DOLAN
- Daten und Variablenauswahl
- Ökonometrische Methode
- Ergebnisse
- Unterschied zwischen den Geschlechtern
- Tests auf Robustheit der Ergebnisse
- Test auf mögliche Effekte auf Haushaltsebene
- Resümee der Forschungsarbeit von Robert et al.
- Vergleich zu Frey und Stutzer (2008) und mögliche Erklärungen für das erstaunliche Resultat
- ,,DOES ACTIVE COMMUTING IMPROVE PSYCHOLOGICAL WELLBEING?“ (2014) VON MARTIN, GORYAKIN UND SUHRCKE
- Daten und Variablenauswahl
- Ökonometrische Methode
- Ergebnisse
- Resümee der Forschungsarbeit und Limitation der Ergebnisse
- VERGLEICH DER STUDIEN VON FREY/STUTZER, ROBERTS ET AL. UND MARTIN ET AL.
- KRITISCHE WÜRDIGUNG DER ERGEBNISSE UND AUSBLICK
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Einfluss des Pendelns auf das subjektive Wohlbefinden. Sie untersucht das so genannte „Pendler-Paradoxon", das besagt, dass Pendeln zwar mit negativen Auswirkungen auf die Lebenszufriedenheit verbunden ist, aber dennoch nicht zu einem höheren Gehalt führt. Die Arbeit vergleicht verschiedene Studien, die sich mit diesem Thema beschäftigen, und analysiert die unterschiedlichen Ergebnisse.
- Der Einfluss von Pendeln auf das subjektive Wohlbefinden
- Das Pendler-Paradoxon und seine Erklärungen
- Die Rolle von Geschlecht und Transportmittel
- Die Berücksichtigung von Haushaltseffekten
- Kritische Würdigung der Forschungsbefunde
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit fest und beleuchtet die Glücksforschung sowie die Auswirkungen des Pendelns auf das subjektive Wohlbefinden. Das zweite Kapitel analysiert die Studie von Frey und Stutzer (2008), die das Pendler-Paradoxon untersucht. Das dritte Kapitel befasst sich mit der Studie von Roberts, Hodgson und Dolan (2011), die sich mit den geschlechtsspezifischen Unterschieden in den Auswirkungen des Pendelns auf die psychische Gesundheit auseinandersetzt. Das vierte Kapitel behandelt die Studie von Martin, Goryakin und Suhrcke (2014), die den Einfluss von aktiven Pendelformen auf das psychische Wohlbefinden untersucht. Abschließend werden die Ergebnisse der verschiedenen Studien verglichen und kritisch gewürdigt.
Schlüsselwörter
Pendeln, Pendler-Paradoxon, subjektives Wohlbefinden, Lebenszufriedenheit, psychische Gesundheit, Geschlecht, Transportmittel, Haushaltseffekte, empirische Forschung, ökonometrische Methoden.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das "Pendler-Paradoxon"?
Es beschreibt die Beobachtung von Stutzer und Frey, dass Menschen lange Pendelzeiten auf sich nehmen, ohne durch ein höheres Gehalt oder bessere Lebensqualität ausreichend dafür entschädigt zu werden.
Gibt es Geschlechterunterschiede beim Pendeln?
Ja, die Studie von Roberts et al. zeigt, dass Frauen psychisch stärker negativ vom Pendeln beeinflusst werden als Männer, obwohl sie im Durchschnitt kürzer pendeln.
Verbessert aktives Pendeln das Wohlbefinden?
Die Studie von Martin et al. (2014) untersucht, ob Pendeln mit dem Fahrrad oder zu Fuß im Vergleich zum Auto das psychische Wohlbefinden steigern kann.
Wie wird subjektives Wohlbefinden in diesen Studien gemessen?
Meist werden Daten aus großen Panel-Befragungen genutzt, in denen die Teilnehmer ihre Lebenszufriedenheit oder psychische Gesundheit selbst bewerten.
Warum nehmen Menschen das Pendeln trotz negativer Effekte auf sich?
Mögliche Erklärungen sind Marktriktionen, falsche Erwartungen an den Nutzen des Pendelns oder eine Kompensation auf Haushaltsebene.
Welche ökonometrischen Modelle werden in der Forschung verwendet?
Häufig kommen Fixed Effects Modelle zum Einsatz, um individuelle, zeitkonstante Faktoren herauszufiltern und den reinen Effekt der Pendeldauer zu messen.
- Quote paper
- Franziska Schropp (Author), 2015, Auswirkungen des Pendelns auf das subjektive Wohlbefinden, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/304618