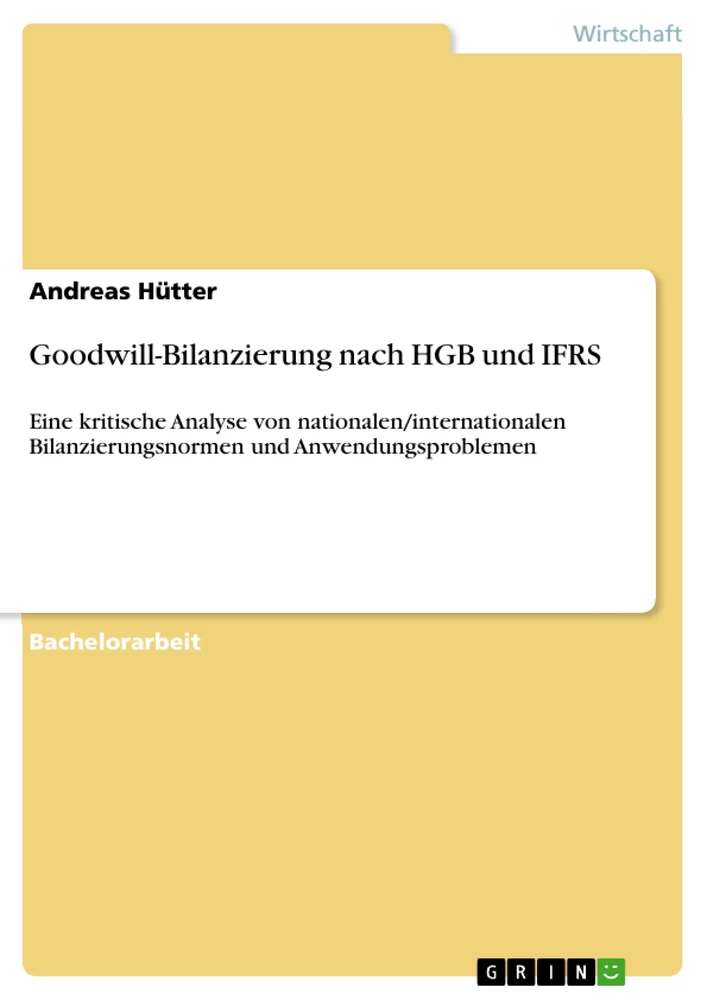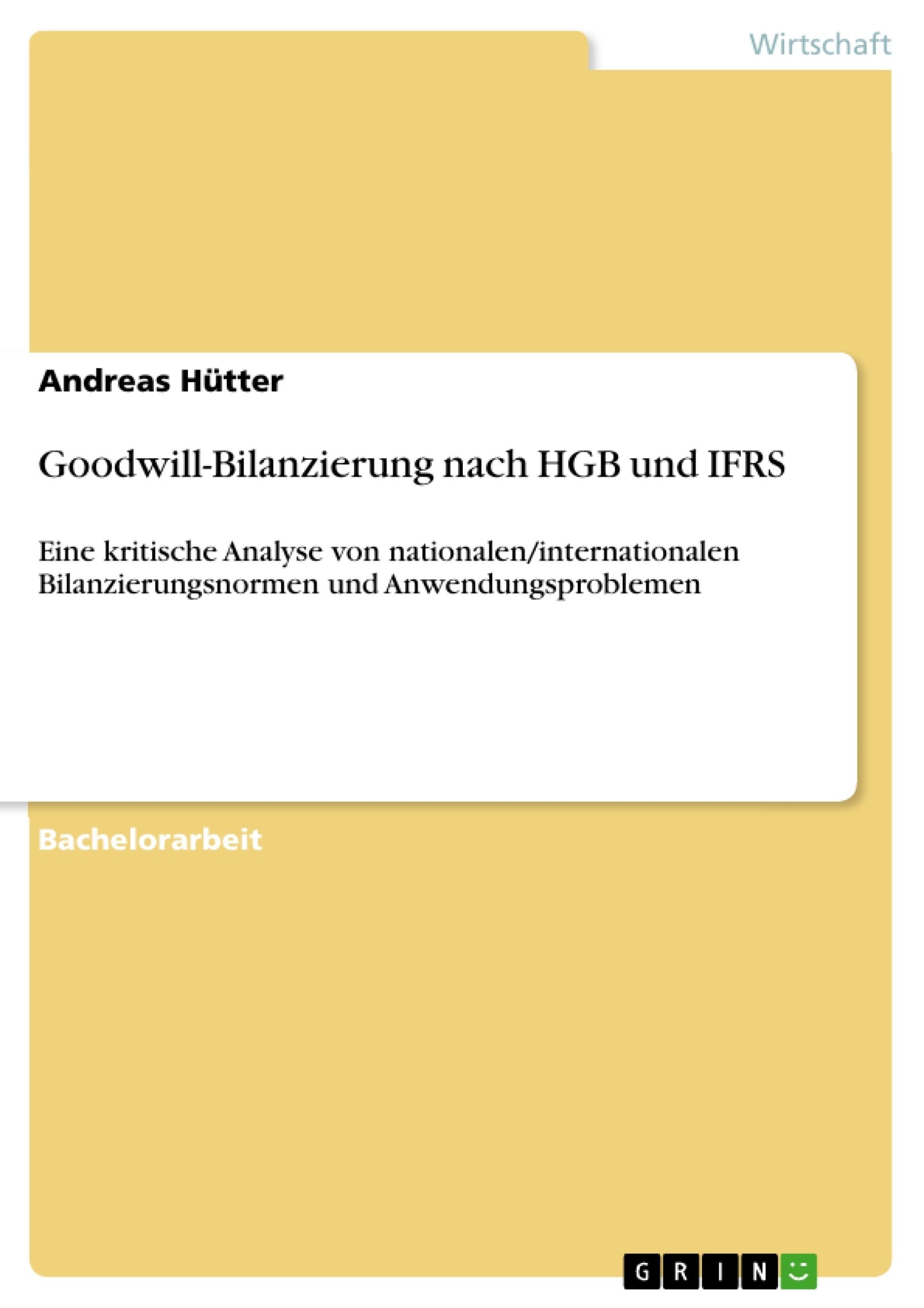„Der Bilanzposten, der derzeit die größte Gefahr für das Vermögen der Aktionäre an ihrem Unternehmen in sich birgt, heißt Goodwill, im Deutschen auch Firmenwert genannt.“ Diese Schlagzeile eines renommierten Wirtschaftsmagazins kann stellvertretend für das aktuelle Pressebild der Rechnungslegung angesehen werden. Dabei wird weiter ausgeführt: „Nach den aktuellen Bilanzierungsregeln lässt sich ohne Übertreiben von einer Goodwill-Blase sprechen, die stetig wächst.“ Um die Brisanz zu verstärken wird darin eine Parallele zu vergangenen Börsenblase geschaffen, um die aktuelle Dringlichkeit zu verdeutlichen.
Demgegenüber entwickelt sich eine rechtliche Aktualität immer auf Grundlage von Veränderungen durch Reformen, die Neuerungen und Streitfragen mit sich bringen. Hierbei gilt die Goodwill-Bilanzierung nach nationalen und internationalen Recht wohl als Präzedenzfall, für eine stetige und umfassende Neugestaltungen, die mit diametralen Meinungen einhergeht. Denn insbesondere in den letzten Jahren hat die bilanzielle Behandlung des Goodwill in der nationalen und internationalen Rechnungslegung eine grundlegende Änderung erfahren.
Die vorliegende Ausarbeitung verfolgt das Ziel, die Goodwill-Bilanzierung nach den nationalen und internationalen Bilanzierungsnormen darzustellen und dabei stets kritisch zu hinterfragen. Darüber hinaus sollen auf potenzielle Anwendungsprobleme in diesem Kontext eingegangen werden.
Die Untersuchung ist dabei insgesamt in vier Kapitel strukturiert. Im Anschluss zu diesem Kapitel soll, um dem Leser die speziellen bilanzrechtlichen Überlegungen darstellen zu können, zunächst die betriebswirtschaftlich relevante Grundlagen über den Goodwill als Basis vermittelt werden. Hierin wird erläutert was unter dem Begriff Goodwill zu verstehen ist, woraus er sich abgeleitet hat und wie er i.S. dieser Ausarbeitung definiert werden soll. Daneben werden die verschiedenen Arten des
Goodwill erörtert und kategorisiert, welches für das bilanzielle Verständnis von immenser Bedeutung ist. Darüber hinaus sollen innerhalb des Grundlagenteils die möglichen Ansätze einer Aufteilung des Goodwill in seine Komponenten betrachtet, und die Bedeutung des Goodwill in der Rechnungslegungspraxis verdeutlicht werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitender Teil
- 1.1 Aktuelle Bezugnahme und Problemstellung
- 1.2 Zielsetzung und Abgrenzung der Thematik
- 1.3 Betriebswirtschaftlich relevante Grundlagen zum Goodwill
- 1.3.1 Begriff des Goodwill
- 1.3.2 Arten des Goodwill
- 1.3.2.1 Überblick
- 1.3.2.2 Originärer und derivativer Goodwill
- 1.3.2.3 Positiver und negativer Goodwill
- 1.3.2.4 Konsolidierungs- und Nicht-Konsolidierungs-Goodwill
- 1.3.2.5 Minderheiten-Goodwill und Mehrheiten-Goodwill
- 1.3.3 Komponenten eines Goodwill
- 1.3.4 Bedeutung des Goodwill
- 2 Bilanzierung des Geschäfts- oder Firmenwerts im Einzel- und Konzernabschluss nach dem HGB
- 2.1 Erstmalige Bilanzierung des Geschäfts- oder Firmenwerts
- 2.1.1 Entstehung und Ansatz im Einzelabschluss
- 2.1.2 Entstehung und Ansatz im Konzernabschluss
- 2.1.3 Anwendungsprobleme bei der Ermittlung des Geschäfts- oder Firmenwerts
- 2.1.4 Bilanzieller Charakter als Vermögensgegenstand
- 2.2 Folgebilanzierung des Geschäfts- oder Firmenwerts
- 2.2.1 Vorbemerkung
- 2.2.2 Planmäßige Abschreibung
- 2.2.2.1 Rechtliche Ausgangssituation
- 2.2.2.2 Bestimmung der Nutzungsdauer
- 2.2.2.3 Typisierung der Nutzungsdauer durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG)
- 2.2.3 Außerplanmäßige Abschreibung
- 2.2.3.1 Rechtliche Ausgangssituation
- 2.2.3.2 Zeitpunkt des Werthaltigkeitstest
- 2.2.3.3 Ermittlung des beizulegenden Werts
- 2.2.4 Wertaufholung
- 2.3 Der negative Geschäfts- oder Firmenwert
- 2.3.1 Einzelabschluss
- 2.3.2 Konzernabschluss
- 2.4 Ausweis und Anhangangaben
- 3 Bilanzierung des Goodwill nach den IFRS
- 3.1 Vorbemerkung
- 3.2 Erstmalige Bilanzierung des Goodwill
- 3.2.1 Entstehung und Ansatz
- 3.2.2 Bewertung der nicht beherrschenden Anteile
- 3.2.2.1 Überblick
- 3.2.2.2 Partial-Goodwill-Methode
- 3.2.2.3 Full-Goodwill-Methode
- 3.2.2.4 Bilanzielle Auswirkungen
- 3.2.3 Bilanzieller Charakter als Vermögenswert
- 3.2.4 Goodwill-Allokation
- 3.2.4.1 Aufteilung des Goodwill auf zahlungsmittelgenerierende Einheiten
- 3.2.4.2 Auswirkungen auf die Folgebilanzierung
- 3.2 Folgebilanzierung des Goodwill
- 3.2.1 Vorbemerkung
- 3.2.2 Impairment-Only-Approach
- 3.2.2.1 Grundkonzeption beim Goodwill
- 3.2.2.2 Ermittlung des erzielbarer Betrags
- 3.2.2.2.1 Nutzungswert als erzielbarer Betrag
- 3.2.2.2.1.1 Vorbemerkung
- 3.2.2.2.1.2 Schätzung der künftigen Cashflows
- 3.2.2.2.1.3 Bestimmung des Diskontierungszinssatz
- 3.2.2.2.2 Nettoveräußerungswert als erzielbarer Betrag
- 3.2.2.2.3 Synopse der Wertkategorien des erzielbaren Betrags
- 3.2.2.3 Ermittlung des Buchwerts
- 3.2.2.4 Verteilung eines etwaigen Wertminderungsbedarfs
- 3.2.2.5 Wertaufholung
- 3.3 Der negative Goodwill
- 3.4 Ausweis und Anhangangaben
- Goodwill-Definition und -Arten
- Bilanzierung von Goodwill nach HGB
- Bilanzierung von Goodwill nach IFRS
- Vergleich der Bilanzierungsmethoden nach HGB und IFRS
- Anwendungsprobleme bei der Goodwill-Bilanzierung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit analysiert kritisch die Bilanzierung von Goodwill nach den nationalen (HGB) und internationalen (IFRS) Rechnungslegungsstandards. Die Arbeit untersucht die Unterschiede in der erstmaligen und Folgebilanzierung sowie die damit verbundenen Anwendungsprobleme.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitender Teil: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Goodwill-Bilanzierung ein, beschreibt die aktuelle Relevanz und Problemstellung und definiert die Zielsetzung der Arbeit. Es werden grundlegende betriebswirtschaftliche Aspekte des Goodwill, wie seine Definition, Arten (originär, derivativ, positiv, negativ, Konsolidierungs- und Nicht-Konsolidierungs-Goodwill, Minderheiten- und Mehrheiten-Goodwill) und Komponenten, sowie seine Bedeutung im Kontext der Unternehmensbewertung erläutert. Der einleitende Teil dient als Grundlage für die nachfolgende detaillierte Analyse der Bilanzierungsvorschriften nach HGB und IFRS.
2 Bilanzierung des Geschäfts- oder Firmenwerts im Einzel- und Konzernabschluss nach dem HGB: Dieses Kapitel befasst sich ausführlich mit der Bilanzierung des Goodwill nach den Regeln des Handelsgesetzbuches (HGB). Es werden sowohl die erstmalige Bilanzierung (Entstehung und Ansatz im Einzel- und Konzernabschluss, Anwendungsprobleme bei der Ermittlung und der bilanziellen Charakter als Vermögensgegenstand) als auch die Folgebilanzierung (planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen, Wertaufholung) im Detail behandelt. Besonderes Augenmerk liegt auf den rechtlichen Grundlagen und den praktischen Herausforderungen bei der Anwendung der Vorschriften. Der Umgang mit negativem Geschäfts- oder Firmenwert wird ebenso beleuchtet wie der Ausweis und die notwendigen Anhangangaben. Die Kapitelteile vertiefen die komplexen Aspekte der Goodwill-Bilanzierung nach HGB und stellen deren praktische Relevanz heraus.
3 Bilanzierung des Goodwill nach den IFRS: Dieses Kapitel widmet sich der Bilanzierung von Goodwill gemäß den International Financial Reporting Standards (IFRS). Ähnlich wie Kapitel 2 werden die erstmalige Bilanzierung (Entstehung und Ansatz, Bewertung der nicht beherrschenden Anteile mit Erläuterung der Partial- und Full-Goodwill-Methode, bilanzielle Auswirkungen und der Charakter als Vermögenswert) und die Folgebilanzierung (Impairment-Only-Approach, Ermittlung des erzielbaren Betrags unter Berücksichtigung des Nutzungswerts und des Nettoveräußerungswerts, Ermittlung des Buchwerts, Verteilung des Wertminderungsbedarfs und Wertaufholung) detailliert analysiert. Das Kapitel vergleicht die IFRS-Vorschriften mit den HGB-Regelungen und hebt die jeweiligen Unterschiede und Gemeinsamkeiten hervor. Der Umgang mit negativem Goodwill und die notwendigen Anhangangaben runden das Kapitel ab, welches die komplexe Materie der IFRS-konformen Goodwill-Bilanzierung umfassend darstellt.
Schlüsselwörter
Goodwill, Bilanzierung, HGB, IFRS, Geschäftswert, Firmenwert, erstmalige Bilanzierung, Folgebilanzierung, planmäßige Abschreibung, außerplanmäßige Abschreibung, Wertaufholung, Impairment-Test, Konzernabschluss, Einzelabschluss, Anwendungsprobleme, Bewertung, Minderheitenanteil, Partial-Goodwill-Methode, Full-Goodwill-Methode
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Bilanzierung von Goodwill nach HGB und IFRS
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit analysiert kritisch die Bilanzierung von Goodwill nach den nationalen (HGB) und internationalen (IFRS) Rechnungslegungsstandards. Im Fokus stehen die Unterschiede in der erstmaligen und Folgebilanzierung sowie die damit verbundenen Anwendungsprobleme.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Definition und Arten von Goodwill, Bilanzierung von Goodwill nach HGB (inkl. Erst- und Folgebilanzierung, planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen, Wertaufholung und negativem Goodwill), Bilanzierung von Goodwill nach IFRS (inkl. Erst- und Folgebilanzierung, Impairment-Test, Partial- und Full-Goodwill-Methode und negativem Goodwill), Vergleich der Bilanzierungsmethoden nach HGB und IFRS sowie die jeweiligen Anwendungsprobleme.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in drei Hauptkapitel: Ein einleitender Teil, der die Thematik, die Zielsetzung und betriebswirtschaftliche Grundlagen zum Goodwill erläutert; ein Kapitel zur Bilanzierung nach HGB mit detaillierter Betrachtung der Erst- und Folgebilanzierung, inklusive des Umgangs mit negativem Goodwill; und ein Kapitel zur Bilanzierung nach IFRS, ebenfalls mit detaillierter Darstellung der Erst- und Folgebilanzierung, inkl. Impairment-Test und dem Vergleich mit den HGB-Regelungen. Jedes Kapitel beinhaltet eine Zusammenfassung der behandelten Aspekte.
Was sind die wichtigsten Unterschiede zwischen der Goodwill-Bilanzierung nach HGB und IFRS?
Die Arbeit vergleicht die Bilanzierungsmethoden nach HGB und IFRS und hebt die jeweiligen Unterschiede und Gemeinsamkeiten hervor. Konkrete Unterschiede betreffen u.a. die Methoden der Erst- und Folgebewertung, die Behandlung von negativem Goodwill und die Anforderungen an die Anhangangaben. Die detaillierte Analyse dieser Unterschiede ist ein zentraler Bestandteil der Arbeit.
Welche Anwendungsprobleme bei der Goodwill-Bilanzierung werden behandelt?
Die Arbeit untersucht verschiedene Anwendungsprobleme bei der Ermittlung und Bilanzierung von Goodwill, sowohl nach HGB als auch nach IFRS. Dies umfasst beispielsweise Probleme bei der Bestimmung der Nutzungsdauer für die planmäßige Abschreibung, die Ermittlung des erzielbaren Betrags im Impairment-Test nach IFRS, und die Bewertung der nicht beherrschenden Anteile bei der Konsolidierung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Goodwill, Bilanzierung, HGB, IFRS, Geschäftswert, Firmenwert, erstmalige Bilanzierung, Folgebilanzierung, planmäßige Abschreibung, außerplanmäßige Abschreibung, Wertaufholung, Impairment-Test, Konzernabschluss, Einzelabschluss, Anwendungsprobleme, Bewertung, Minderheitenanteil, Partial-Goodwill-Methode, Full-Goodwill-Methode.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Studierende der Betriebswirtschaftslehre, insbesondere im Bereich Rechnungswesen und Controlling, sowie für Wirtschaftsprüfer und alle, die sich mit der Bilanzierung von Unternehmen und der Unternehmensbewertung auseinandersetzen.
- Quote paper
- Andreas Hütter (Author), 2015, Goodwill-Bilanzierung nach HGB und IFRS, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/305302