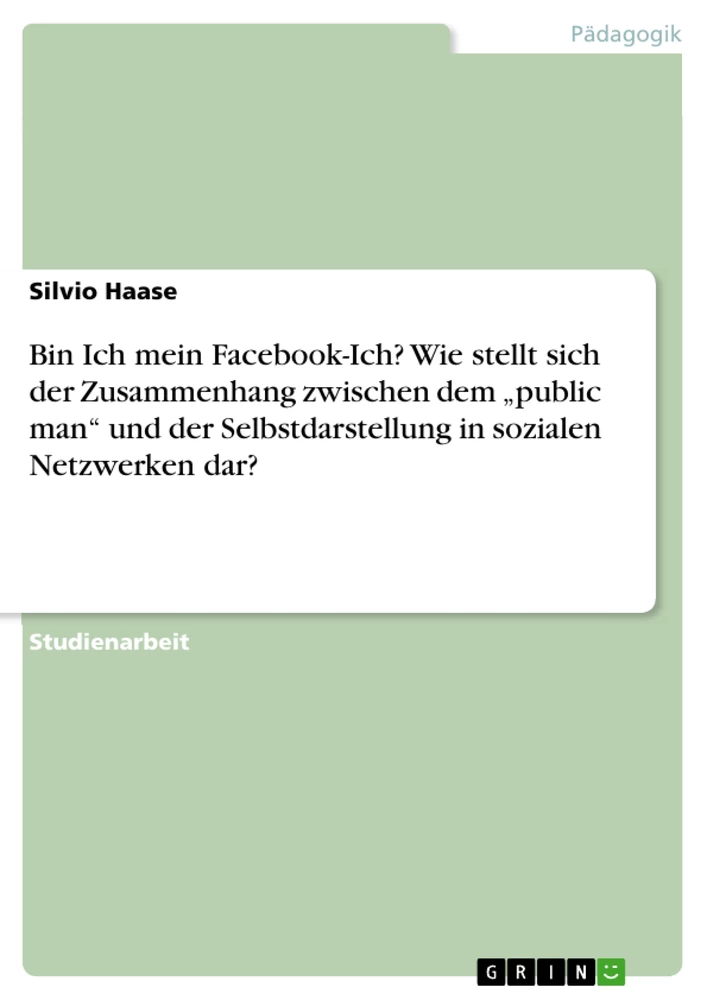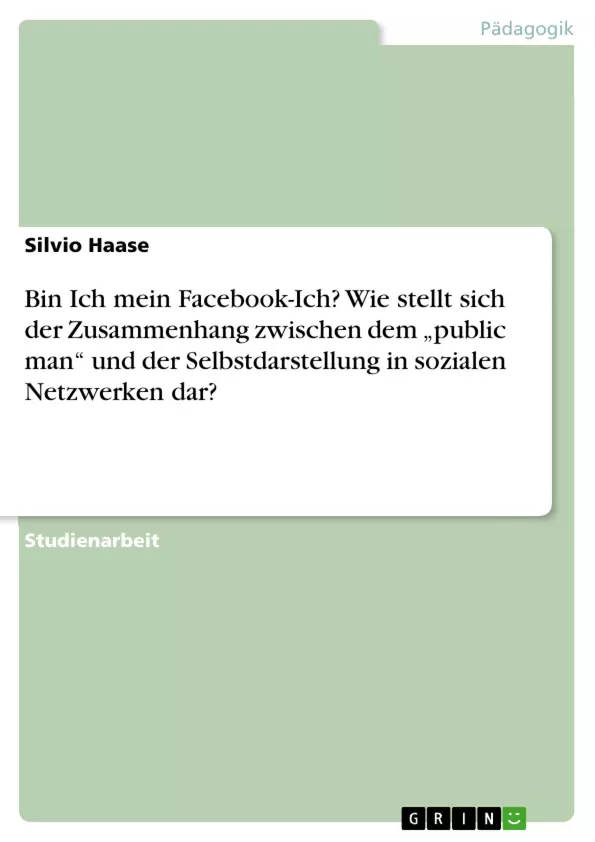Soziale Medien, hier vor allem Facebook zu nennen, sind in der heutigen nicht mehr von der Gesellschaft zu trennen. Weltweit hatte Facebook im Quartal vier des letzten Jahres 1,228 Milliarden Nutzer.
Verglichen mit der Anzahl der auf der Erde lebenden Menschen, derzeit rund 7,3 Milliarden , nutzen also in etwa 17 Prozent der Weltbevölkerung Facebook. Setzt man diesen Gedanken fort, stellen sich eine Reihe von Fragen.
Klar ist, dass, abgesehen von einigen Privatsphäreeinstellungen, alle Profile für jedermann zugänglich sind.
Somit ist jede Person, die ein Profil bei Facebook besitzt, der Öffentlichkeit zugänglich, sie steht im öffentlichen Raum des sozialen Netzwerks.
Es ist, folgt man den Gedanken des Buchtitels, also durchaus im Rahmen des Möglichen, dass eine Selbstinszenierung stattfindet.
Folgt man der Theorie von Richard Sennett über den Fall des „public man“, so müsste ein Rückzug in die Privatheit im öffentlichen Raum erkennbar sein.
Im Folgenden soll also betrachtet werden, ob der „public man“ im sozialen Netzwerk Facebook eine Renaissance erlebt oder ob eine Inszenierung der Persönlichkeit durch die Nutzer vollzogen wird.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Der Niedergang des „public man“
- Die Facebook-Nutzer
- Selbstdarstellung auf Facebook
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die vorliegende Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen dem "public man" und der Selbstdarstellung in sozialen Netzwerken, insbesondere auf Facebook. Sie analysiert, ob sich die Theorie von Richard Sennett über den Fall des "public man" auf den digitalen Raum übertragen lässt und welche Auswirkungen die Selbstdarstellung in sozialen Netzwerken auf das Konzept der Privatheit hat.
- Der Niedergang des "public man" nach Richard Sennett
- Die Nutzung von Facebook durch verschiedene Altersgruppen
- Selbstdarstellung als Mittel der Kommunikation und Interaktion in sozialen Netzwerken
- Die Rolle von Fotos und Videos in der Selbstdarstellung auf Facebook
- Das Verhältnis von Authentizität und Selbstinszenierung in sozialen Netzwerken
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der digitalen Selbstdarstellung im Kontext des "public man" ein und stellt die Relevanz von Facebook in der heutigen Gesellschaft heraus. Sie benennt die zentrale Forschungsfrage: Erfährt der "public man" in sozialen Netzwerken eine Renaissance, oder findet eine Inszenierung der Persönlichkeit durch die Nutzer statt?
- Der Niedergang des "public man": Dieses Kapitel beschreibt Richard Sennetts Theorie über den Wandel der Beziehung zwischen Privatheit und Öffentlichkeit. Es werden historische Beispiele angeführt, die den Wandel der öffentlichen Selbstdarstellung beleuchten. Sennetts Theorie dient als theoretischer Rahmen für die Analyse der Selbstdarstellung in sozialen Netzwerken.
- Die Facebook-Nutzer: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die Nutzerstatistik von Facebook und beleuchtet die Art und Weise, wie Facebook von verschiedenen Altersgruppen genutzt wird. Die Analyse konzentriert sich auf die Nutzungshäufigkeit und die bevorzugten Funktionen des Netzwerks.
- Selbstdarstellung auf Facebook: Dieses Kapitel analysiert anhand einer qualitativen Studie aus dem Jahr 2013 die Selbstdarstellung von Jugendlichen auf Facebook. Es wird untersucht, wie Fotos als Mittel der Selbstdarstellung eingesetzt werden und wie die Nutzer mit den Themen Echtheit und Selbstinszenierung umgehen.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit fokussiert sich auf die Themen "public man", Selbstdarstellung, soziale Netzwerke, Facebook, Privatheit, Authentizität, Selbstinszenierung und digitale Kommunikation. Die Arbeit analysiert, wie sich die Theorie des "public man" auf die Selbstdarstellung in sozialen Netzwerken auswirkt und wie die Nutzer mit dem Spannungsfeld zwischen Echtheit und Inszenierung umgehen.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Richard Sennett unter dem Niedergang des „public man“?
Sennett beschreibt damit einen historischen Wandel, bei dem sich Menschen aus dem öffentlichen Raum in die Privatheit zurückziehen und die öffentliche Selbstdarstellung an Bedeutung verliert oder sich verändert.
Erlebt der „public man“ auf Facebook eine Renaissance?
Die Arbeit untersucht, ob die ständige Sichtbarkeit in sozialen Netzwerken eine Rückkehr des öffentlichen Menschen bedeutet oder ob es sich lediglich um eine bewusste Inszenierung der Persönlichkeit handelt.
Wie nutzen Jugendliche Facebook zur Selbstdarstellung?
Jugendliche nutzen vor allem Fotos und Videos als Kommunikationsmittel. Dabei schwankt die Darstellung oft zwischen dem Wunsch nach Authentizität (Echtheit) und einer gezielten Selbstinszenierung.
Welche Rolle spielt die Privatheit in sozialen Netzwerken?
Da Profile oft für viele Menschen zugänglich sind, verschwimmen die Grenzen zwischen privatem und öffentlichem Raum. Nutzer stehen permanent in einem digitalen öffentlichen Raum.
Gibt es Unterschiede in der Facebook-Nutzung zwischen Altersgruppen?
Ja, die Arbeit beleuchtet die Nutzungshäufigkeit und bevorzugte Funktionen verschiedener Altersgruppen, wobei die Art der Selbstdarstellung variiert.
- Citation du texte
- Silvio Haase (Auteur), 2014, Bin Ich mein Facebook-Ich? Wie stellt sich der Zusammenhang zwischen dem „public man“ und der Selbstdarstellung in sozialen Netzwerken dar?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/306016