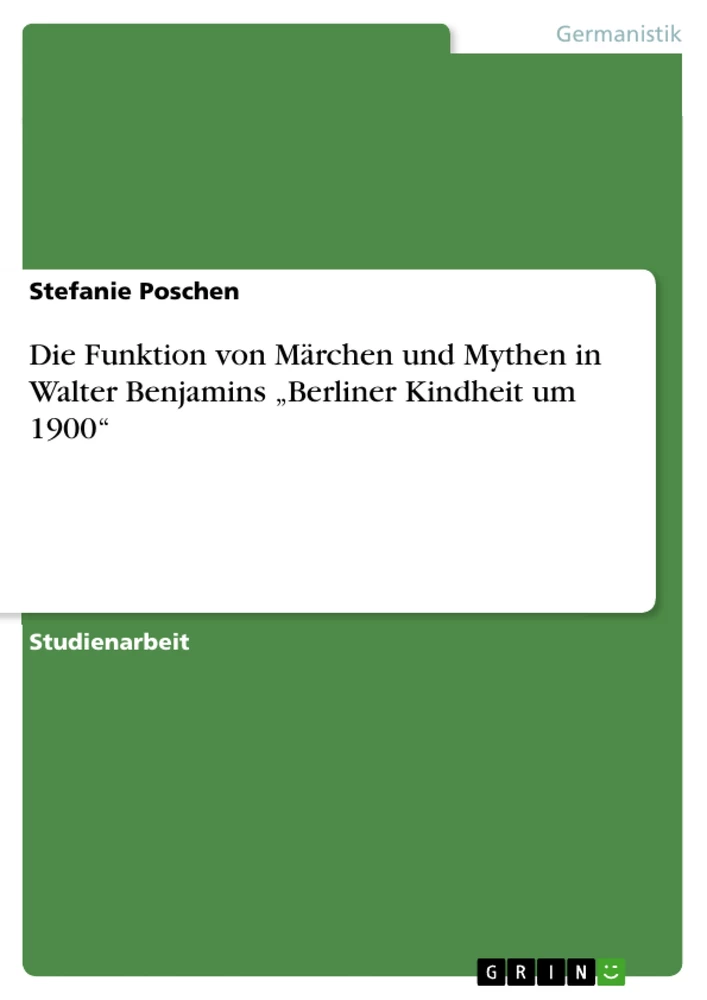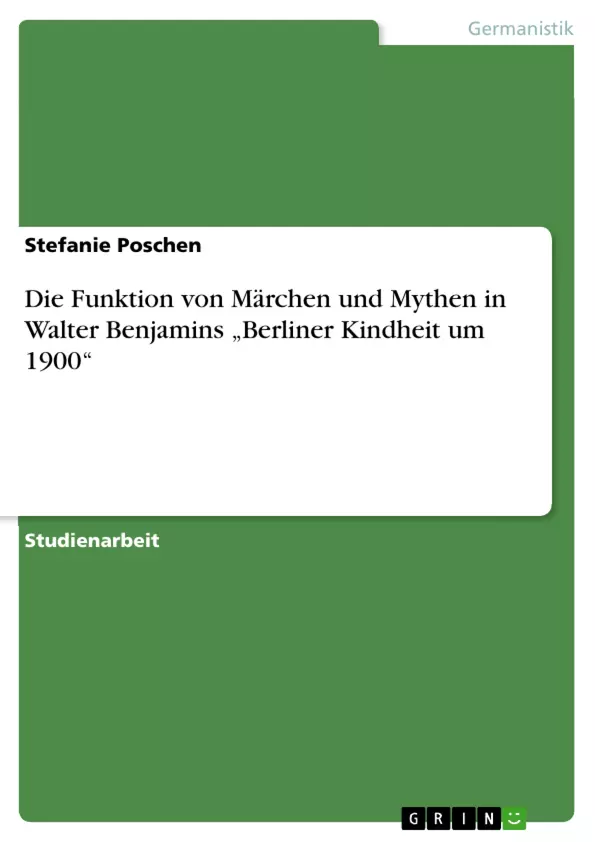Märchen und Mythen scheinen eng mit den Kindheitserinnerungen verbunden zu sein und auch für das Erinnern eine wichtige Rolle zu spielen. Kaum ein Kind wächst ohne „Grimms Märchen“ oder mythologische Geschichten auf. Die Phantasie eines Kindes ist nahezu unbegrenzt, sodass es nicht verwunderlich ist, dass gerade diese Art von Erzählungen bei Kindern so beliebt ist.
Gegenstand der Untersuchung dieser Ausarbeitung soll Walter Benjamins Erzählung „Berliner Kindheit um 1900“ sein, die aus mehreren Erinnerungstexten aus der Kindheit besteht.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Zu Autor und Werk
- Über Walter Benjamin
- Zur Entstehungsgeschichte
- Mythologische Elemente
- Mythen in „Berliner Kindheit um 1900“
- Das Labyrinth und das Motiv des sich Verirrens
- Das Telefon
- Die Siegessäule
- Die Betrachtung der märchenhaften Elemente
- Märchen in „Berliner Kindheit um 1900“
- Die Funktion von Märchen
- „Der Nähkasten“
- Fazit mit Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Ausarbeitung analysiert die Funktion von Märchen und Mythen in Walter Benjamins „Berliner Kindheit um 1900“ und untersucht deren Einfluss auf die kindliche Erinnerungsperspektive.
- Intertextuelle Verweise auf Märchen und Mythen als Mittel der Charakterisierung und Interpretation.
- Bedeutung von Mythen und Märchen für die Verknüpfung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in den Erzählungen.
- Funktion von mythologischen und märchenhaften Elementen als Spiegelbild der kindlichen Wahrnehmung und Traumwelt.
- Verbindung von Realität und Phantasie durch die Verschmelzung von Märchenfiguren mit realen Personen.
- Analyse der Rolle von Mythen und Märchen in der Erinnerungskonstruktion des Autors.
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung führt in die Thematik der märchenhaften und mythologischen Elemente in Benjamins „Berliner Kindheit um 1900“ ein und erläutert die Zielsetzung der Arbeit.
Das Kapitel „Zu Autor und Werk“ gibt einen Überblick über Walter Benjamins Leben und Werk und beleuchtet die Entstehungsgeschichte der Erzählung „Berliner Kindheit um 1900“.
Das Kapitel „Mythologische Elemente“ widmet sich verschiedenen Textfragmenten der Erzählung, die Verweise auf die griechische Mythologie aufweisen. Der Fokus liegt auf den Motiven des Labyrinths, des Telefons und der Siegessäule und deren Bedeutung für die Interpretation der Erzählung.
Das Kapitel „Die Betrachtung der märchenhaften Elemente“ untersucht die intertextuellen Verweise auf Grimms Märchen in „Berliner Kindheit um 1900“. Das Textfragment „Der Nähkasten“ wird genauer analysiert, um die Funktion von Märchen in der Erzählung zu beleuchten.
Im Fazit werden die Untersuchungsergebnisse zusammengefasst und ein Ausblick auf weitere Forschungsaspekte gegeben.
Schlüsselwörter (Keywords)
Walter Benjamin, „Berliner Kindheit um 1900“, Märchen, Mythen, Intertextualität, Erinnerung, Kindheit, Phantasie, Realität, Mythos des Kaiserreiches, griechische Mythologie, Grimms Märchen.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielen Märchen in Walter Benjamins "Berliner Kindheit um 1900"?
Märchen dienen als Mittel der Erinnerungskonstruktion. Benjamin verknüpft kindliche Phantasie mit realen Erlebnissen, um die Welt seiner Kindheit poetisch zu rekonstruieren.
Welche mythologischen Motive nutzt Benjamin in seinen Texten?
Zentrale Motive sind das Labyrinth (als Bild für die Stadt Berlin), die Siegessäule und Verweise auf die griechische Mythologie, die das Alltägliche überhöhen.
Was symbolisiert das Labyrinth in Benjamins Werk?
Es steht für das "Sich-Verirren" in der Großstadt und die Suche nach der eigenen Identität in der Vielfalt der Sinneseindrücke der Kindheit.
Wie wird das Telefon in der Erzählung mythologisch gedeutet?
Das Telefon wird als eine Art geheimnisvolles Orakel oder unheimliches Wesen dargestellt, das die gewohnte häusliche Ordnung durch Stimmen aus der Ferne aufbricht.
Was ist die Funktion des Fragments "Der Nähkasten"?
Hier werden intertextuelle Bezüge zu Grimms Märchen deutlich, wobei alltägliche Gegenstände eine magische Bedeutung erhalten und die Grenze zwischen Realität und Traum verwischen.
- Arbeit zitieren
- Stefanie Poschen (Autor:in), 2015, Die Funktion von Märchen und Mythen in Walter Benjamins „Berliner Kindheit um 1900“, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/306076