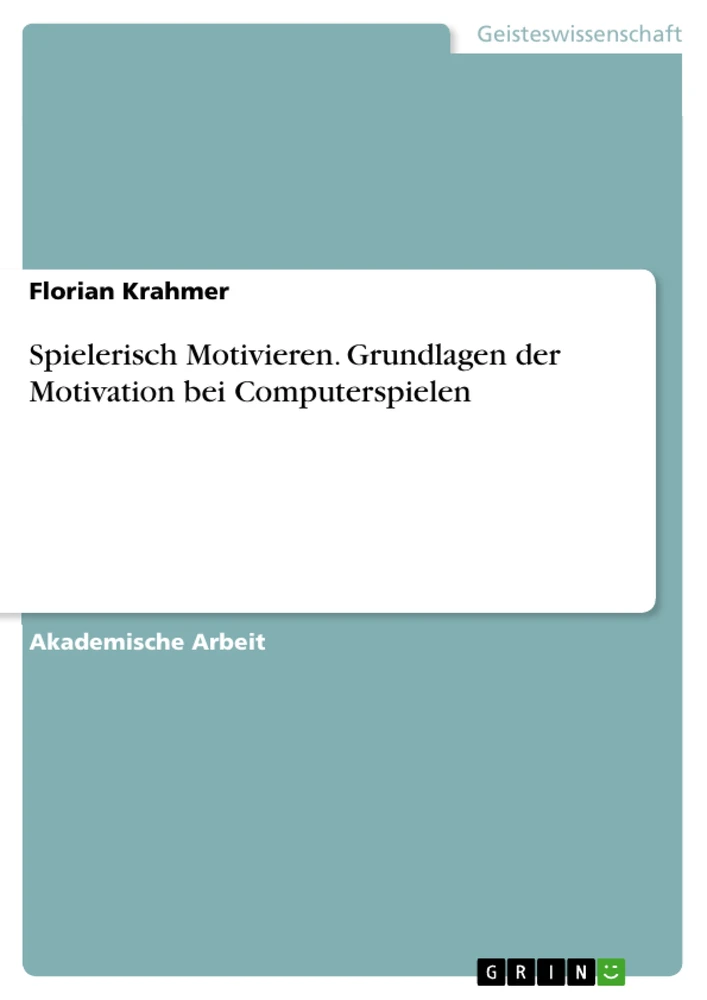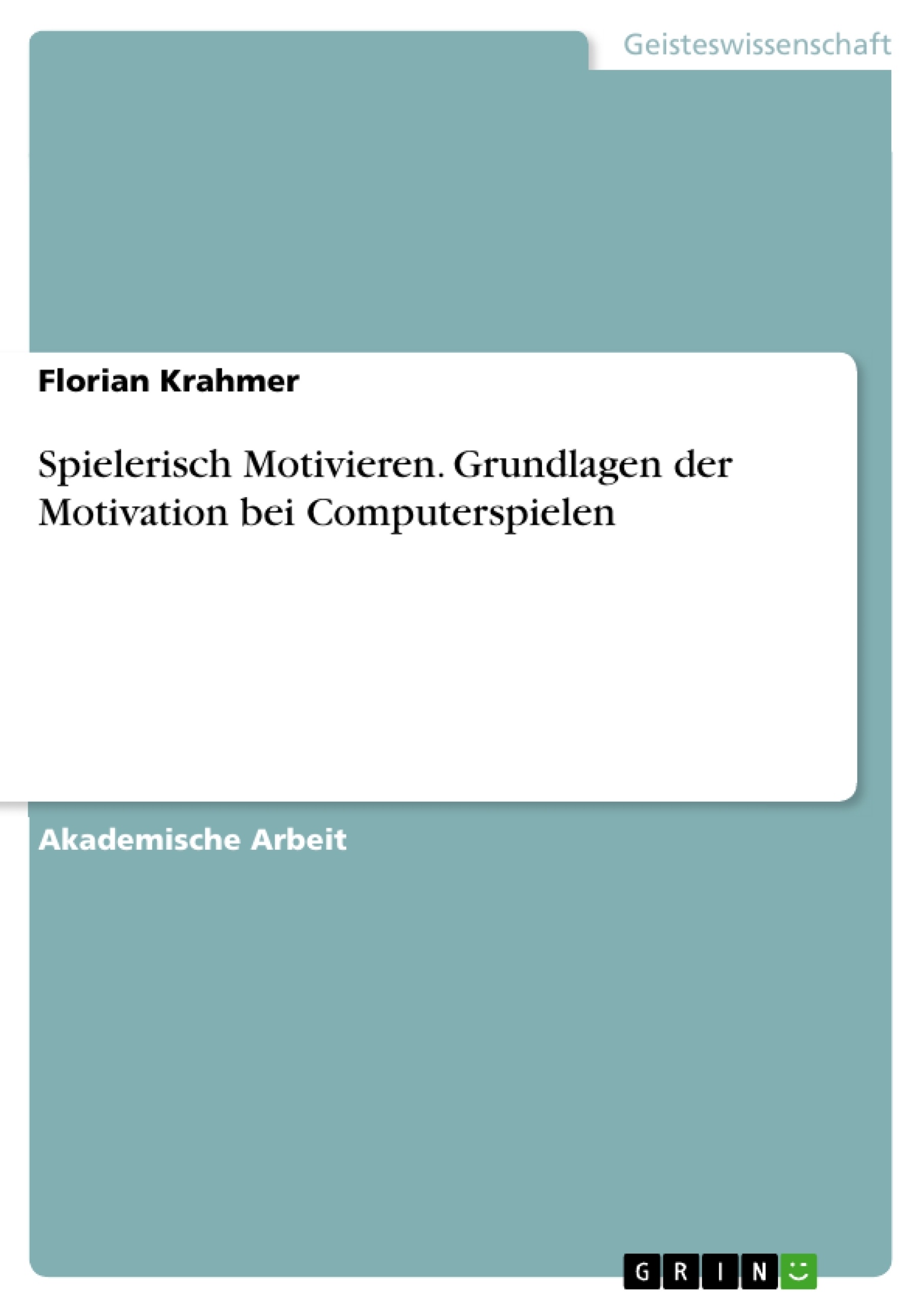In der nachfolgenden Arbeit wird auf die Motivation, den Spieldynamiken und auf grundlegende Spielelemente eingegangen. Kenntnisse in der Motivation sind dabei grundlegende Voraussetzungen, um diese über Spiele fördern zu können.
Alltagspsychologisch erscheint der Begriff der Motivation als eine Antriebsgröße, welche mal größer und mal kleiner ausfallen kann. In diesem Sinn ist jemand mal stärker, mal schwächer motiviert. Allerdings greift die Beschreibung der Motivation als Antriebsgröße zu kurz, vielmehr ergibt sich die Motivation aus dem Zusammenwirken von unterschiedlichen Prozessen. Dabei spielen kognitive Prozesse wie die Bildung von Erwartungen oder der Entwurf von Handlungsplänen ebenso eine Rolle wie affektive Erlebnistönungen des gegenwärtigen Zustands wie Hoffnung oder Furcht, physiologische Prozesse wie die Ausschüttung von Neurohormonen sowie basale Handlungstendenzen. Die Begriffsbestimmungen von Motivation können demnach unterschiedlich ausfallen, je nachdem welche der genannten Prozesse im Vordergrund stehen (Rheinberg, 2009).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ablauf der Arbeit
- Grundlagen
- Motivation
- Einleitende Begriffsbestimmung
- Motivationstheorie nach Heckhausen
- Intrinsische und extrinsische Motivation
- Spieldynamiken
- Spielmotivation nach Yee
- Flow-Theorie
- Grundlegende Spielelemente
- Belohnung als Anreiz
- Wertigkeit von Belohnungen
- Overjustification
- Motivation
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, wie Motivation über Spiele gefördert werden kann. Dabei werden zunächst die grundlegenden Konzepte der Motivation, einschließlich der Motivationstheorie nach Heckhausen und der Unterscheidung zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation, erörtert. Des Weiteren werden Spieldynamiken untersucht, einschließlich der Spielmotivation nach Yee und der Flow-Theorie. Abschließend werden grundlegende Spielelemente, wie Belohnung als Anreiz, deren Wertigkeit und das Problem der Overjustification, analysiert.
- Motivationstheorie nach Heckhausen und deren Anwendung im Kontext von Spielen
- Spieldynamiken und deren Einfluss auf die Motivation
- Analyse verschiedener Spielelemente und deren Bedeutung für die Motivationssteigerung
- Zusammenhänge zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation im Gaming-Kontext
- Overjustification und Korruptionseffekte im Rahmen der Spielmotivation
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage der Arbeit dar und skizziert den Aufbau der Arbeit. Es wird dargelegt, dass die Arbeit sich zunächst mit den Grundlagen der Motivation beschäftigt, um anschließend Spieldynamiken und grundlegende Spielelemente zu analysieren.
Grundlagen
Dieses Kapitel widmet sich der Definition und theoretischen Einordnung von Motivation. Die Motivationstheorie nach Heckhausen wird erläutert, wobei die Unterscheidung zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation im Fokus steht. Zusätzlich werden die Spieldynamiken behandelt, einschließlich der Spielmotivation nach Yee und der Flow-Theorie.
Spieldynamiken
Das Kapitel beleuchtet die Spieldynamiken und deren Auswirkungen auf die Motivation. Die Einteilung von Spielertypen nach Bartle und die Spielmotivation nach Yee werden behandelt. Außerdem wird auf die Flow-Theorie eingegangen.
Grundlegende Spielelemente
Dieses Kapitel behandelt grundlegende Spielelemente und deren Bedeutung für die Motivation. Die Belohnung als Anreiz und deren Wertigkeit werden diskutiert, ebenso wie das Problem der Overjustification und der Korruptionseffekt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die folgenden Themen: Motivation, Motivationstheorie, Spielmotivation, Spieldynamiken, Flow, Belohnung, Overjustification, intrinsische Motivation, extrinsische Motivation, Spieltypen, Spielertypen.
Häufig gestellte Fragen zur Motivation bei Computerspielen
Wie wird Motivation im Kontext von Spielen definiert?
Motivation ist keine reine Antriebsgröße, sondern ein Zusammenspiel aus kognitiven Erwartungen, emotionalen Zuständen (wie Hoffnung oder Furcht) und physiologischen Prozessen.
Was ist der Unterschied zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation?
Intrinsische Motivation kommt aus dem Spielspaß selbst heraus, während extrinsische Motivation durch äußere Anreize wie Belohnungen, Punkte oder Trophäen entsteht.
Was besagt die Flow-Theorie bei Videospielen?
Die Flow-Theorie beschreibt einen Zustand völliger Vertiefung und optimaler Beanspruchung, bei dem der Spieler Zeit und Umgebung vergisst, weil die Herausforderung genau seinen Fähigkeiten entspricht.
Was versteht man unter dem „Overjustification Effect“?
Dies ist ein Korruptionseffekt, bei dem eine ursprünglich intrinsisch motivierte Tätigkeit durch zu viele äußere Belohnungen an Reiz verliert, sobald die Belohnungen wegfallen.
Welche Spielertypen gibt es nach Bartle und Yee?
Diese Modelle klassifizieren Spieler basierend auf ihren Motivationen, wie z.B. dem Streben nach Leistung, sozialen Interaktionen oder dem Entdecken der Spielwelt.
- Quote paper
- Florian Krahmer (Author), 2014, Spielerisch Motivieren. Grundlagen der Motivation bei Computerspielen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/306551