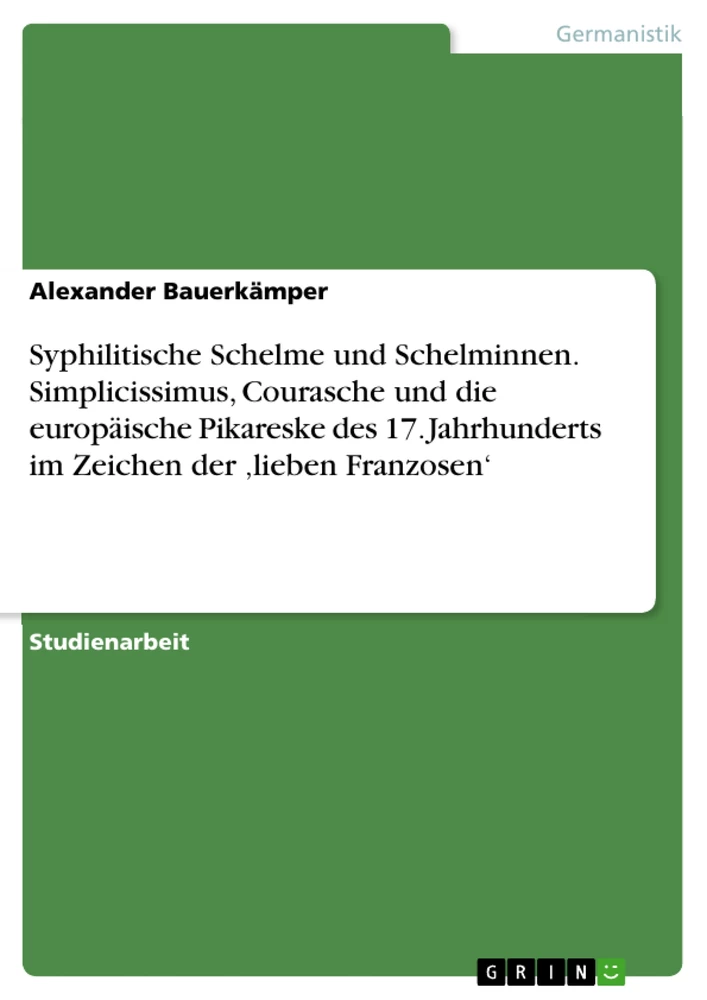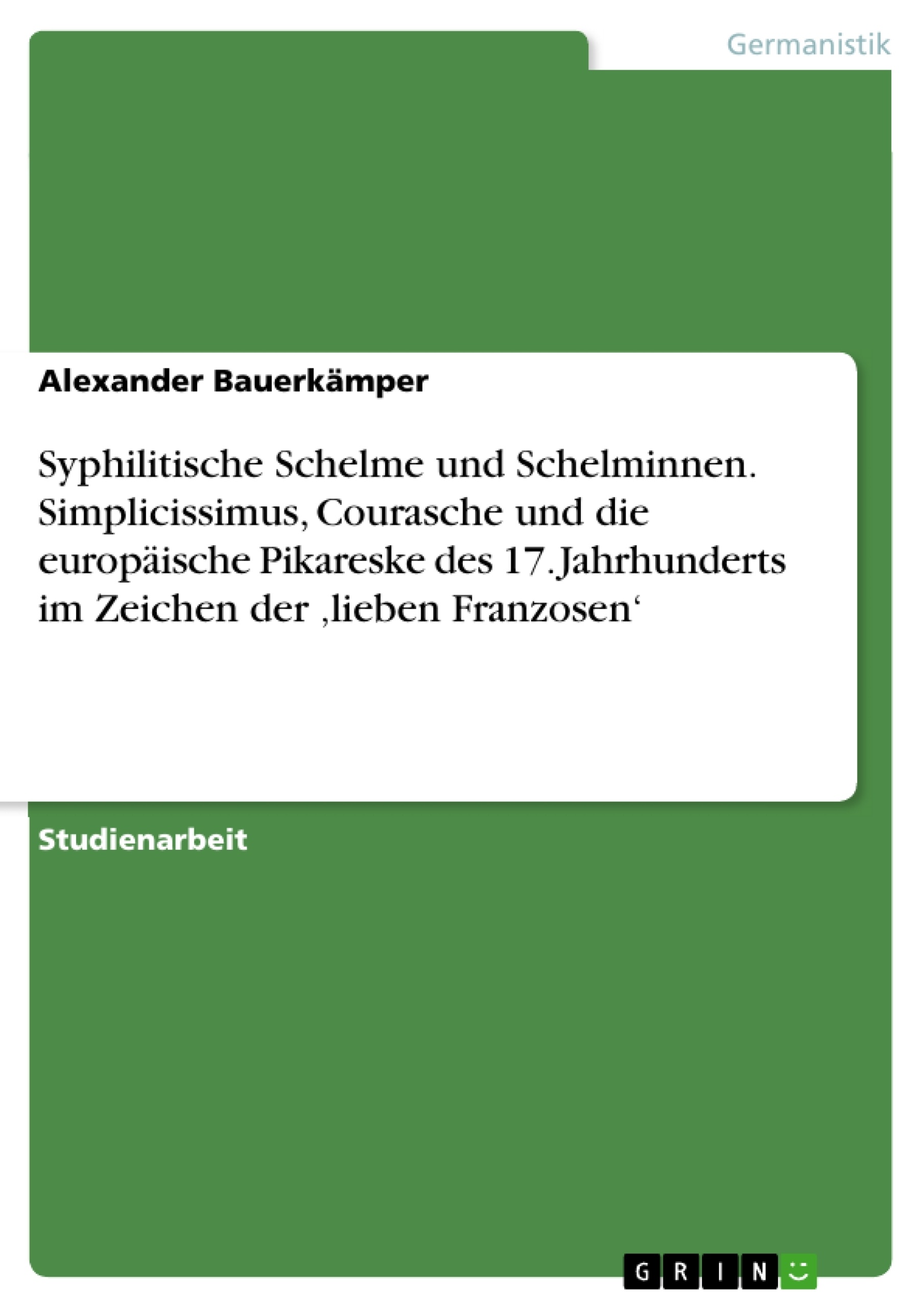Krankheit ist und war, ob in Gestalt siecher Körper oder Geister, ein grundlegendes Thema der Literaturen aller Epochen. Die Syphilis spielt dabei als literarisches Motiv eine außerordentliche Rolle, wie Anja Schonlau in Syphilis in der Literatur herausarbeitet: „Die pathologischen Eigenschaften der Syphilis und deren kulturelle Deutungen machen die Geschlechtskrankheit zum Schmelztiegel verschiedener Diskurse über Ästhetik, Moral, Genie und Medizin“ (SCHONLAU 2005: Klappentext), und zwar in einer Art und Weise wie keine andere Krankheit.
Die philologische Forschung über das Zusammenspiel von Syphilis und Literatur konzentrierte sich bisher meist auf die Renaissance oder die Moderne. Dabei wurde das 17. Jahrhundert zwar nicht ausgespart. Eine eingehende Vertiefung fand jedoch noch nicht statt, obwohl auch in zahlreichen barocken Schriften der Syphilis Platz eingeräumt wird. In diesem Sinne will die vorliegende Arbeit Vorschläge einer tiefergehenden Behandlung der literarischen Verarbeitung der Syphilis-Thematik im 17. Jahrhundert wagen. Ganz speziell wollen wir dabei Beispiele der europäischen Pikareske dieses Jahrhunderts betrachten, denn:
Die Veränderung der Sexualmoral [Anfang des 17. Jahrhunderts] macht venerische Infektionen zur Schande und ihre Träger zu Sündern. So erfolgt die Poetisierung der Syphilis zwar weiterhin gemäß der klassischen Ästhetik in komischen und polemischen Satireformen, aber erheblich seltener als im 16. Jahrhundert. Einschlägig bleibt für die Syphilis das Umfeld des pikaresken Romans. (SCHONLAU 2005: 66)
Hans Jacob Christoffel von Grimmelshausen schuf mit seinem Pikaro Simplicissimus und der Pikara Courasche zwei der gewichtigsten Figuren des europäischen Schelmenromans überhaupt. Ziel unseres Beitrags soll sein, herauszuarbeiten, wo und wie sich der Simplicissimus Teutsch und die Courasche (bzw. Trutz Simplex) in Bezug auf ihre literarische Verarbeitung der Syphilis im Kontext anderer europäischer Schelmenromane verorten lassen. Denn wird auch der Syphilis in all diesen Romanen zunächst nur Platz als „Nebenmotiv in komischer Funktion“ (SCHONLAU 2005: 60) zugestanden, so müssen wir uns dennoch fragen, weshalb gerade die Syphilis in der barocken pikaresken Welt immer wieder auftaucht und weshalb Grimmelshausen seinen beiden Protagonist_innen die Krankheit auf den Hals jagt .
Es geht also um die Frage nach den Unterschieden und Gemeinsamkeiten in Darstellung und Symbolik der Syphilis-Thematik der einzelnen Romane.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Pathologie und (Literatur-)Geschichte der Lues venerea
- Was ist Syphilis?
- Etymologie und Werdegang einer,genuin literarischen Krankheit‘
- Forschungsstand und gesellschaftlicher Diskurs im 17. Jahrhundert
- Zum Stellenwert der Syphilis im spanischen und französischen Schelmenroman des 17. Jahrhunderts
- Francisco López de Úbeda: La pícara Justina (1605)
- Charles Sorel: Histoire comique de Francion (1623)
- Francisco de Quevedo: Historia de la vida del Buscón (1626)
- Grimmelshausens Schriften und die Syphilis
- Simplicius Simplicissimus, Syphiliticus (1668)
- Courasche oder Trutz Simplex (1670)
- Vergleichende Zusammenfassung
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der literarischen Verarbeitung der Syphilis-Thematik im 17. Jahrhundert, insbesondere im Kontext des europäischen Schelmenromans. Sie untersucht, wie die Syphilis in den Werken Grimmelshausens, Simplicissimus und Courasche, im Vergleich zu anderen Schelmenromanen der Epoche dargestellt wird. Die Arbeit analysiert die Symbolik der Syphilis und ihre Funktion als "Nebenmotiv in komischer Funktion".
- Die Darstellung der Syphilis in der europäischen Pikareske des 17. Jahrhunderts
- Die literarische Verarbeitung der Syphilis bei Grimmelshausen
- Der Vergleich der Syphilis-Thematik in Simplicissimus und Courasche mit anderen Schelmenromanen
- Die Rolle der Syphilis als "Nebenmotiv in komischer Funktion"
- Die Bedeutung der Syphilis im Kontext der zeitgenössischen Sexualmoral und der Geschlechterrollen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und erläutert den Stellenwert der Syphilis in der Literatur des 17. Jahrhunderts. Das zweite Kapitel befasst sich mit der Pathologie und der (Literatur-)Geschichte der Lues venerea. Es beleuchtet die verschiedenen Bezeichnungen der Krankheit, den Forschungsstand und den gesellschaftlichen Diskurs im 17. Jahrhundert. Das dritte Kapitel analysiert die Bedeutung der Syphilis im spanischen und französischen Schelmenroman des 17. Jahrhunderts anhand von Beispielen wie La pícara Justina, Histoire comique de Francion und Historia de la vida del Buscón. Das vierte Kapitel widmet sich Grimmelshausens Schriften und der Syphilis, insbesondere Simplicissimus und Courasche. Die Arbeit untersucht, wie die Syphilis in diesen Romanen dargestellt wird und welche Funktion sie im Kontext der Figuren und des Handlungsverlaufs spielt. Das fünfte Kapitel bietet eine vergleichende Zusammenfassung der Ergebnisse und beleuchtet die Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Darstellung und Symbolik der Syphilis-Thematik der einzelnen Romane. Die Schlussbemerkung fasst die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammen und gibt einen Ausblick auf weitere Forschungsfragen.
Schlüsselwörter
Syphilis, Lues venerea, Schelmenroman, Pikareske, Grimmelshausen, Simplicissimus, Courasche, europäische Literatur, 17. Jahrhundert, Sexualmoral, Geschlechterrollen, Krankheit, Literatur, Geschichte, Kultur, Gesellschaft, Symbol, Motiv, Darstellung, Vergleich, Analyse.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt die Syphilis im Schelmenroman des 17. Jahrhunderts?
Die Syphilis dient oft als komisches Nebenmotiv, symbolisiert aber auch moralischen Verfall und die Schande venöser Infektionen in der Barockzeit.
Wie verarbeitet Grimmelshausen das Thema Syphilis?
Er lässt seine Protagonisten Simplicissimus und Courasche an Syphilis erkranken, um gesellschaftliche Diskurse über Ästhetik und Moral zu spiegeln.
Was ist eine 'pikareske' Figur?
Ein Pikaro (oder eine Pikara) ist ein Schelm oder Außenseiter, der sich durch eine feindliche Welt schlägt, oft in satirischer oder polemischer Form.
Warum wird die Syphilis als 'genuin literarische Krankheit' bezeichnet?
Weil ihre pathologischen Eigenschaften und kulturellen Deutungen sie zum Schmelztiegel für Diskurse über Genie, Medizin und Sünde machten.
Welche spanischen Werke werden zum Vergleich herangezogen?
Untersucht werden unter anderem 'La pícara Justina' von López de Úbeda und 'El Buscón' von Francisco de Quevedo.
Wie änderte sich die Sexualmoral zu Beginn des 17. Jahrhunderts?
Infektionen wurden zunehmend als Schande und Zeichen für Sündhaftigkeit gewertet, was die Darstellung der Krankheit in der Literatur beeinflusste.
- Quote paper
- Alexander Bauerkämper (Author), 2010, Syphilitische Schelme und Schelminnen. Simplicissimus, Courasche und die europäische Pikareske des 17. Jahrhunderts im Zeichen der ‚lieben Franzosen‘, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/306692