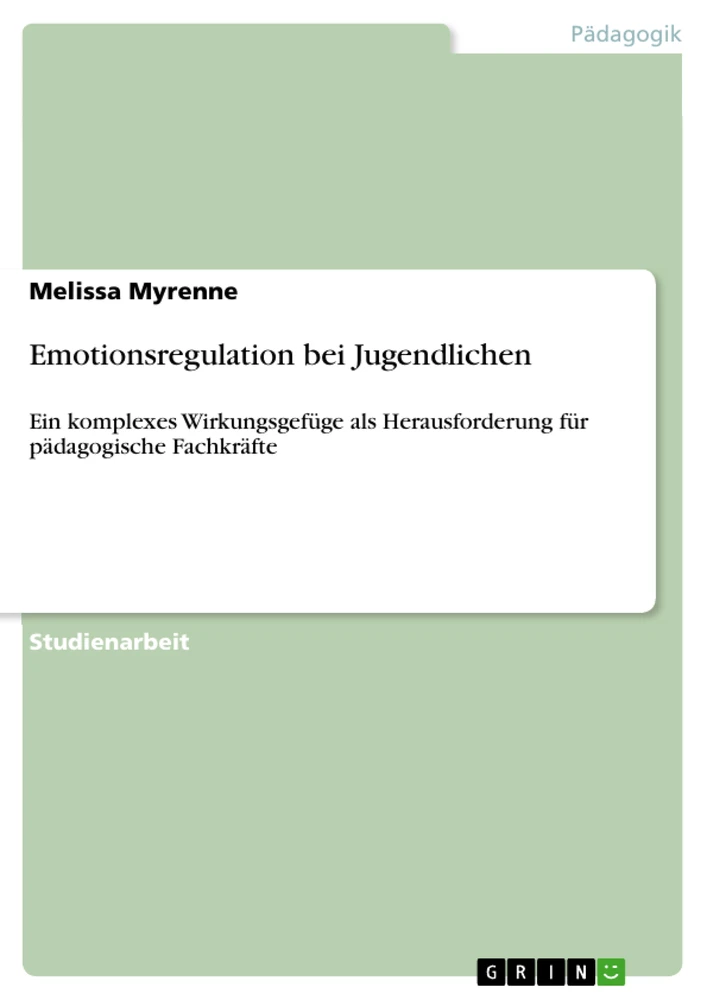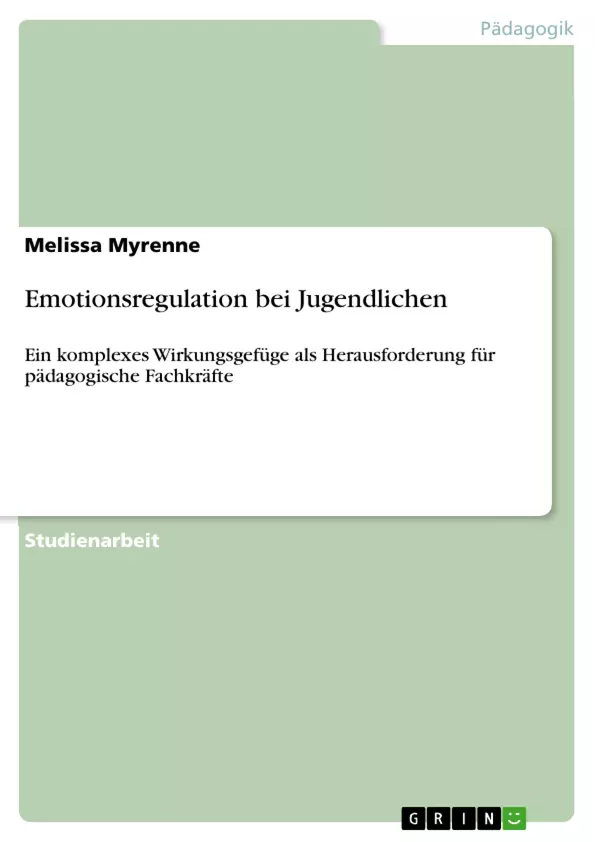Ziel dieser Arbeit ist es, wesentliche Punkte der Emotionsregulation von Jugendlichen darzustellen. Darauf aufbauend folgt eine Untersuchung der Herausforderungen von funktionaler, dysfunktionaler, "positiver" sowie "negativer" Emotionsregulation.
Abschließend wird herausgearbeitet, welcher Umgang mit Emotionen im pädagogischen Kontext angemessen erscheint. Dabei wird beleuchtet, wie präventiv und akut gehandelt werden kann, um Eskalationen im pädagogischen Handlungsfeld und im weiteren Entwicklungsverlauf der Jugendlichen vermeiden zu können.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der Begriff der Emotionsregulation
- 2.1 Definition
- 2.2 Entwicklung der Emotionsregulation
- 2.3 Einflüsse durch Genetik und Umwelt
- 2.4 Strategien der Emotionsregulation
- 3. Dysfunktionale und fehlende Emotionsregulation
- 3.1 Ursachen
- 3.2 Besondere Gefährdungen im Jugendalter
- 3.3 Probleme in der Strategieumsetzung
- 4. Bedeutung und Stellenwert der Emotionsregulation im Jugendalter
- 4.1 Handlungs- und Motivationsmechanismen des Jugendlichen
- 4.2 Auswirkungen von Emotionsregulation auf das Umfeld
- 5. Bedeutung für den pädagogischen Alltag
- 5.1 Präventive Handlungsmöglichkeiten für pädagogische Fachkräfte
- 5.2 Interventionsmöglichkeiten
- 6. Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Emotionsregulation bei Jugendlichen, ein wichtiges, aber bisher wenig erforschtes Gebiet der pädagogischen Psychologie. Das Ziel ist, wesentliche Aspekte der Emotionsregulation herauszuarbeiten und die Herausforderungen funktionaler, dysfunktionaler, positiver und negativer Emotionsregulation zu beleuchten. Schließlich soll ein angemessener Umgang mit Emotionen im pädagogischen Kontext aufgezeigt und präventive sowie akute Handlungsstrategien zur Vermeidung von Eskalationen vorgestellt werden.
- Definition und Entwicklung der Emotionsregulation
- Dysfunktionale Emotionsregulation und deren Ursachen im Jugendalter
- Bedeutung der Emotionsregulation für Handlungs- und Motivationsmechanismen Jugendlicher
- Auswirkungen von Emotionsregulation auf das Umfeld
- Präventive und interventive Handlungsmöglichkeiten für pädagogische Fachkräfte
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Arbeit widmet sich dem Thema Emotionsregulation bei Jugendlichen aufgrund seiner Bedeutung und des bisherigen Forschungsdefizits in diesem Bereich. Sie konzentriert sich auf den Einfluss der Emotionsregulation auf das Verhalten Jugendlicher, ohne andere Einflussfaktoren vollständig zu ignorieren. Der Fokus liegt auf dem emotionalen Verhalten und seiner Regulation (oder fehlender Regulation) als zentrale Thematik. Das Ziel ist die Herausarbeitung wesentlicher Punkte der Emotionsregulation und die Aufdeckung von Problematiken und Herausforderungen im Zusammenhang mit funktionaler und dysfunktionaler Emotionsregulation. Abschließend soll aufgezeigt werden, wie im pädagogischen Kontext angemessen mit Emotionen umgegangen werden kann.
2. Der Begriff der Emotionsregulation: Dieses Kapitel klärt den Begriff der Emotionsregulation. Es werden verschiedene Definitionen aus der Literatur vorgestellt und diskutiert, wobei letztendlich die Definition nach Thompson (1994) als Grundlage dient. Diese Definition betont die Zielgerichtetheit der Emotionsregulation und unterscheidet zwischen intrinsischer (Selbstregulation) und extrinsischer (Ausdruck und Kommunikation von Emotionen) Regulation. Die Bedeutung intensiver und zeitweiliger Merkmale emotionaler Reaktionen wird hervorgehoben.
2.2 Entwicklung der Emotionsregulation: Dieses Kapitel behandelt die Entwicklung der Emotionsregulation vom Säuglingsalter bis zur späten Kindheit. Es beschreibt die Entwicklung von der interpsychischen (mit Bezugspersonen) zur intrapsychischen (selbstgesteuerten) Emotionsregulation. Die Rolle von emotionalen Ausdrucksmustern, Sprache und Peer-Interaktion wird hervorgehoben. Es wird gezeigt, dass die intrapersonalen Strategien aus interpersonalen Erfahrungen resultieren und erst in der späten Kindheit eine unabhängige Emotionsregulation gelingt.
Schlüsselwörter
Emotionsregulation, Jugendliche, Pädagogische Psychologie, Entwicklung, Selbstregulation, Dysfunktionale Emotionsregulation, Prävention, Intervention, pädagogische Fachkräfte.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Emotionsregulation bei Jugendlichen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich mit der Emotionsregulation bei Jugendlichen, einem wichtigen, aber bisher wenig erforschten Gebiet der pädagogischen Psychologie. Sie untersucht wesentliche Aspekte der Emotionsregulation und beleuchtet die Herausforderungen funktionaler und dysfunktionaler Emotionsregulation. Ziel ist es, einen angemessenen Umgang mit Emotionen im pädagogischen Kontext aufzuzeigen und präventive sowie akute Handlungsstrategien zur Vermeidung von Eskalationen vorzustellen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Definition und Entwicklung der Emotionsregulation, dysfunktionale Emotionsregulation und deren Ursachen im Jugendalter, Bedeutung der Emotionsregulation für Handlungs- und Motivationsmechanismen Jugendlicher, Auswirkungen von Emotionsregulation auf das Umfeld und präventive sowie interventive Handlungsmöglichkeiten für pädagogische Fachkräfte.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in mehrere Kapitel gegliedert: Eine Einleitung, ein Kapitel zum Begriff der Emotionsregulation (inkl. Definition, Entwicklung, genetischen und umweltbedingten Einflüssen und Strategien), ein Kapitel zu dysfunktionaler und fehlender Emotionsregulation (inkl. Ursachen, besonderer Gefährdungen im Jugendalter und Problemen in der Strategieumsetzung), ein Kapitel zur Bedeutung der Emotionsregulation im Jugendalter (inkl. Handlungs- und Motivationsmechanismen und Auswirkungen auf das Umfeld), ein Kapitel zur Bedeutung für den pädagogischen Alltag (inkl. präventiver und interventiver Handlungsmöglichkeiten) und einen Ausblick.
Wie wird der Begriff der Emotionsregulation definiert?
Die Arbeit verwendet die Definition von Thompson (1994) als Grundlage. Diese Definition betont die Zielgerichtetheit der Emotionsregulation und unterscheidet zwischen intrinsischer (Selbstregulation) und extrinsischer (Ausdruck und Kommunikation von Emotionen) Regulation. Die Bedeutung intensiver und zeitweiliger Merkmale emotionaler Reaktionen wird hervorgehoben.
Wie entwickelt sich die Emotionsregulation?
Die Arbeit beschreibt die Entwicklung der Emotionsregulation vom Säuglingsalter bis zur späten Kindheit. Sie zeigt die Entwicklung von der interpsychischen (mit Bezugspersonen) zur intrapsychischen (selbstgesteuerten) Emotionsregulation auf und hebt die Rolle von emotionalen Ausdrucksmustern, Sprache und Peer-Interaktion hervor. Intrapersonale Strategien resultieren aus interpersonalen Erfahrungen; eine unabhängige Emotionsregulation gelingt erst in der späten Kindheit.
Welche Bedeutung hat Emotionsregulation für Jugendliche?
Die Emotionsregulation hat einen erheblichen Einfluss auf die Handlungs- und Motivationsmechanismen Jugendlicher sowie auf deren Umfeld. Dysfunktionale Emotionsregulation kann zu verschiedenen Problemen führen.
Welche Handlungsmöglichkeiten für pädagogische Fachkräfte werden vorgestellt?
Die Arbeit beschreibt sowohl präventive als auch interventive Handlungsmöglichkeiten für pädagogische Fachkräfte, um einen angemessenen Umgang mit Emotionen im pädagogischen Kontext zu ermöglichen und Eskalationen zu vermeiden.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Emotionsregulation, Jugendliche, Pädagogische Psychologie, Entwicklung, Selbstregulation, Dysfunktionale Emotionsregulation, Prävention, Intervention, pädagogische Fachkräfte.
- Citar trabajo
- Melissa Myrenne (Autor), 2015, Emotionsregulation bei Jugendlichen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/306799