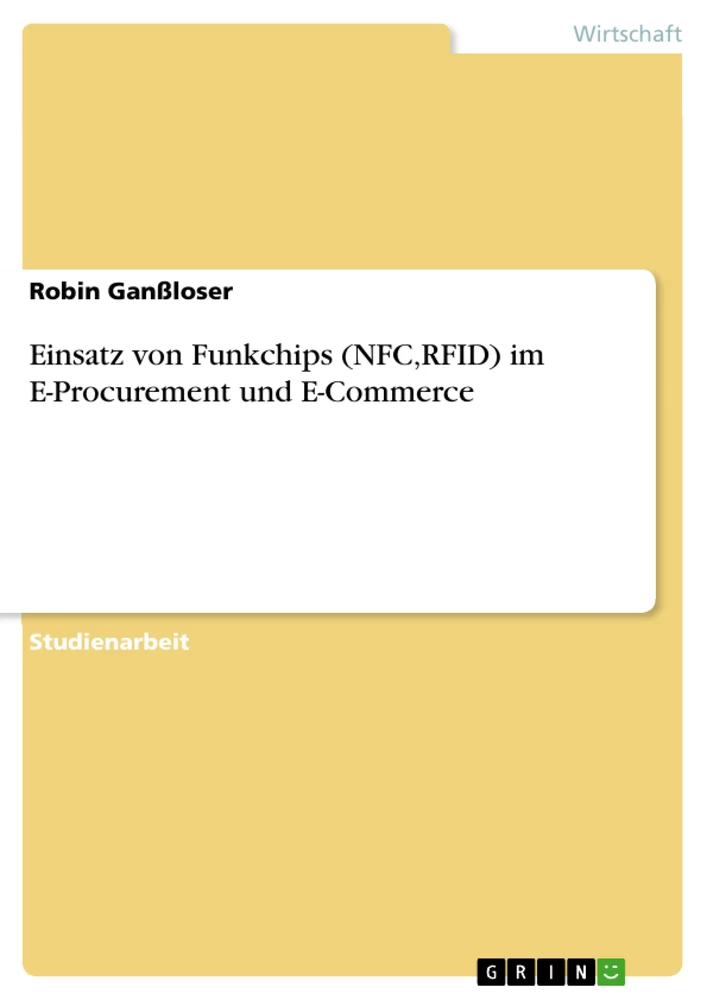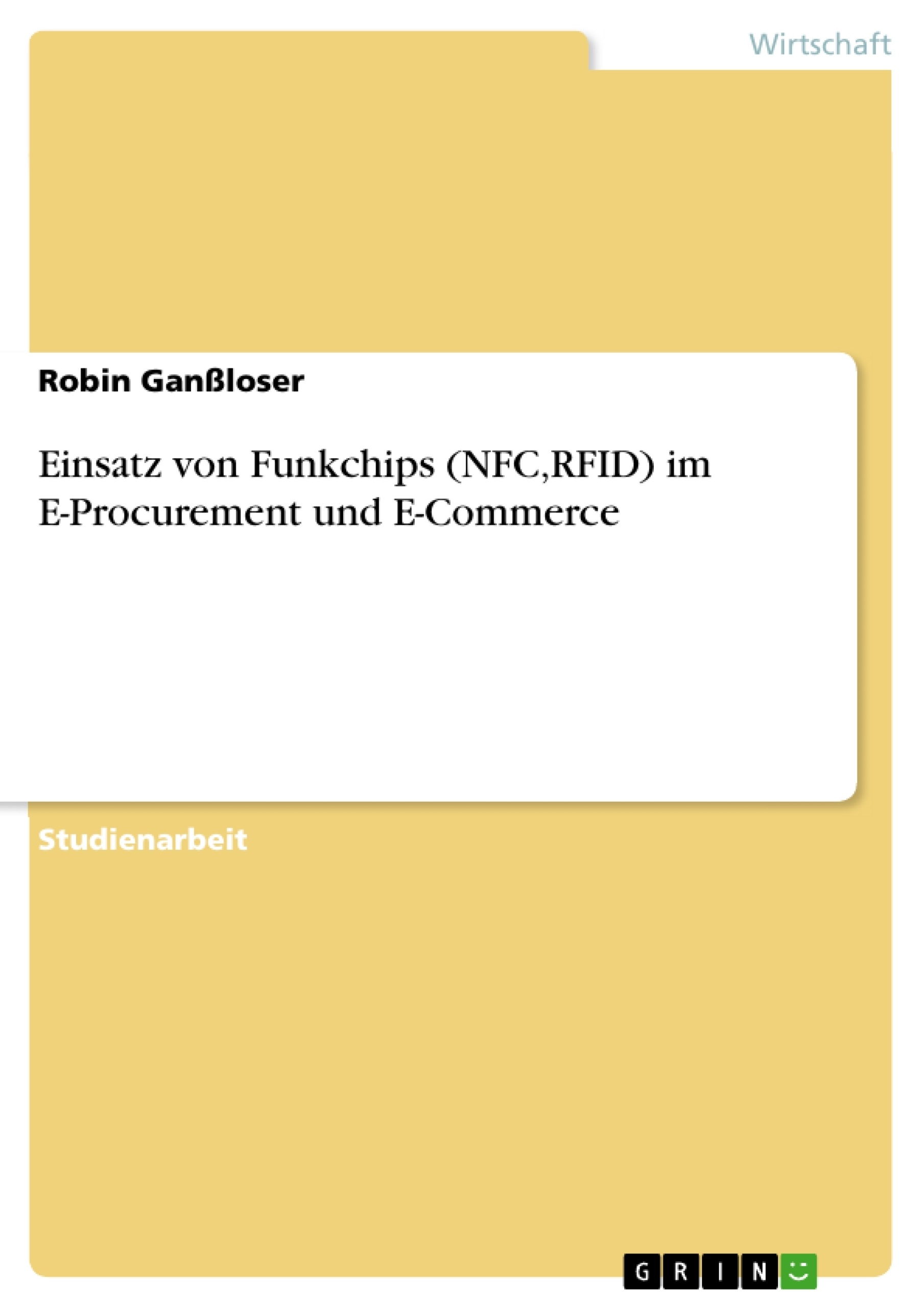Die vorliegende Arbeit soll Einblicke in die Funktionsweise der RFID- und NFC-Technologie geben. Weiter soll durch Abgrenzung der beteiligten Wirtschaftssegmente eine differenzierte Betrachtung ermöglicht werden. Dies stellt die Basis zur kritischen Auseinandersetzung der Einsatzgebiete dar.
Die umfassende Diskussion der Technologien und deren Anwendungen sollen folgende Fragestellungen klären: Wie können die Technologien erfolgreich eingesetzt werden? Bieten die Technologien einen angemessenen Nutzen? Welche Risiken ergeben sich aus dem Technologieeinsatz? Welche Grenzen bestehen für den Technologieeinsatz? Mit welchen zukünftigen Entwicklungen ist zu rechnen?
Zur Klärung der Fragestellungen werden eingangs eine begriffliche Abgrenzung, sowie eine Einführung in die technischen Funktionsweisen von RFID und NFC vorgenommen. Auf tiefgreifende physikalische Grundlagen wird dabei nicht eingegangen. Anschließend erfolgt in Kapitel 3 und 4 die Auseinandersetzung mit den geschilderten Technologien. Hierbei wird eine thematische Abgrenzung zwischen den Einsatzgebieten im E-Procurement (Kapitel 3) und E-Commerce (Kapitel 4) vorgenommen. Aufgrund der inhaltlichen Nähe der Szenarien im jeweiligen Kapitel wird die kritische Auseinandersetzung auf den betrachteten Wirtschaftssektor bezogen. Daran anschließend erfolgen ein Zukunftsausblick, sowie ein abschließendes Fazit.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Zielsetzung
- 1.3 Vorgehensweise
- 2. Begriffsdefinitionen und Abgrenzung des Themengebiets
- 2.1 Definition zu RFID und technische Grundlagen
- 2.2 Definition zu NFC und technische Grundlagen
- 2.3 Abgrenzung von E-Procurement und E-Commerce im E-Business
- 3. Anwendungsgebiete von RFID im E-Procurement
- 3.1 Prozessoptimierung innerhalb der Supply Chain durch RFID
- 3.2 Produktionssteuerung durch RFID-gestütztes Kanban
- 3.3 Bewertung der Anwendungsgebiete hinsichtlich Potentialen und Risiken
- 3.3.1 Potenziale
- 3.3.2 Risiken und Grenzen
- 3.3.3 Zusammenfassung
- 4 Anwendungsgebiete von NFC und RFID im E-Commerce
- 4.1 Mobile Payment durch NFC
- 4.2 Erhöhung des Servicegrades im Einzelhandel durch NFC und RFID
- 4.3 Bewertung der Anwendungsgebiete hinsichtlich Potenzialen und Risiken
- 4.3.1 Potenziale
- 4.3.2 Risiken und Grenzen
- 4.3.3 Zusammenfassung
- 5. Zukunftsausblick
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die vorliegende Seminararbeit befasst sich mit der Nutzung von Funkchips (NFC/RFID) im E-Procurement und E-Commerce. Sie untersucht die Anwendungsmöglichkeiten dieser Technologien zur Steigerung der Effizienz und Transparenz in Unternehmensprozessen.
- Definition und technische Grundlagen von RFID und NFC
- Anwendungsgebiete von RFID im E-Procurement, insbesondere in der Supply Chain und Produktionssteuerung
- Anwendungsgebiete von NFC und RFID im E-Commerce, z.B. im Bereich Mobile Payment und Serviceoptimierung im Einzelhandel
- Bewertung der Potenziale und Risiken von RFID und NFC in den jeweiligen Anwendungsgebieten
- Zukunftsperspektiven für den Einsatz von Funkchips im E-Business
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung stellt die Problematik der Nutzung von Funkchips (NFC/RFID) im E-Procurement und E-Commerce dar. Sie beleuchtet die Herausforderungen, die Unternehmen im digitalen Zeitalter bewältigen müssen, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.
Das zweite Kapitel definiert die Begriffe RFID und NFC und erläutert deren technische Grundlagen. Anschließend wird die Abgrenzung von E-Procurement und E-Commerce im E-Business dargestellt.
Im dritten Kapitel werden Anwendungsgebiete von RFID im E-Procurement untersucht. Der Fokus liegt auf der Prozessoptimierung innerhalb der Supply Chain und der Produktionssteuerung durch RFID-gestütztes Kanban.
Das vierte Kapitel behandelt Anwendungsgebiete von NFC und RFID im E-Commerce. Hier stehen Mobile Payment und die Erhöhung des Servicegrades im Einzelhandel im Vordergrund.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen RFID, NFC, E-Procurement, E-Commerce, Supply Chain Management, Produktionssteuerung, Mobile Payment, Serviceoptimierung im Einzelhandel, Potenziale und Risiken.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen RFID und NFC?
RFID ist eine Funktechnologie zur Identifikation über größere Distanzen, während NFC eine Spezialform für den Nahbereich (wenige Zentimeter) ist, oft genutzt für Mobile Payment.
Wie optimiert RFID das E-Procurement?
RFID ermöglicht eine automatisierte Lagerhaltung, Echtzeit-Tracking in der Supply Chain und eine effiziente Produktionssteuerung (z. B. via Kanban).
Welche Risiken birgt der Einsatz von Funkchips?
Zentrale Risiken sind der Datenschutz (unbefugtes Auslesen), technische Störanfälligkeit und hohe Implementierungskosten.
Was bedeutet Mobile Payment durch NFC?
Es erlaubt das kontaktlose Bezahlen mit dem Smartphone an Kassenklemmen durch einfaches kurzes Vorhalten des Geräts.
Wie profitiert der Einzelhandel von NFC?
Durch NFC können Kunden zusätzliche Produktinformationen direkt am Regal abrufen, was den Servicegrad und die Transparenz erhöht.
- Citar trabajo
- Robin Ganßloser (Autor), 2015, Einsatz von Funkchips (NFC,RFID) im E-Procurement und E-Commerce, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/307694