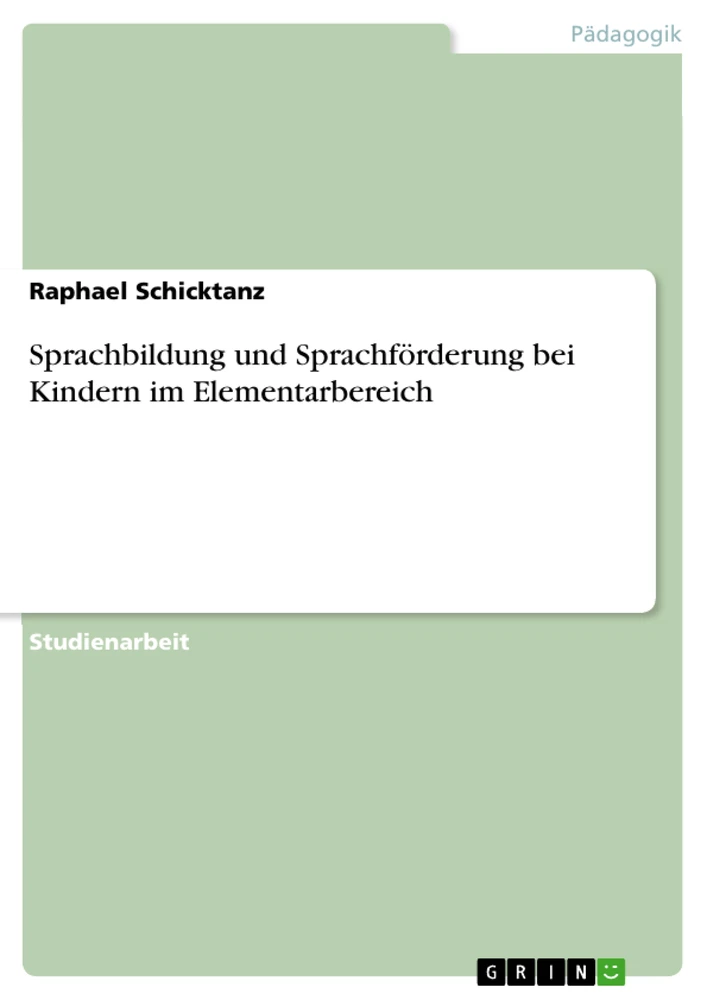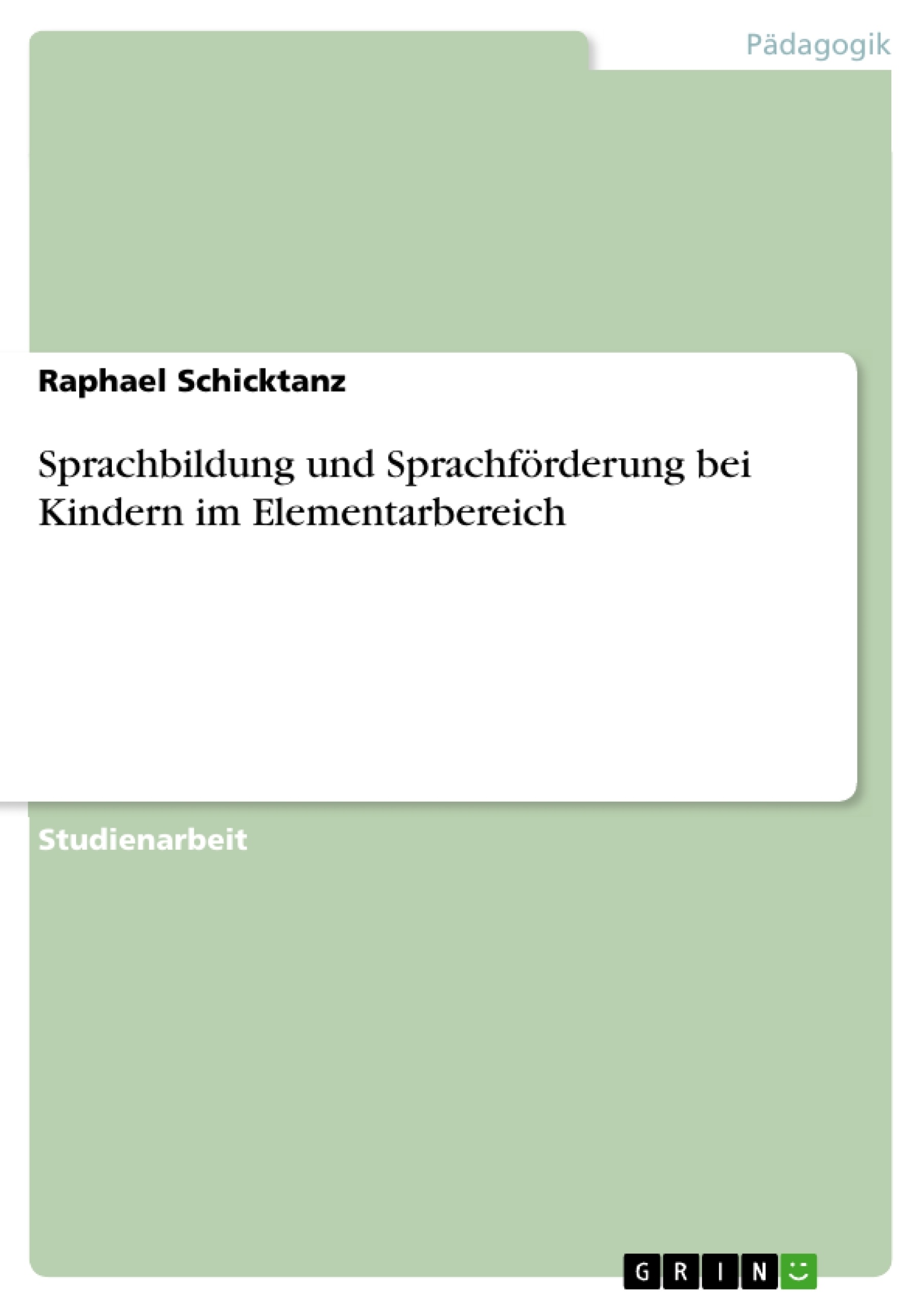Seit dem „PISA-Schock“ im Jahre 2000 wird dem Begriff „Bildung“ in Deutschland deutlich mehr Bedeutung zugesprochen. Gerade die Bildung im Elementarbereich, also den Kindertagesstätten, erfuhr einen Aufschub. Die Forderung nach fühkindlicher Bildung ist seitdem höher als je zuvor. Zudem stellt die Sprachförderung einen Hauptschwerpunkt des Elementarbereichs dar.
Auch das Thema „Einwanderung“ erfährt aktuell eine große Aufmerksamkeit und wird ständig in den Medien behandelt. Die Einwanderungszahlen steigen an. Diese Tatsache wird ebenfalls Auswirkungen auf die Arbeit in Kindertagesstätten haben, denn die Anzahl an Kinder mit Migrationshintergrund wird dadurch bedingt ebenfalls steigen. Die Sprachförderung wird demnach mehr Raum einnehmen müssen, um auch den Kindern mit Migrationshintergrund die Chance auf einen guten Bildungserfolg zu ermöglichen.
In der folgenden Ausarbeitung wird zunächst geklärt, wie Sprache im allgemeinen gebildet und erlernt wird, welche „Meilensteine“ und Normen festgelegt sind, wie man einen Sprachkenntnisstand erheben kann und was Sprachförderung bedeutet. Ein weiterer Blick wird in die Richtung „Migrationshintergrund“ gerichtet. Welche Besonderheiten birgt diese und welchen Einfluss hat das Aufwachsen mit zwei verschiedenen Sprachen auf die Sprachentwicklung eines Kindes?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Sprachbildung
- Besonderheiten der Sprachentwicklung bei bilingual aufwachsenden Kindern
- Beobachtung und Dokumentation von Sprache
- Beobachtungsbogen Seldak
- Beobachtungsbogen SISMIK
- Sprachstörung
- Sprachentwicklungsstörungen
- Sprachentwicklungsverzögerungen
- Sprachentwicklungsbehinderungen und Late Talker
- Sprachförderung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema Sprachbildung und Sprachförderung bei Kindern im Elementarbereich. Sie beleuchtet die Bedeutung von Sprache für den Bildungserfolg und die Herausforderungen, die sich im Kontext von Migration und Bilingualität stellen. Die Arbeit untersucht die Sprachentwicklungsstufen und -normen, die Besonderheiten bilingualer Sprachentwicklung, sowie verschiedene Methoden zur Beobachtung und Dokumentation von Sprache. Zudem werden Sprachstörungen und ihre Auswirkungen auf die Sprachentwicklung thematisiert.
- Bedeutung von Sprache für den Bildungserfolg
- Sprachentwicklung bei Kindern im Elementarbereich
- Besonderheiten der Sprachentwicklung bei bilingualen Kindern
- Methoden zur Beobachtung und Dokumentation von Sprache
- Sprachstörungen und deren Auswirkungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz von Sprachbildung im Kontext des Bildungssystems und der aktuellen Entwicklungen im Bereich der Migration dar. Kapitel 2 beleuchtet die grundlegenden Prozesse der Sprachbildung, die Meilensteine der Sprachentwicklung und wichtige Normen. Kapitel 3 geht auf die Besonderheiten der Sprachentwicklung bei Kindern mit Migrationshintergrund und deren doppeltem Erstspracherwerb ein. Kapitel 4 betrachtet verschiedene Methoden zur Beobachtung und Dokumentation von Sprache, wie zum Beispiel die Beobachtungsbogen Seldak und SISMIK. In Kapitel 5 werden verschiedene Arten von Sprachstörungen und ihre Auswirkungen auf die Sprachentwicklung des Kindes behandelt.
Schlüsselwörter
Sprachbildung, Sprachförderung, Elementarbereich, Sprachentwicklung, Bilingualität, Migration, Beobachtung, Dokumentation, Sprachstörungen, Bildungserfolg.
- Citation du texte
- Raphael Schicktanz (Auteur), 2015, Sprachbildung und Sprachförderung bei Kindern im Elementarbereich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/308049