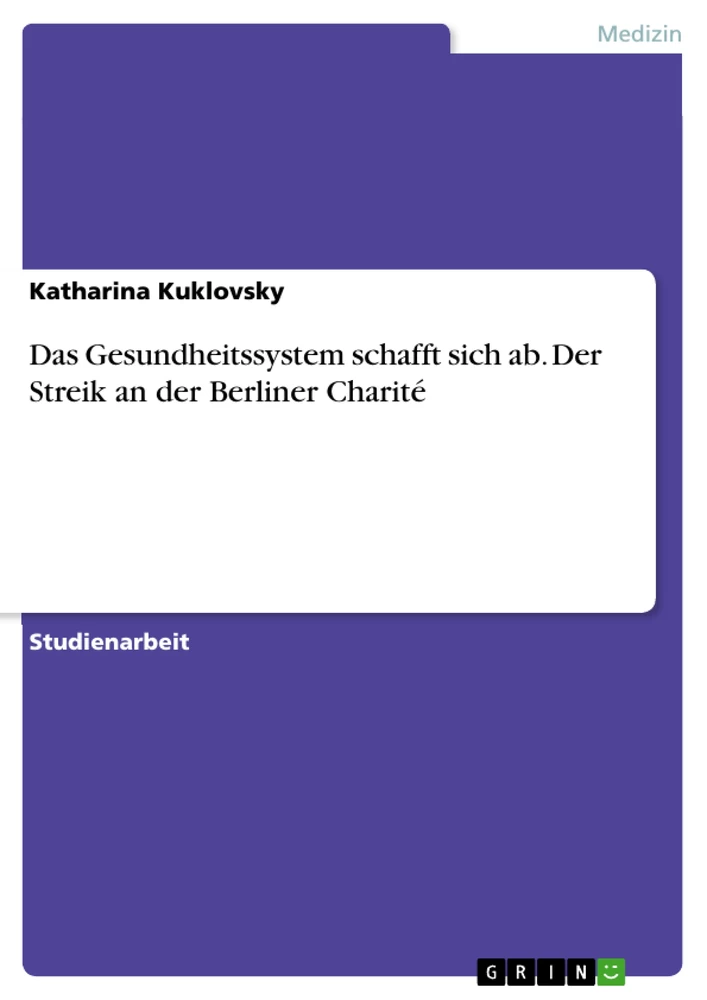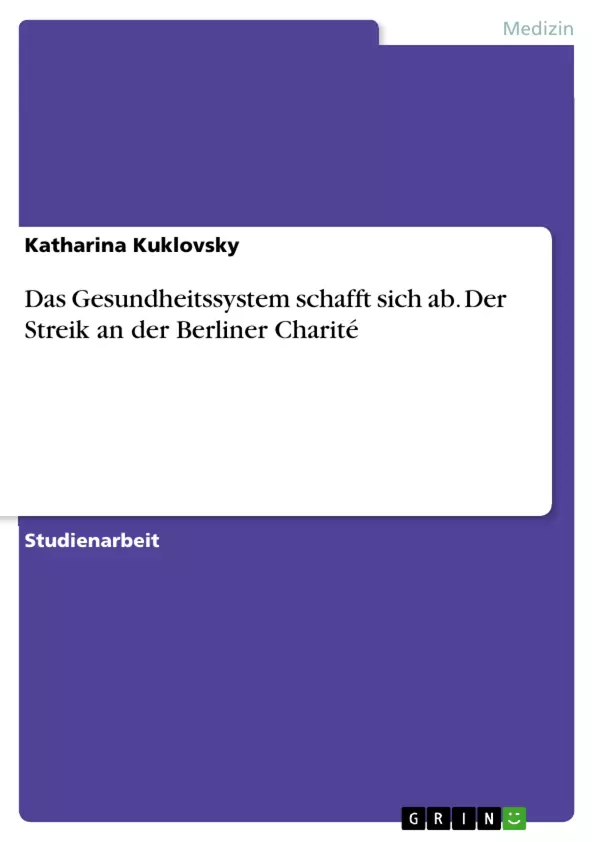Der Streik an der Berliner Charité im Jahr 2011 war ein Testlauf für die Methode des Betten- und Stationsschließungsstreikes. Da im Jahr 2013 ebenfalls gestreikt und im selben Jahr ein Tarifvertrag verhandelt wurde, stellt sich die Frage, welche kurz- und langfristigen Folgen der Streik im Jahr 2011 an der Berliner Charité aus Ver.di Sicht sowie aus Sicht der Mitarbeiter der Charité hatte und wie der Streik in 2011 den folgenden Streik in 2013 beeinflusste.
Mithilfe von Literaturrecherche wird der Stand der Forschung ermittelt sowie die allgemeine Meinung über den Streik in Berlin. Des Weiteren dient die Literaturrecherche der Erschließung von relevantem Basismaterial für die Beantwortung der Fragestellungen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Jenaer Machtressourcenansatz 2.0
- 2.1. Machtressourcenanalyse
- 2.1.1. Strukturelle Macht
- 2.1.2. Organisationsmacht
- 2.1.3. Gesellschaftliche Macht
- 3. Streik an der Charité im Jahr 2011
- 3.1 Das Gesundheitssystem
- 3.2 Die Charité
- 3.3 Anwendung des Jenaer Machtressourcenansatz 2.0
- 3.4. Forderungen und Folgen des Streiks
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert den Betten- und Stationsschließungsstreik an der Berliner Charité im Jahr 2011, seine kurz- und langfristigen Folgen für Ver.di und das Pflegepersonal, und seinen Einfluss auf den nachfolgenden Streik 2013. Die Analyse nutzt den Jenaer Machtressourcenansatz 2.0 als methodisches Rahmenwerk.
- Folgen des Streiks an der Charité 2011 für Ver.di und das Pflegepersonal
- Anwendung des Jenaer Machtressourcenansatzes 2.0 auf den Streik
- Einfluss des Streiks 2011 auf den Streik 2013 und den Tarifvertrag
- Analyse der verschiedenen Machtressourcen im Kontext des Streiks
- Bewertung der Wirksamkeit des Betten- und Stationsschließungsstreiks
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Betten- und Stationsschließungsstreiks an der Berliner Charité im Jahr 2011 ein. Sie hebt die Aktualität des Themas aufgrund des Folge-Streiks 2013 und des abgeschlossenen Tarifvertrages hervor. Die drei zentralen Forderungen des Streiks – Gehaltserhöhung, Erhöhung der Mitarbeiterzahlen und Verbesserung der Arbeitsbedingungen – werden benannt, ebenso die angewandte Streikform und die geschätzten finanziellen Folgen für die Charité. Die Arbeit gliedert sich in zwei Teile: die Einführung des Jenaer Machtressourcenansatzes 2.0 und die Analyse des Streiks an der Charité unter Anwendung dieses Ansatzes. Das besondere Arbeitsmilieu im Gesundheitswesen wird als wichtiger Kontextfaktor hervorgehoben.
2. Jenaer Machtressourcenansatz 2.0: Dieses Kapitel erläutert den Jenaer Machtressourcenansatz 2.0, der als analytisches Werkzeug für die Untersuchung des Streiks dient. Es beschreibt die verschiedenen Machtressourcen (strukturelle, organisatorische, gesellschaftliche), ihre Interdependenzen und wie sie sich im Kontext gewerkschaftlicher Arbeit auswirken. Der Ansatz basiert auf der Annahme, dass die politische Gestaltung durch die Machtverteilung zwischen gesellschaftlichen Gruppen beeinflusst wird. Die verschiedenen Arten von Macht werden detailliert erklärt und ihre Anwendung im Kontext von Streiks illustriert.
3. Streik an der Charité im Jahr 2011: Dieses Kapitel analysiert den Streik an der Charité im Jahr 2011. Es beschreibt das Gesundheitssystem und die Charité als institutionelle Akteure und wendet den Jenaer Machtressourcenansatz auf den konkreten Fall an. Der Fokus liegt auf den Forderungen der Streikenden, den Folgen des Streiks (sowohl kurz- als auch langfristig), und der Bewertung der eingesetzten Strategien. Die Analyse berücksichtigt dabei die Perspektive von Ver.di und des Pflegepersonals.
Schlüsselwörter
Betten- und Stationsschließungsstreik, Berliner Charité, Ver.di, Pflegepersonal, Tarifvertrag, Jenaer Machtressourcenansatz 2.0, strukturelle Macht, organisatorische Macht, gesellschaftliche Macht, Arbeitsbedingungen, Gehaltserhöhung, Streiks 2011 und 2013.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse des Streiks an der Berliner Charité 2011
Was ist der Gegenstand dieser Analyse?
Diese Arbeit analysiert den Betten- und Stationsschließungsstreik an der Berliner Charité im Jahr 2011. Im Fokus stehen die kurz- und langfristigen Folgen für die Gewerkschaft Ver.di und das Pflegepersonal sowie der Einfluss des Streiks auf den nachfolgenden Streik 2013 und den daraus resultierenden Tarifvertrag. Der Jenaer Machtressourcenansatz 2.0 dient als methodisches Rahmenwerk.
Welche Methode wird verwendet?
Die Analyse basiert auf dem Jenaer Machtressourcenansatz 2.0. Dieser Ansatz untersucht die verschiedenen Machtressourcen (strukturelle, organisatorische, gesellschaftliche) und deren Interdependenzen, um die politische Gestaltung und den Einfluss von gesellschaftlichen Gruppen zu beleuchten. Die Anwendung dieses Ansatzes auf den Streik an der Charité steht im Mittelpunkt der Untersuchung.
Welche Aspekte des Streiks werden untersucht?
Die Analyse umfasst die Folgen des Streiks für Ver.di und das Pflegepersonal, die Anwendung des Jenaer Machtressourcenansatzes 2.0 auf den konkreten Fall, den Einfluss des Streiks 2011 auf den Streik 2013 und den Tarifvertrag, die verschiedenen Machtressourcen im Kontext des Streiks und eine Bewertung der Wirksamkeit des Betten- und Stationsschließungsstreiks.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Erklärung des Jenaer Machtressourcenansatz 2.0, ein Kapitel zur Analyse des Streiks an der Charité 2011 und ein Fazit. Die Einleitung beschreibt den Kontext des Streiks und die zentralen Forderungen (Gehaltserhöhung, Erhöhung der Mitarbeiterzahlen, Verbesserung der Arbeitsbedingungen). Das Kapitel zum Jenaer Machtressourcenansatz 2.0 erklärt das theoretische Fundament der Analyse. Das Kapitel zum Streik analysiert den Verlauf und die Folgen des Streiks unter Anwendung des Ansatzes.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Betten- und Stationsschließungsstreik, Berliner Charité, Ver.di, Pflegepersonal, Tarifvertrag, Jenaer Machtressourcenansatz 2.0, strukturelle Macht, organisatorische Macht, gesellschaftliche Macht, Arbeitsbedingungen, Gehaltserhöhung, Streiks 2011 und 2013.
Welche zentralen Forderungen stellten die Streikenden?
Die drei zentralen Forderungen des Streiks waren Gehaltserhöhung, Erhöhung der Mitarbeiterzahlen und Verbesserung der Arbeitsbedingungen.
Was ist der Jenaer Machtressourcenansatz 2.0?
Der Jenaer Machtressourcenansatz 2.0 ist ein analytisches Werkzeug, das verschiedene Arten von Macht (strukturelle, organisatorische, gesellschaftliche) und deren Zusammenspiel untersucht, um die politische Gestaltung und den Einfluss von gesellschaftlichen Gruppen zu verstehen. Er dient in dieser Arbeit als Grundlage zur Analyse des Streiks an der Charité.
Welche Rolle spielt das Gesundheitssystem in der Analyse?
Das Gesundheitssystem und die Charité als institutionelle Akteure werden als wichtiger Kontextfaktor für den Streik und dessen Folgen betrachtet. Die Analyse berücksichtigt die spezifischen Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen und deren Einfluss auf den Verlauf und die Ergebnisse des Streiks.
- Citar trabajo
- Katharina Kuklovsky (Autor), 2014, Das Gesundheitssystem schafft sich ab. Der Streik an der Berliner Charité, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/308171