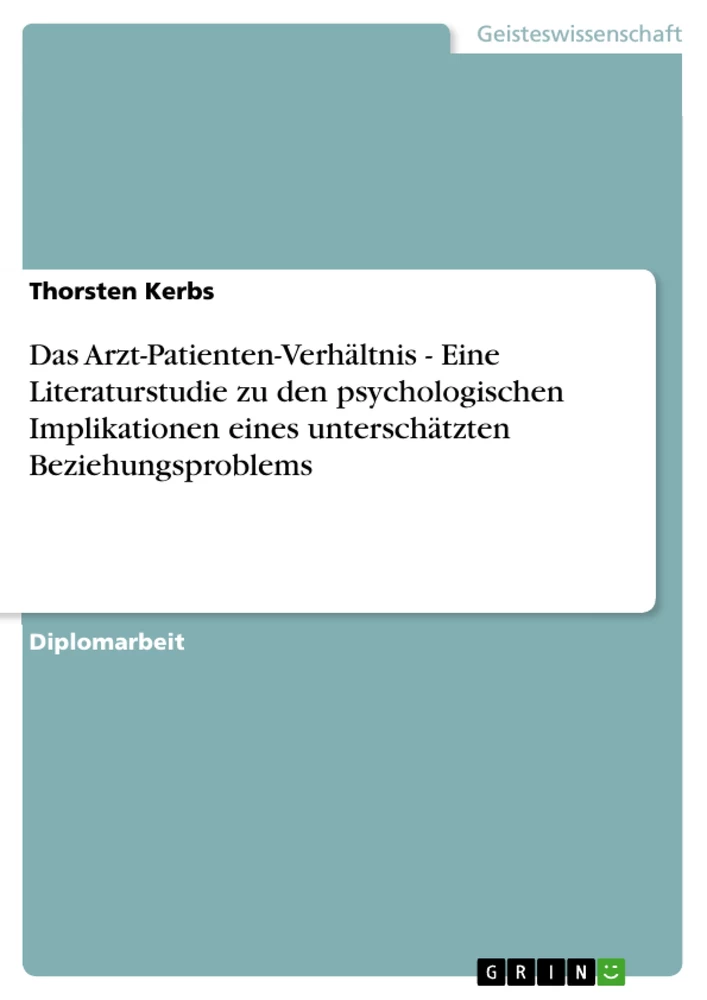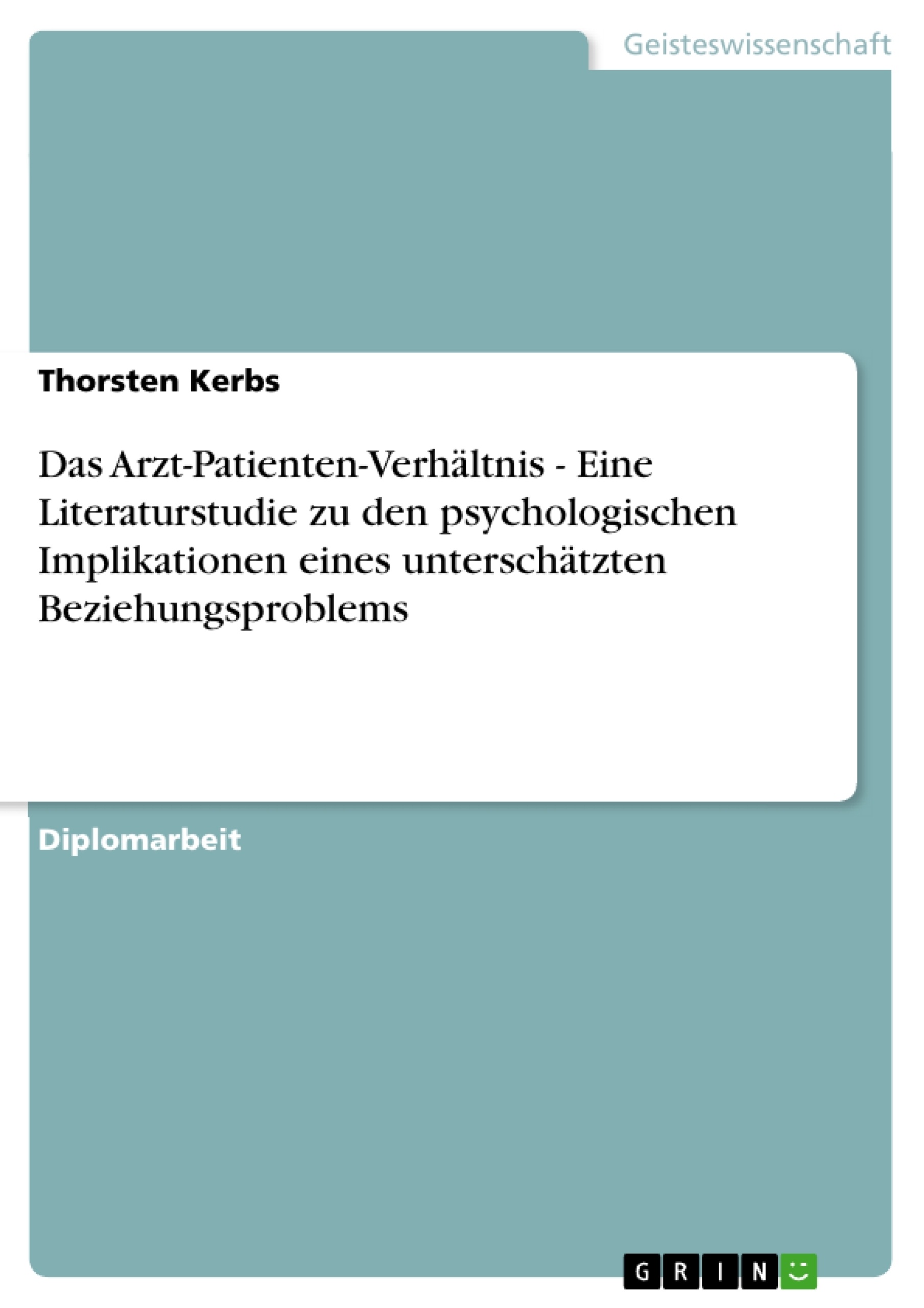Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht das Gespräch zwischen Arzt und Patient, das situationsbedingt zwei Menschen zusammenführt, die sich darüber austauschen, warum und woran der Ratsuchende von ihnen erkrankt ist und welche Heilbehandlung dafür am geeignetsten erscheint. Bei einer ersten Sich-tung von Publikationen namhafter Autoren wie Balint, von Uexküll und Wesiack, die sich eingehend mit der Untersuchung der Beziehung von Arzt und Patient befassen, gewinnt der Leser sehr bald den Eindruck, das Arzt-Patienten-Verhältnis sei eine gesellschaftliche und insbesondere psychologisch be-trachtet hochrelevante Problembeziehung, die in ihrer Spezifik, in ihren Implikationen bisher viel zu wenig beachtet wurde.
Der Großteil der Autoren befaßt sich, und das zeigt der vertiefte Einstieg in das Thema, mit der Arzt-Patienten-Beziehung überwiegend aus der Perspektive des eigenen wissenschaftlichen Hintergrundes. Fraglos gehört das zu einem profunden Arbeitsstil dazu, aus dem Grund gibt es jedoch eine große Zahl an Veröffentlichungen, die das Thema entweder nur aus medizinischer oder psychologischer oder soziologischer Perspektive beleuchten. Dabei geht unvermeidlich der Eindruck darüber verloren, wie wenig die einzelnen Aspekte dieses Themas zu trennen und mit einer reduktionistischen Arbeitsweise umfänglich zu erfassen sind. Denn gerade die Bedeutung der scheinbar so alltäglichen und unspekta-kulären Arzt-Patienten-Beziehung scheint sich nur aus einer ganzheitlichen bzw. systemischen Per-spektive zu erschließen.
Die vorliegende Arbeit verfolgt deshalb das Ziel, im Sinne eines Überblicks aktuelle Forschungsergebnisse der verschiedenen Fachrichtungen in Zusammenhang zu setzen, ohne daß dabei der psy-chologische Fokus verloren geht. Veröffentlichungen über Compliance- und Interaktionsprobleme, wie sie von Ärzten berichtet werden, finden ebenso Beachtung wie Darstellungen des Kollusionsmodells und die von Übertragungs- und Gegenübertragungsprozessen, und ein Exkurs über die Rolle des Kör-pers in der therapeutischen Gesprächssituationen schließt sich an. Ein weiterer Abschnitt ist neueren Ergebnissen der Grundlagenforschung aus Medizin und Physik gewidmet, denen, und das zeigt sich deutlich anhand der aktuellen Debatte über die Stammzellforschung und das ‚therapeutische Klonen’, ein mittelbarer Einfluß auf das Menschenbild zugemessen werden muß. Das Menschenbild stellt wie-derum das wesentliche Fundament dar, auf dem die Arzt-Patienten-Beziehung ruht.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Kontext der Arzt-Patienten-Beziehung
- 1. Gesellschaftliche Rahmenbedingungen
- a) Gesundheit und Lebensqualität als Zielsetzung ärztlichen Handelns
- h) Technische oder Apparatemedizin
- 2. Krankheit und Naturwissenschaft
- a) Leib-Seele-Dualismus
- b) Der kranke Mensch
- c) Direkte Einwirkung des Gehirns auf das Immunsystem: Psychoneuroimmunologie
- d) Psychosomatik
- e) Die Quantentheorie als Vorbote eines Paradigmenwechsels - auch in der Medizin?
- C. Psychologie der Arzt-Patienten-Beziehung
- 1. Eine tiefenpsychologische Perspektive
- 2. Setting
- 3. Elemente der Arzt-Patienten-Beziehung
- 4. Abwehrmechanismen der ärztlichen Seite
- D. Schwierigkeiten der Arzt-Patienten-Beziehung am konkreten Beispiel
- 1. Grenzsituationen ärztlichen Handelns
- 2. Psychosomatische Störungen in ihrer Auswirkung auf die Arzt-Patienten-Beziehung
- 3. Darstellungen ausgewählter Erkrankungen
- 4. Gefahr der Wandlung der Arzt-Persönlichkeit vom Helfer zum unbeteiligten Beobachter
- 5. Aus der Sicht des Arztes
- E. Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Arzt-Patienten-Beziehung aus einer interdisziplinären Perspektive, wobei der psychologische Fokus im Vordergrund steht. Ziel ist es, aktuelle Forschungsergebnisse aus Medizin, Psychologie und Soziologie zusammenzuführen und ein umfassenderes Verständnis dieser komplexen Beziehung zu schaffen. Die Arbeit berücksichtigt dabei sowohl gesellschaftliche Rahmenbedingungen als auch die psychologischen Dynamiken zwischen Arzt und Patient.
- Gesellschaftliche Einflüsse auf das Arzt-Patienten-Verhältnis
- Psychologische Aspekte der Arzt-Patienten-Interaktion (z.B. Übertragung, Gegenübertragung)
- Kommunikation und Entscheidungsfindung in der Arzt-Patienten-Beziehung
- Grenzsituationen im ärztlichen Handeln (z.B. unheilbare Krankheiten)
- Der Einfluss von psychosomatischen Störungen auf die Arzt-Patienten-Beziehung
Zusammenfassung der Kapitel
A. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Arzt-Patienten-Beziehung ein und hebt deren gesellschaftliche und psychologische Relevanz hervor. Sie kritisiert die bisherige Tendenz, diese Beziehung aus zu reduktionistischen Perspektiven zu betrachten und betont die Notwendigkeit eines ganzheitlichen, systemischen Ansatzes. Die Arbeit setzt sich zum Ziel, aktuelle Forschungsergebnisse aus verschiedenen Disziplinen zusammenzuführen, um ein umfassenderes Verständnis zu erlangen.
B. Kontext der Arzt-Patienten-Beziehung: Dieses Kapitel beleuchtet die gesellschaftlichen und naturwissenschaftlichen Rahmenbedingungen der Arzt-Patienten-Beziehung. Es diskutiert die Definition von Gesundheit, den Einfluss von Technologie und Wirtschaft auf die Medizin, sowie das Verhältnis von Leib und Seele. Besonders wird der Einfluss von Psychoneuroimmunologie und Psychosomatik auf das Verständnis von Krankheit und dem daraus resultierenden Arzt-Patienten-Verhältnis erörtert. Der Einfluss gesellschaftlicher Rahmenbedingungen, der Struktur des Gesundheitswesens und der ärztlichen Ausbildung wird ebenfalls beleuchtet.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument: Arzt-Patienten-Beziehung
Was ist der allgemeine Inhalt des Dokuments?
Das Dokument bietet einen umfassenden Überblick über die Arzt-Patienten-Beziehung aus interdisziplinärer Perspektive, mit Schwerpunkt auf der Psychologie. Es kombiniert Forschungsergebnisse aus Medizin, Psychologie und Soziologie, um ein ganzheitliches Verständnis dieser komplexen Beziehung zu schaffen. Es werden gesellschaftliche Rahmenbedingungen, psychologische Dynamiken und konkrete Beispiele von Schwierigkeiten in der Arzt-Patienten-Beziehung behandelt.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument deckt ein breites Spektrum an Themen ab, darunter: gesellschaftliche Einflüsse auf das Arzt-Patienten-Verhältnis, psychologische Aspekte der Arzt-Patienten-Interaktion (Übertragung, Gegenübertragung), Kommunikation und Entscheidungsfindung, Grenzsituationen im ärztlichen Handeln (z.B. unheilbare Krankheiten), der Einfluss psychosomatischer Störungen, die Rolle von Technologie und Wirtschaft in der Medizin, sowie Leib-Seele-Problematik und die Anwendung von Konzepten wie Psychoneuroimmunologie und Psychosomatik.
Welche Kapitel umfasst das Dokument und worum geht es in jedem Kapitel?
Das Dokument ist in fünf Hauptkapitel gegliedert:
- A. Einleitung: Einführung in das Thema und die Bedeutung eines ganzheitlichen Ansatzes.
- B. Kontext der Arzt-Patienten-Beziehung: Gesellschaftliche und naturwissenschaftliche Rahmenbedingungen, Gesundheitsdefinition, Technologieeinfluss, Leib-Seele-Problematik, Psychoneuroimmunologie und Psychosomatik.
- C. Psychologie der Arzt-Patienten-Beziehung: Tiefenpsychologische Perspektive, Setting, Elemente der Arzt-Patienten-Beziehung, Abwehrmechanismen der ärztlichen Seite.
- D. Schwierigkeiten der Arzt-Patienten-Beziehung am konkreten Beispiel: Grenzsituationen, psychosomatische Störungen, ausgewählte Erkrankungen, Gefahr der Entfremdung des Arztes.
- E. Zusammenfassung und Ausblick: Zusammenfassung der Ergebnisse und Ausblick auf zukünftige Forschung.
Welche Zielsetzung verfolgt das Dokument?
Das Dokument zielt darauf ab, ein umfassenderes Verständnis der Arzt-Patienten-Beziehung zu schaffen, indem es aktuelle Forschungsergebnisse aus verschiedenen Disziplinen zusammenführt und die komplexe Interaktion zwischen Arzt und Patient aus einer interdisziplinären Perspektive beleuchtet. Der Fokus liegt dabei auf dem psychologischen Aspekt.
Welche Schlüsselbegriffe sind im Dokument relevant?
Schlüsselbegriffe sind unter anderem: Arzt-Patienten-Beziehung, Psychologie, Medizin, Soziologie, Gesundheit, Krankheit, Psychosomatik, Psychoneuroimmunologie, Übertragung, Gegenübertragung, Kommunikation, Grenzsituationen, Leib-Seele-Problematik, gesellschaftliche Rahmenbedingungen.
- Quote paper
- Thorsten Kerbs (Author), 2001, Das Arzt-Patienten-Verhältnis - Eine Literaturstudie zu den psychologischen Implikationen eines unterschätzten Beziehungsproblems, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/3082