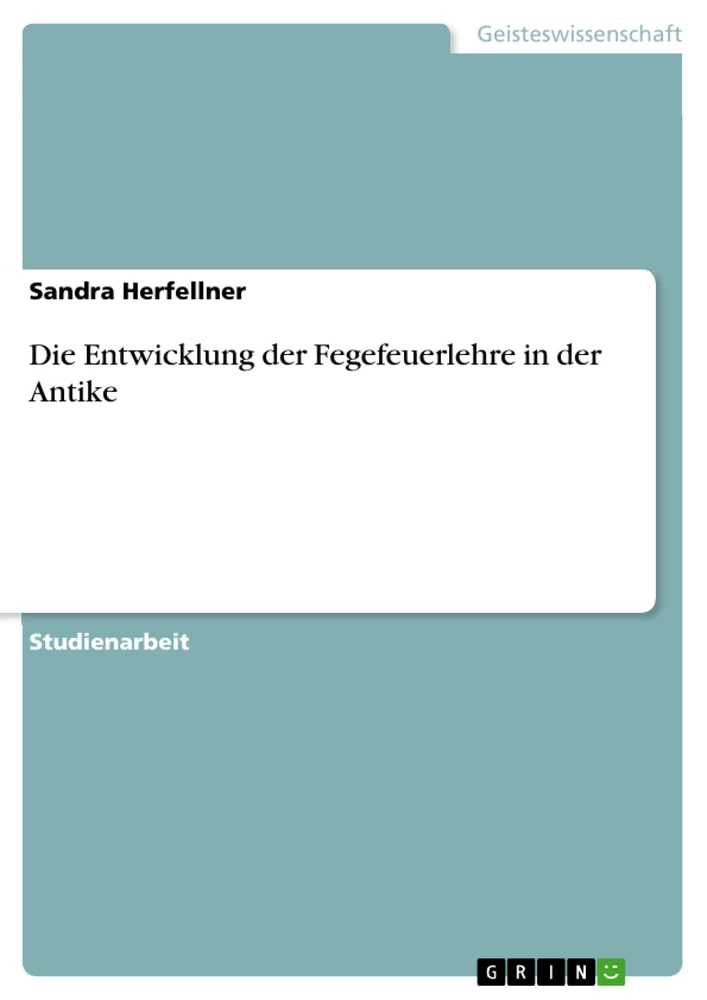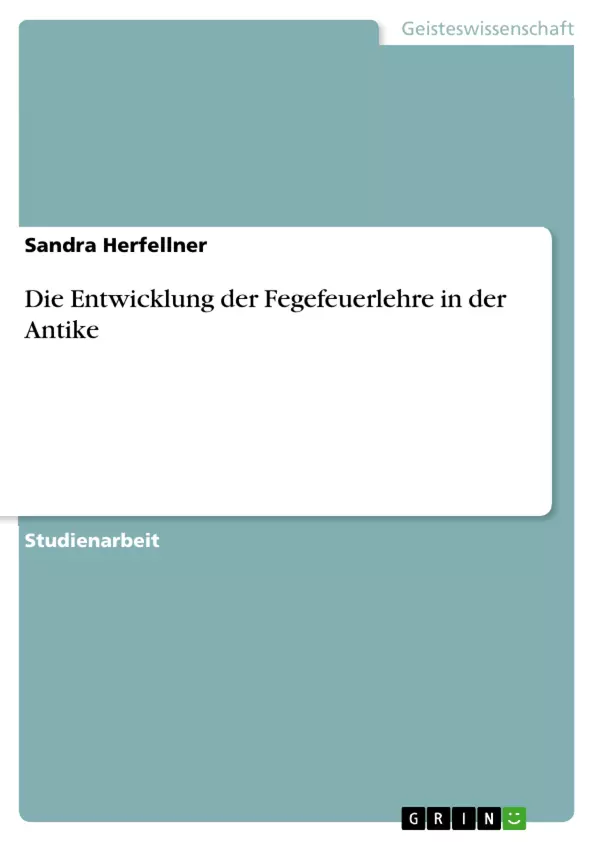Was geschieht mit uns nach dem Tod? Gibt es ein Weiterleben danach, und wenn ja, wie können wir uns ein solches vorstellen? Werden wir nach dem Tod für unsere Sünden zur Rechenschaft gezogen? Diese Fragen beschäftigen den modernen Menschen mit Sicherheit genauso, wie den Menschen vor 2000 Jahren. Jedoch ist der heutige Mensch mit einer Vielzahl von möglichen Antworten konfrontiert und wählt sich aus diesen die für ihn zugänglichste aus.
Die Antworten, die wir für uns selbst auf diese Fragen finden, sind allerdings mit großer Wahrscheinlichkeit von unseren Wünschen oder auch Ängsten beeinflusst. Den Gedanken, dass es kein Fortleben unserer Seele nach dem Tod gibt und dass danach alles aus ist, können die meisten Menschen nicht ertragen und die Vorstellung, dass es nach dem Tod so etwas wie ein Gericht gibt, rührt auch daher, dass die Menschen eine Motivation für moralisch bzw. ethisch richtiges Handeln suchen. Wenn gute Taten ohne Lohn blieben und schlechte Taten nicht bestraft würden, welchen Grund hätte der Mensch dann noch, Gutes zu tun? Zwar drängt das Gewissen des Menschen nach Ansicht des Psychoanalytikers Carl Gustav Jung von Natur aus auf das Gute hin, trotzdem wünscht sich der Mensch eine Belohnung, denn der richtige Weg ist auch oft der schwierigere.
Wenn es allerdings zu diesem Gericht kommt, haben die meisten Menschen bestimmt Schwierigkeiten, sich eindeutig einer Seite (Himmel oder Hölle, wenn man so will) zuzuordnen, denn auch der grundsätzlich gute Mensch hat in seinem Leben Fehler gemacht und Sünden begangen. Dieser Mensch fühlt sich, so wie er ist, dann vielleicht noch nicht bereit, Gott mit all seinen Fehlern und Schwächen gegenüber zu treten oder in eine Gemeinschaft mit ihm einzugehen. Es muss also noch etwas geben, was uns nach dem Tod bereit für Gott macht. So könnte man aus heutiger Sicht die Vorstellung eines Reinigungsortes oder Fegefeuers erklären.
Der Gedanke an das Fegefeuer lässt in uns allerdings oft sofort grausame Bilder von Feuer, Schmerzen und Qualen aufblitzen, obwohl uns unser Verstand gleichzeitig sagt, dass diese Vorstellungen veraltet sind. Doch obwohl uns die zum Teil mythisch beeinflussten Unterweltsvorstellungen heute befremdlich erscheinen, sind solche Ideen auf irgendeine Weise in uns verankert und stellen immer noch ein Thema dar. Deshalb ist es interessant, zu hinterfragen, wie diese Ideen überhaupt entstanden sind. Darauf soll in der folgenden Arbeit eingegangen werden.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Die Eingliederung der Fegefeuertheorie in den biblischen Glauben
- Der Begriff „Fegefeuer“
- Der erste Keim der Fegefeuerlehre in den Visionsberichten der Märtyrerin Perpetua
- Der geschichtliche Hintergrund
- Die Dinocrates-Visionen
- Die psycho-analytische Deutung
- Die taufkatechetische Deutung
- Ist der Aufenthaltsort des Dinocrates das Purgatorium?
- Unterbewusste Beeinflussung durch heidnisch und christlich geprägte Bilder
- Tertullians Vorstellungen von den Geschehnissen nach dem Tod
- Zur Person des Tertullian
- Tertullians Vorstellungen über die Geschichte der ganzen Menschheit
- Tertullians Vorstellung über die Geschichte des Einzelnen
- Cyprians Vorstellungen von einem Reinigungsort
- Zur Person des Cyprian
- Cyprians Theorie entsteht aus einer \"psychologische[n] und apologetische[n] Notwendigkeit” heraus
- Das Schicksal der Toten bei Cyprian
- Cyprians Einstellung zum Umgang mit den Lapsi und die damit verbundene innerkirchliche Diskussion
- Ep 55,20
- Die Vollendung des Menschen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit untersucht die psychologische Notwendigkeit der Fegefeuerlehre aus heutiger Sicht. Ziel ist es, die historische Entwicklung der Fegefeuervorstellung nachzuvollziehen und zu analysieren, welche psychologischen Bedürfnisse diese Lehre in der Vergangenheit und Gegenwart befriedigte und befriedigt.
- Die historische Entwicklung der Fegefeuerlehre
- Psychologische Bedürfnisse und ihre Verbindung zur Fegefeuerlehre
- Die Bedeutung von Visionen und Unterweltsvorstellungen in der Geschichte der Fegefeuerlehre
- Die Rolle der Kirche in der Entwicklung und Verbreitung der Fegefeuerlehre
- Die aktuelle Relevanz der Fegefeuerlehre in der modernen Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Das erste Kapitel beschäftigt sich mit der Einordnung der Fegefeuertheorie in den biblischen Glauben und stellt die Frage, ob sie bereits in der Bibel zu finden ist. Das zweite Kapitel widmet sich dem Begriff „Fegefeuer“ selbst und beleuchtet seine etymologische Herkunft sowie seine Bedeutung im christlichen Kontext. Das dritte Kapitel analysiert die ersten Spuren der Fegefeuerlehre in den Visionsberichten der Märtyrerin Perpetua. Es untersucht die historischen Hintergründe ihrer Visionen, ihre psychoanalytische Deutung und ihre taufkatechetische Bedeutung. Darüber hinaus wird die Frage gestellt, ob der Ort, an dem sich Perpetuas Bruder in ihren Visionen befindet, mit dem Purgatorium gleichzusetzen ist.
Schlüsselwörter (Keywords)
Fegefeuer, Purgatorium, psychologische Notwendigkeit, Visionen, Perpetua, Tertullian, Cyprian, christlicher Glaube, Unterweltsvorstellungen, heidnische Einflüsse, Taufkatechese, Reinigungsort, Seelenheil, Seelenleitung, Sündenvergebung, Seelenfrieden.
Häufig gestellte Fragen
Welches psychologische Bedürfnis befriedigt die Fegefeuerlehre?
Den Wunsch nach Gerechtigkeit und einer „Vorbereitung“ auf Gott, da sich viele Menschen nach dem Tod weder rein gut noch rein schlecht fühlen.
Was sind die „Dinocrates-Visionen“ der Perpetua?
Ein früher Visionsbericht der Märtyrerin Perpetua über ihren verstorbenen Bruder, der als einer der ersten „Keime“ der Fegefeuerlehre gilt.
Welche Rolle spielten Tertullian und Cyprian für die Lehre?
Sie entwickelten frühe Vorstellungen über Reinigungsorte und das Schicksal der Seele nach dem Tod aus apologetischen und seelsorgerischen Notwendigkeiten.
Gibt es biblische Grundlagen für das Fegefeuer?
Die Arbeit untersucht die Eingliederung der Theorie in den biblischen Glauben und prüft, wie spätere Interpretationen an biblische Texte anknüpften.
Warum wirken Unterweltsvorstellungen heute oft befremdlich?
Weil sie stark von mythischen Bildern geprägt sind (Feuer, Qualen), die zwar tief in uns verankert sind, aber oft im Konflikt mit modernem rationalem Denken stehen.
- Citar trabajo
- Dr. phil Sandra Herfellner (Autor), 2008, Die Entwicklung der Fegefeuerlehre in der Antike, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/308436