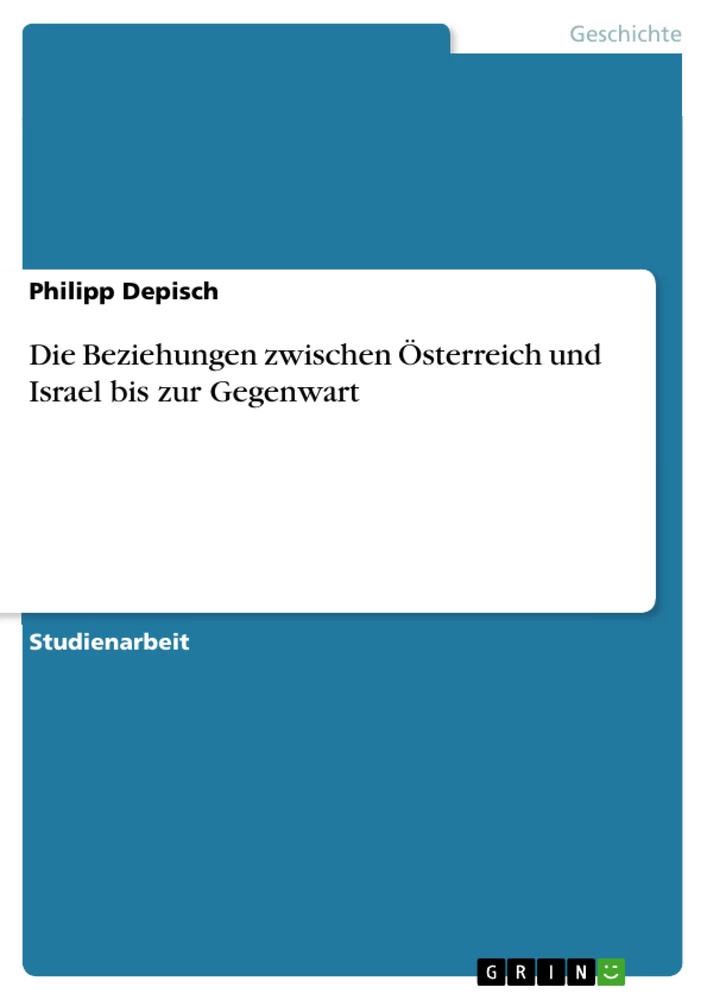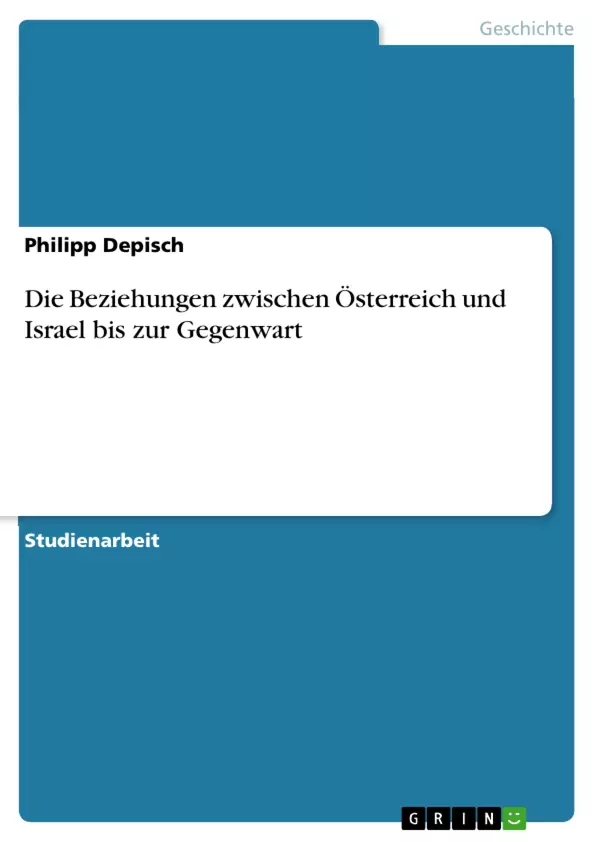Diese Proseminararbeit behandelt das Österreichisch-Israelische Verhältnis von Beginn der jüdischen Auswanderungsbewegung in den 1930ern bis ins Jahr 2000. Die verschiedenen Jahrzehnte werden beleuchtet und die graduelle Entwicklung hin zu einer schlechteren Beziehung zwischen den beiden Ländern wird deutlich gemacht und mit Erklärungsansätzen versehen.
Inhaltsverzeichnis
- Die Jahre bis 1955
- 1955-1970
- Die Ära Kreisky
- Die Schönauaffäre
- Der Libanonkrieg...
- 1983-2000
- Die Bildung der österreichischen Bundesregierung Februar 2000
- Österreichische Juden in Israel
- Anmerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung der Beziehungen zwischen Österreich und Israel vom Ende des Zweiten Weltkriegs bis in die 1970er Jahre. Der Fokus liegt auf den politischen und diplomatischen Herausforderungen, die sich aus der Vergangenheit Österreichs, der Gründung Israels und dem Nahostkonflikt ergaben. Die Arbeit beleuchtet die Rolle Österreichs bei der jüdischen Auswanderung nach Israel und analysiert bedeutende Ereignisse, die diese Beziehungen prägten.
- Die Geschichte der österreichisch-israelischen Beziehungen nach 1945
- Die Rolle Österreichs bei der jüdischen Auswanderung
- Die Wiedergutmachungspolitik Österreichs
- Die Schönauaffäre und ihre Auswirkungen
- Österreichs Position im Nahostkonflikt
Zusammenfassung der Kapitel
Die Jahre bis 1955: Die Geschichte der österreichisch-israelischen Beziehungen beginnt mit Theodor Herzls Vision eines jüdischen Staates. Bereits im 19. Jahrhundert wanderten österreichische Juden nach Palästina aus, verstärkt nach dem Anschluss 1938. Die österreichischen Juden im britischen Mandatsgebiet Palästina hatten im Gegensatz zu den deutschen Juden zunächst keine eigene Lobby und kämpften gegen Briten, Araber und Nationalsozialismus. Nach der Staatsgründung Israels 1948 bemühte sich Israel um Wiedergutmachung und die Verfolgung von NS-Verbrechern, wobei auch die mangelnde Kooperation Österreichs kritisiert wurde. Die Anerkennung Israels durch Österreich erfolgte 1952, gefolgt von der Errichtung einer Botschaft 1955 und dem österreichischen Staatsvertrag, der auch den "Opferstatus" Österreichs beinhaltete.
1955-1970: Die Beziehungen zwischen Österreich und Israel erreichten in den Jahren der Regierung unter Bundeskanzler Josef Klaus ihren positiven Höhepunkt. Obwohl Kritik an der Wiedergutmachungspolitik weiterhin bestand, entspannten sich die Beziehungen deutlich. Fußballspiele zwischen den Nationalmannschaften sollten die Freundschaft symbolisieren. 1963 wurde die „Österreichisch-Israelische Gesellschaft“ gegründet. Der Sechs-Tage-Krieg 1967 führte zu einer Israeleuphorie in Österreich, mit Demonstrationen und Unterstützung Israels auch von unerwarteter Seite.
Die Ära Kreisky: Bruno Kreisky war seit den 1950er Jahren mit der jüdischen Auswanderung nach Israel befasst. Als Bundeskanzler ab 1970 spielte er eine aktive Rolle im Nahostfriedensprozess. Die Schönauaffäre, die Geiselnahme jüdischer Auswanderer 1973, stellt einen Wendepunkt dar. Kreiskys Entscheidung, Schönau zu schließen, um die Geiseln freizubekommen, löste internationale Proteste aus. Er bot stattdessen die Kaserne in Wöllersdorf als Transitlager an, was mehr Mitspracherecht für Österreich bedeutete. Trotz der Kritik an seiner Entscheidung setzte die Auswanderung über Österreich fort, und Kreisky engagierte sich verstärkt im Nahostkonflikt, suchte sogar den Dialog mit der PLO.
Schlüsselwörter
Österreich-Israel Beziehungen, Jüdische Auswanderung, Wiedergutmachung, Nahostkonflikt, Schönauaffäre, Bruno Kreisky, Theodor Herzl, Sechs-Tage-Krieg, Zionismus, Palästinenserproblem.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Österreich-Israel Beziehungen
Was behandelt der Text allgemein?
Der Text bietet einen umfassenden Überblick über die Entwicklung der Beziehungen zwischen Österreich und Israel vom Ende des Zweiten Weltkriegs bis in die 1970er Jahre. Der Fokus liegt auf den politischen und diplomatischen Herausforderungen, die sich aus der Vergangenheit Österreichs, der Gründung Israels und dem Nahostkonflikt ergaben. Besonderes Augenmerk wird auf die Rolle Österreichs bei der jüdischen Auswanderung nach Israel und bedeutende Ereignisse gelegt, die diese Beziehungen prägten.
Welche Zeiträume werden im Text behandelt?
Der Text gliedert sich in verschiedene Zeitabschnitte: die Jahre bis 1955, 1955-1970, die Ära Kreisky (mit Fokus auf die Schönauaffäre und den Libanonkrieg), 1983-2000, die Bildung der österreichischen Bundesregierung im Februar 2000 und die Situation österreichischer Juden in Israel. Der Schwerpunkt liegt jedoch auf der Zeit bis in die 1970er Jahre.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die wichtigsten Themen sind die Geschichte der österreichisch-israelischen Beziehungen nach 1945, die Rolle Österreichs bei der jüdischen Auswanderung, die Wiedergutmachungspolitik Österreichs, die Schönauaffäre und ihre Auswirkungen sowie Österreichs Position im Nahostkonflikt.
Was ist über die Jahre bis 1955 zu erfahren?
Dieser Abschnitt behandelt die Anfänge der österreichisch-israelischen Beziehungen, beginnend mit Herzls Vision eines jüdischen Staates und der Auswanderung österreichischer Juden nach Palästina, verstärkt nach dem Anschluss 1938. Er beschreibt die Schwierigkeiten österreichischer Juden im britischen Mandatsgebiet, die Anerkennung Israels durch Österreich 1952, die Errichtung einer Botschaft 1955 und den österreichischen Staatsvertrag mit seinem "Opferstatus" Österreichs.
Was sind die zentralen Ereignisse im Zeitraum 1955-1970?
In dieser Phase erreichten die Beziehungen ihren positiven Höhepunkt unter Bundeskanzler Josef Klaus. Trotz anhaltender Kritik an der Wiedergutmachungspolitik entspannten sich die Beziehungen deutlich. Die Gründung der „Österreichisch-Israelischen Gesellschaft“ 1963 und die Israeleuphorie nach dem Sechs-Tage-Krieg 1967 werden hervorgehoben.
Welche Rolle spielte Bruno Kreisky?
Bruno Kreisky war schon vor seiner Kanzlerschaft mit der jüdischen Auswanderung befasst. Als Bundeskanzler ab 1970 spielte er eine aktive Rolle im Nahostfriedensprozess. Die Schönauaffäre (Geiselnahme jüdischer Auswanderer 1973) stellt einen Wendepunkt dar. Seine Entscheidung, Schönau zu schließen, löste Proteste aus, aber die Auswanderung setzte über Wöllersdorf fort. Kreisky engagierte sich verstärkt im Nahostkonflikt und suchte den Dialog mit der PLO.
Was war die Schönauaffäre?
Die Schönauaffäre war eine Geiselnahme jüdischer Auswanderer im Jahr 1973. Die darauf folgende Entscheidung Kreiskys, das Transitlager Schönau zu schließen, um die Geiseln freizubekommen, löste internationale Proteste aus und hatte weitreichende Folgen für die österreichisch-israelischen Beziehungen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Text?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Österreich-Israel Beziehungen, Jüdische Auswanderung, Wiedergutmachung, Nahostkonflikt, Schönauaffäre, Bruno Kreisky, Theodor Herzl, Sechs-Tage-Krieg, Zionismus, Palästinenserproblem.
- Quote paper
- Dr. Philipp Depisch (Author), 2000, Die Beziehungen zwischen Österreich und Israel bis zur Gegenwart, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/308678