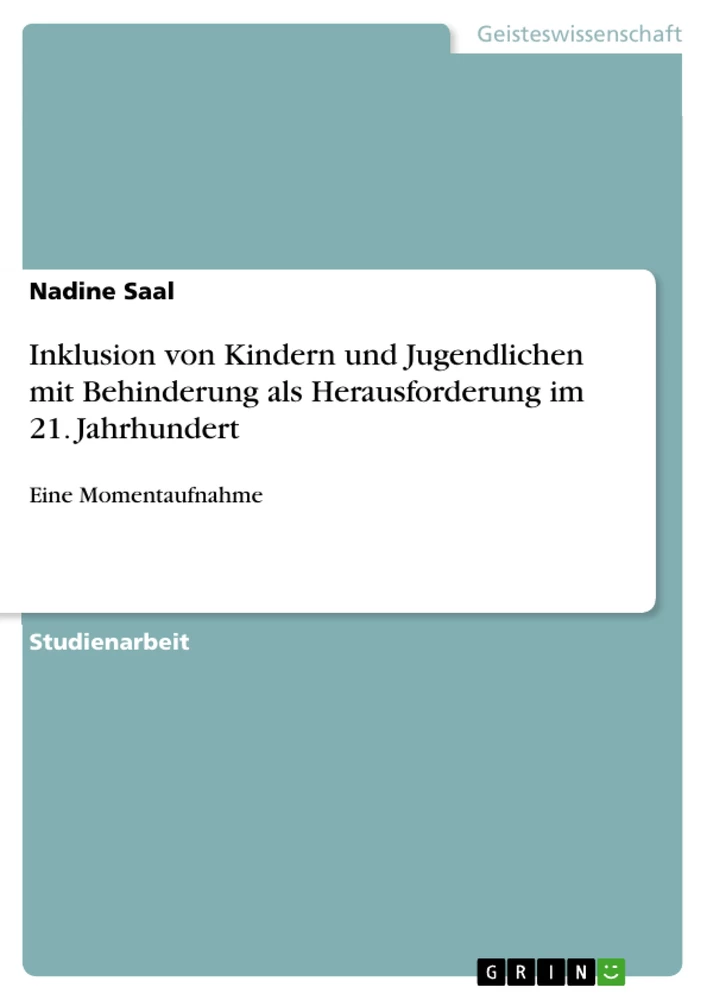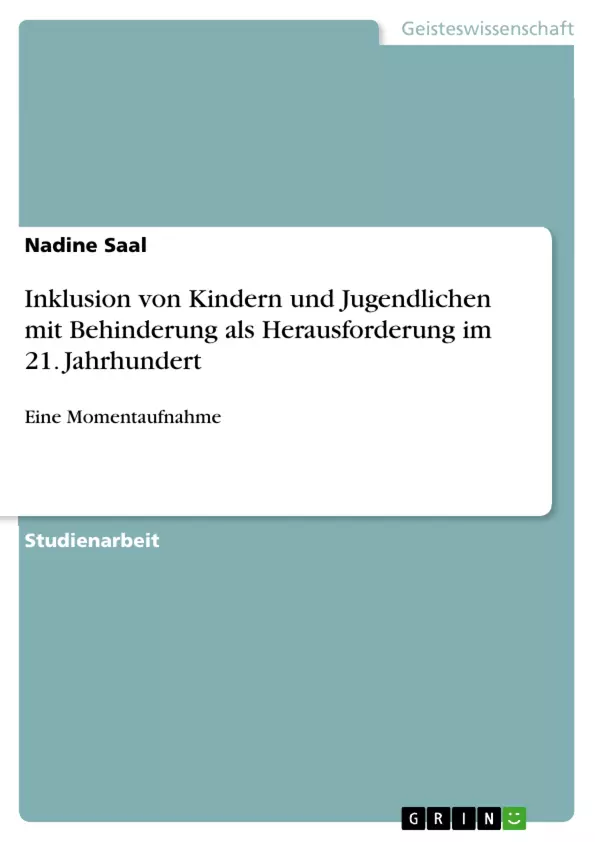Menschen mit Behinderungen, besonders Kinder und Jugendliche haben es in unserer Gesellschaft nicht einfach. Sei es das Lernen in Sonderschulen, oder der normale Lebensalltag – oftmals werden Kinder und Jugendliche mit Behinderung ausgegrenzt. Um solche Benachteiligungen und Barrieren zu verhindern beziehungsweise zu reduzieren, bedarf es an umfassenden Umdenkungsprozessen und Projekten, die dazu beitragen, dass alle Kinder und Jugendliche mit Behinderung in unserer Gesellschaft akzeptiert und vor allem integriert werden. Aus diesem Kontext heraus lässt sich folgende Forschungsfrage ableiten: „Wie ist bislang die Inklusion in Österreich bei Kindern und Jugendlichen mit Behinderung realisiert worden?“
Diese Seminarfacharbeit ist in drei wesentlichen Bestandteilen aufgebaut. Zu Beginn wird der Schwerpunkt auf die Begriffserklärung, als auch auf die Ursachen, Arten und den Auswirkungen von Behinderung gelegt. In weiterer Folge wird sich mit dem Thema der Inklusion auseinandergesetzt. Die Inhalte, wie beispielsweise die Ziele der Inklusion, spielen dabei eine wesentliche Rolle. Abschließend wird die Realisierung und Umsetzung von Inklusion bei Kinder und Jugendlichen innerhalb Österreichs als Momentaufnahme dargestellt.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Behinderung
- Definition
- Ursachen, Arten und Auswirkungen von Behinderung
- Physische Behinderung
- Psychische/ Seelische Behinderung
- Geistige Behinderung
- Inklusion
- Definition und Konzept von Inklusion
- Das Ziel der Inklusion
- UN-Behindertenrechtskonvention
- Die Realisierung und Umsetzung von Inklusion in Österreich - eine Momentaufnahme
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Seminarfacharbeit befasst sich mit der Inklusion von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen in Österreich. Sie untersucht die aktuelle Situation und analysiert, wie die Inklusion bislang realisiert wurde.
- Begriffserklärung und Definition von Behinderung
- Ursachen, Arten und Auswirkungen von Behinderung
- Definition und Konzept von Inklusion
- Ziele der Inklusion und die UN-Behindertenrechtskonvention
- Die Umsetzung von Inklusion in Österreich
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Das erste Kapitel der Arbeit beleuchtet die Bedeutung von Behinderung. Es werden verschiedene Definitionen vorgestellt und die Ursachen, Arten und Auswirkungen von Behinderung im Detail analysiert. Die drei wichtigsten Kategorien - physische, psychische und geistige Behinderung - werden im Detail besprochen.
Im zweiten Kapitel wird das Konzept der Inklusion erläutert. Die Arbeit geht auf die Definition und die Ziele der Inklusion ein. Die Bedeutung der UN-Behindertenrechtskonvention wird in diesem Zusammenhang hervorgehoben.
Das dritte Kapitel analysiert die aktuelle Situation der Inklusion in Österreich. Es werden die Herausforderungen und Erfolge der Inklusionspolitik beleuchtet.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind Behinderung, Inklusion, Integration, UN-Behindertenrechtskonvention, Österreich, Kinder und Jugendliche, Bildung, Teilhabe, Barrierefreiheit, Lebensqualität.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird Inklusion in Österreich aktuell umgesetzt?
Die Arbeit bietet eine Momentaufnahme der Realisierung von Inklusion bei Kindern und Jugendlichen und analysiert bestehende Barrieren und Fortschritte.
Welche Arten von Behinderungen werden unterschieden?
Es wird zwischen physischen (körperlichen), psychischen (seelischen) und geistigen Behinderungen differenziert.
Was ist das Hauptziel der Inklusion?
Ziel ist die volle gesellschaftliche Akzeptanz und Teilhabe, sodass Kinder mit Behinderung nicht ausgegrenzt, sondern als selbstverständlicher Teil der Gesellschaft integriert werden.
Welche Bedeutung hat die UN-Behindertenrechtskonvention?
Sie bildet den völkerrechtlichen Rahmen, der die Vertragsstaaten verpflichtet, Inklusion und Barrierefreiheit rechtlich und praktisch umzusetzen.
Warum ist ein Umdenkungsprozess in der Gesellschaft notwendig?
Um Benachteiligungen abzubauen, müssen Vorurteile überwunden und Strukturen (wie Sonderschulen) kritisch hinterfragt werden.
- Arbeit zitieren
- Nadine Saal (Autor:in), 2015, Inklusion von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung als Herausforderung im 21. Jahrhundert, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/308788