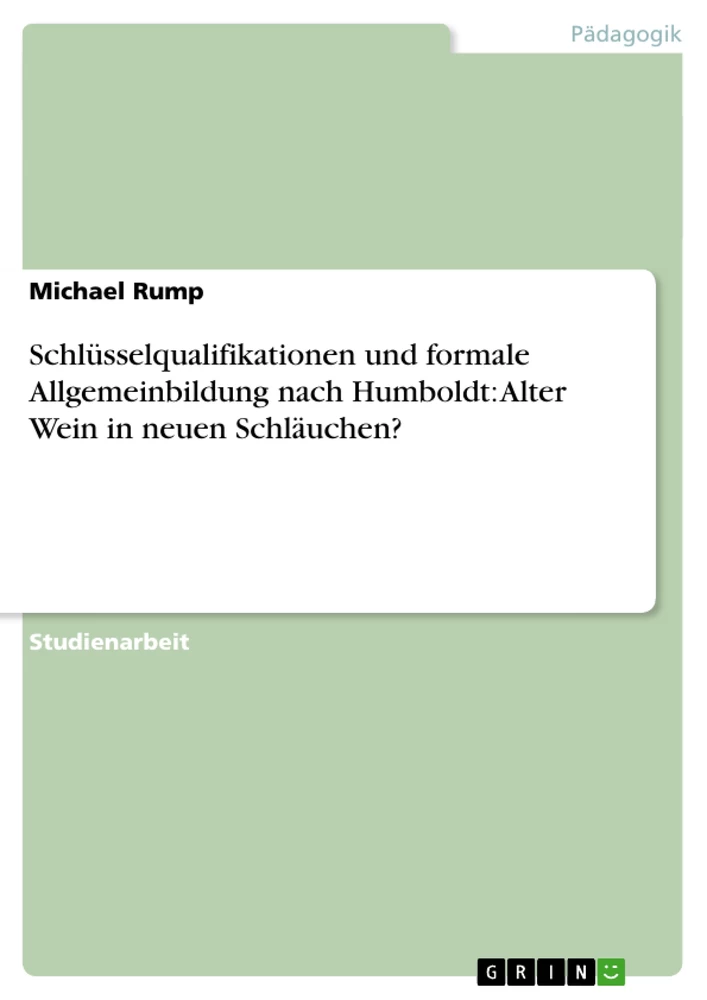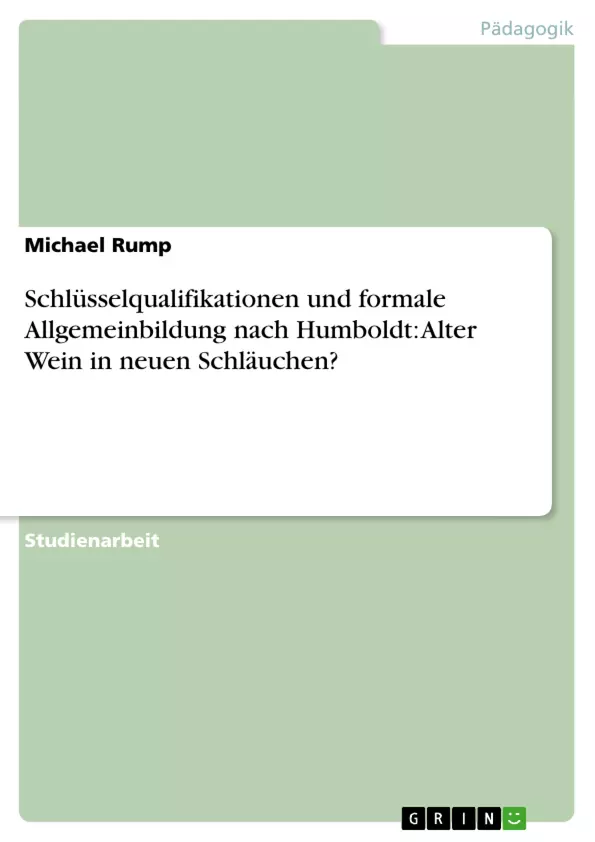Problemstellung
Betrachtet man die berufs- und wirtschaftspädagogische Diskussion um die Schlüsselqualifikationen, so wird oftmals darauf verwiesen, dass das Konzept der Schlüsselqualifikationen auf einer formalen Bildungstheorie basiere und die formale Allgemeinbildung1 eine Renaissance erlebe. So schreibt beispielsweise Beck: „Die geschichtliche Tradition der Schlüsselqualifikationen liegt eindeutig in den formalen Bildungstheorien.“ (Beck 2001, S.38). Dörig meint: „Der Anspruch der Schlüsselqualifikationsvertreter, Bildung und Erziehung auf wenig konzentrierte, situationsgerecht immer wieder neu generierbare und kombinierbare Fähigkeiten und Fertigkeiten zu reduzieren, beruht auf einem Verständnis von Formalbildung.“ (Dörig 1996, S.81). Arnold und Müller gehen davon aus, „dass das Konzept der Schlüsselqualifikationen sich aufgrund seiner formalen Struktur direkt zu der seit dem 18.-Jahrhundert geführten bildungstheoretischen Diskussion um die Theorie der formalen Bildung in Beziehung setzen lässt.“ (Arnold/Müller 2002, S.7). In ihrem „Handbuch der Berufsbildung“ schreiben Arnold und Lipsmeier schließlich, der Ansatz der Schlüsselqualifikationen sei „in gewisser Weise eine neue Variante von ‚Allgemeinbildung’, insofern zwar auf die berufliche Bildung [...] keineswegs verzichtet wird, aber darüber hinaus weitere Fähigkeiten, Orientierungs- und Sozialkompetenzen vermittelt werden sollen, die über die spezifische Arbeitsplatzbedingen hinaus und sogar in der sozialen Lebenswelt ganz allgemein von Bedeutung sind.“ (Arnold/Lipsmeier 1995, S.22). Sucht man jedoch nach Begründungen und weiterführenden Erläuterungen für die These, das Schlüsselqualifikationskonzept basiere auf einer formalen Bildungstheorie und sei letztlich klassische formale Allgemeinbildung in modernen Gewande, so wird man nicht oder nur unzufriedenstellend fündig. Diese These wird in der Literatur meist einleitend in den Raum gestellt, jedoch nicht weiter ausgeführt. Somit drängt sich ein direkter Vergleich des Konzeptes einer formalen Allgemeinbildung und der Schlüsselqualifikation geradezu auf, Zum einen wird die formale Bildung von der materialen Bildung abgegrenzt: Unter „materialer“ Bildung wird die Aneignung bestimmter Bildungsinhalte, also Sach- oder Wissensbildung verstanden. „Formale“ Bildung hingegen meint, dass den Inhalten die Aufgabe zukommt, die geistigen Fähigkeiten der Bildenden herauszufordern und abzubilden...
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Aufbau der Arbeit und methodisches Vorgehen
- 2. Formale Allgemeinbildung
- 2.1 Genese des Konzeptes und historische Einordnung
- 2.2 Analyse der „Theorie der Bildung des Menschen“ von W. v. Humboldt (1794)
- 2.2.1 Definition/Begriffsverständnis
- 2.2.2 Begründungszusammenhänge
- 2.2.3 Lehr- und Lernformen
- 2.3 Zusammenfassung
- 3. Schlüsselqualifikationen
- 3.1 Genese des Konzeptes und historische Einordnung
- 3.2 Analyse des Schlüsselqualifikationskonzeptes von D. Mertens (1974)
- 3.2.1 Definition/Begriffsverständnis
- 3.2.2 Begründungszusammenhänge
- 3.2.3 Lehr- und Lernformen
- 3.3 Analyse des Schlüsselqualifikationskonzeptes von L. Reetz (1990)
- 3.3.1 Definition/Begriffsverständnis
- 3.3.2 Begründungszusammenhänge
- 3.3.3 Lehr- und Lernformen
- 3.4 Analyse des Schlüsselqualifikationskonzeptes von U. Laur-Ernst (1990)
- 3.4.1 Definition/Begriffsverständnis
- 3.4.2 Begründungszusammenhänge
- 3.4.3 Lehr- und Lernformen
- 3.5 Zusammenfassung
- 4. Gegenüberstellung und Vergleich
- 5. Fazit und Schlussfolgerungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit verfolgt das Ziel, das Konzept der Schlüsselqualifikationen mit dem Konzept der formalen Allgemeinbildung nach Humboldt zu vergleichen. Es soll untersucht werden, ob und inwiefern Schlüsselqualifikationen als moderne Variante der formalen Allgemeinbildung betrachtet werden können. Die Arbeit analysiert exemplarisch ausgewählte Ansätze beider Konzepte.
- Vergleich der Konzepte „formale Allgemeinbildung“ und „Schlüsselqualifikationen“
- Analyse der Bildungstheorie Wilhelm von Humboldts
- Untersuchung verschiedener Ansätze zum Konzept der Schlüsselqualifikationen
- Identifizierung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden beider Konzepte
- Bewertung der These, dass Schlüsselqualifikationen eine moderne Form der formalen Allgemeinbildung darstellen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Problemstellung dar: Die in der berufs- und wirtschaftspädagogischen Diskussion oft vertretene These, dass Schlüsselqualifikationen auf einer formalen Bildungstheorie basieren und die formale Allgemeinbildung eine Renaissance erlebt, wird kritisch hinterfragt. Der Mangel an fundierten Begründungen für diese These motiviert einen direkten Vergleich beider Konzepte. Die Arbeit skizziert den Aufbau und die Methodik, welche auf einer bildungstheoretischen Ebene mit empirischem Zugang (Inhaltsanalyse) basiert.
2. Formale Allgemeinbildung: Dieses Kapitel beleuchtet das Konzept der formalen Allgemeinbildung. Es untersucht die Genese und historische Einordnung des Begriffs, analysiert Humboldts „Theorie der Bildung des Menschen“ im Hinblick auf Definition, Begründungszusammenhänge und Lehr-Lernformen. Humboldts Fokus auf die Entfaltung innerer Kräfte und die Abgrenzung von materialer, auf Wissenserwerb gerichteter Bildung wird herausgestellt. Die Zusammenfassung fasst die zentralen Aspekte von Humboldts Bildungstheorie zusammen.
3. Schlüsselqualifikationen: Dieses Kapitel analysiert verschiedene Ansätze zum Konzept der Schlüsselqualifikationen. Es beginnt mit der Genese und der historischen Einordnung, bevor es auf die Konzepte von Mertens (als „Urkonzept“), Reetz und Laur-Ernst eingeht. Für jeden Ansatz werden Definition, Begründungszusammenhänge und Lehr-Lernformen untersucht. Der Fokus liegt auf dem „Mainstream“ der Schlüsselqualifikationsdebatte, alternative Ansätze werden aus Gründen der Fokussierung ausgeschlossen. Die Zusammenfassung integriert die zentralen Aspekte der verschiedenen Ansätze zu einem umfassenden Überblick.
Schlüsselwörter
Formale Allgemeinbildung, Schlüsselqualifikationen, Wilhelm von Humboldt, Bildungstheorie, Dieter Mertens, Lothar Reetz, Ute Laur-Ernst, Persönlichkeitsbildung, Lehr-Lernformen, Vergleichende Analyse.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument: Vergleich Formale Allgemeinbildung und Schlüsselqualifikationen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit vergleicht das Konzept der formalen Allgemeinbildung nach Humboldt mit dem Konzept der Schlüsselqualifikationen. Sie untersucht, ob und inwiefern Schlüsselqualifikationen als moderne Variante der formalen Allgemeinbildung betrachtet werden können. Die Arbeit analysiert dazu exemplarisch ausgewählte Ansätze beider Konzepte.
Welche Konzepte werden verglichen?
Der Vergleich konzentriert sich auf das Konzept der „formalen Allgemeinbildung“, insbesondere im Hinblick auf Wilhelm von Humboldts „Theorie der Bildung des Menschen“, und das Konzept der „Schlüsselqualifikationen“. Letzteres wird anhand der Ansätze von Mertens, Reetz und Laur-Ernst analysiert.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den beiden Konzepten aufzuzeigen und die These zu überprüfen, dass Schlüsselqualifikationen eine moderne Form der formalen Allgemeinbildung darstellen. Sie analysiert die Bildungstheorien, die Begründungszusammenhänge und die Lehr- und Lernformen beider Konzepte.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur formalen Allgemeinbildung (mit Fokus auf Humboldts Theorie), ein Kapitel zu Schlüsselqualifikationen (mit Analyse verschiedener Ansätze), ein Kapitel zum Vergleich beider Konzepte sowie ein Fazit mit Schlussfolgerungen. Die Methodik basiert auf einer bildungstheoretischen Ebene mit empirischem Zugang (Inhaltsanalyse).
Welche Autoren werden analysiert?
Die Arbeit analysiert im Detail die Bildungstheorie von Wilhelm von Humboldt und verschiedene Ansätze zum Konzept der Schlüsselqualifikationen von Dieter Mertens, Lothar Reetz und Ute Laur-Ernst.
Welche Aspekte der Konzepte werden untersucht?
Für jedes Konzept werden die Genese und historische Einordnung, die Definition/das Begriffsverständnis, die Begründungszusammenhänge und die Lehr- und Lernformen untersucht. Der Fokus liegt auf dem Vergleich der zentralen Aspekte und der Identifizierung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Schlussfolgerungen der Arbeit werden im Fazit präsentiert und bewerten die These, ob Schlüsselqualifikationen als moderne Form der formalen Allgemeinbildung betrachtet werden können. Die Arbeit hinterfragt die in der berufs- und wirtschaftspädagogischen Diskussion oft vertretene These, dass Schlüsselqualifikationen auf einer formalen Bildungstheorie basieren und die formale Allgemeinbildung eine Renaissance erlebt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Formale Allgemeinbildung, Schlüsselqualifikationen, Wilhelm von Humboldt, Bildungstheorie, Dieter Mertens, Lothar Reetz, Ute Laur-Ernst, Persönlichkeitsbildung, Lehr-Lernformen, Vergleichende Analyse.
- Citar trabajo
- Michael Rump (Autor), 2004, Schlüsselqualifikationen und formale Allgemeinbildung nach Humboldt: Alter Wein in neuen Schläuchen?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/31002