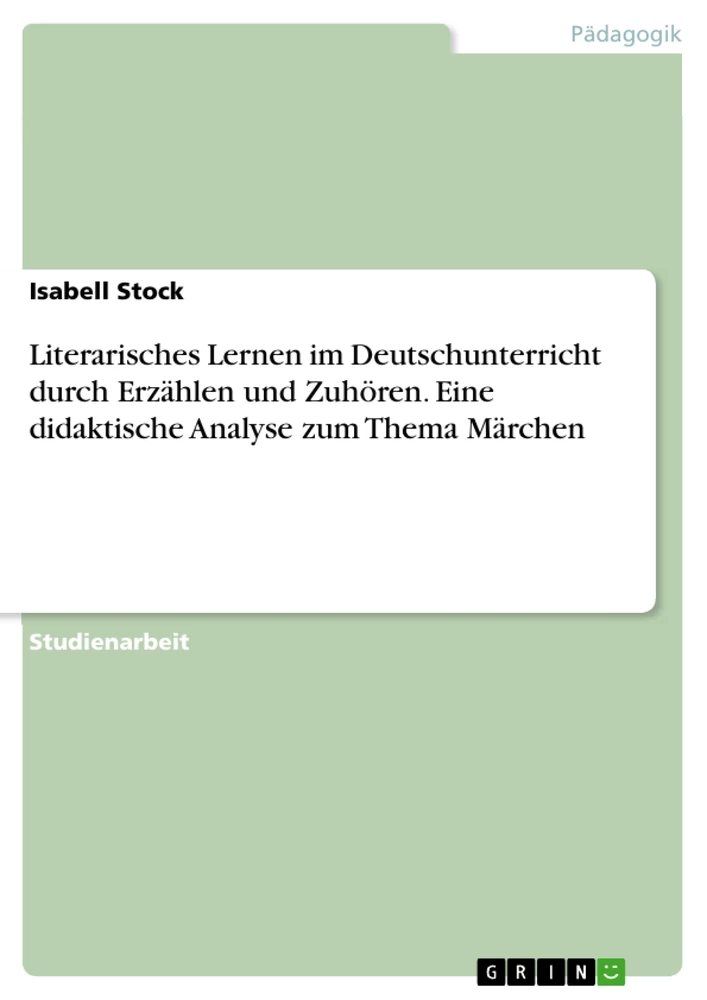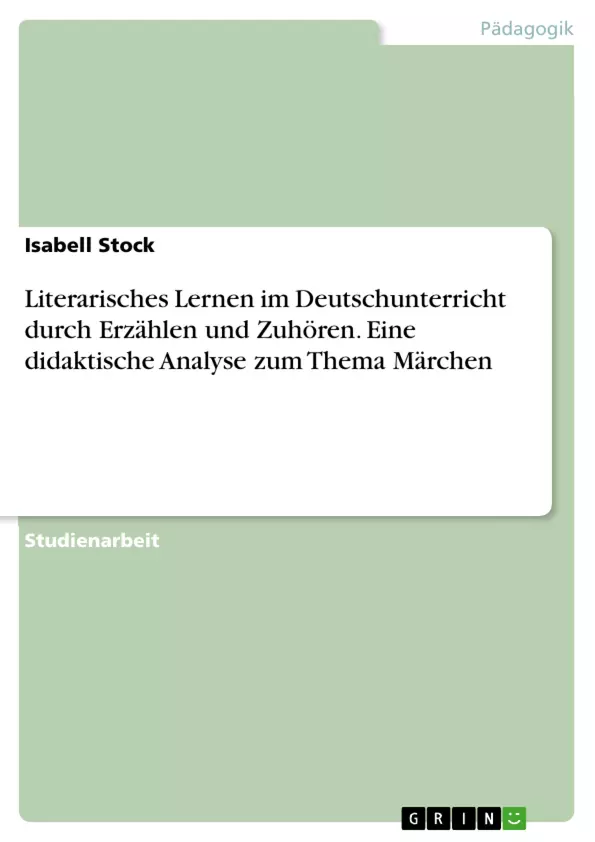Kinder erzählen sich tagtäglich fantasiereiche und lebendige Geschichten über Dinge, die in ihrem Leben passiert sind oder welche sie als wichtig empfinden. Damit ist die Sprechfreudigkeit gemeint, die unter bestimmten Gesprächsregeln und einer gelenkten Thematik erscheint, wo Sprecher und Hörer in einem an-gemessenen Rahmen miteinander ihre Gedanken verbalisieren. Dadurch werden nicht nur affektive, soziale und kognitive Lernziele gefördert, sondern auch die Kommunikationsfähigkeit, also die sogenannten „soft skills“ unserer Gesellschaft, werden geübt und bekommen einen hohen Stellenwert.
In der vorliegenden Arbeit wird der Begriff des Erzählens, also das literarische Lernen im Deutschunterricht anhand des exemplarisch gewählten Beispiels des Märchens thematisiert. Zunächst wird der Begriff des Erzählens, der bisherige Forschungsstand, sowie ein ausgewähltes Modell zum Erwerb der narrativen Strukturen in der Sachanalyse erläutert. Im zweiten Schritt folgt eine fachwissenschaftliche Eingrenzung zu der Thematik des Märchens, woraufhin eine didaktische Analyse konzipiert wird, bei der die Lernziele hinsichtlich des niedersächsischen Lehrplans im Zusammenhang mit Erzählen und Zuhören und den Umgang mit Märchen näher analysiert werden.
Daraufhin folgt die Planung einer möglichen Unterrichtseinheit für die dritte Klasse einer Grundschule. Die Unterrichtseinheit umfasst die Auseinandersetzung mit der literarischen Gattung der Märchen. In dieser sollen die Kinder erstmals Märchen selbst erfinden und sie sich dann gegenseitig erzählen, sodass sie den charakteristischen Aufbau, sowie deren Merkmale und Strukturen bereits optimal erfassen.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Sachanalyse
- Zum Begriff des Erzählens
- Erzählen und Zuhören
- Forschungsstand zu der Entwicklung der kohäsiven Fähigkeiten
- Erwerb von narrativen Strukturen
- Fachwissenschaftliche Grundlagen zum Thema Märchen
- Das Märchen: Unterscheidung in Volks- und Kunstmärchen
- Besondere Merkmale von Märchen
- Die Bedeutung von Märchen für Kinder
- Didaktische Analyse
- Allgemeines (Didaktische Reduktion, Einbettung der Stunde, Lerngruppe)
- Lernziele laut Lehrplan der niedersächsischen Grundschule
- Planung einer Unterrichtsstunde mit dem Thema „Mein Märchen - Dein Märchen“ (3. Klasse)
- Grob- und Feinziele
- Verlaufsplan
- Reflexion
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit befasst sich mit dem Thema des Erzählens im Deutschunterricht anhand von Märchen. Ziel ist es, den Begriff des Erzählens zu definieren, den Forschungsstand zu beleuchten und ein Modell zum Erwerb narrativer Strukturen zu präsentieren. Des Weiteren wird die Bedeutung von Märchen für Kinder beleuchtet und eine didaktische Analyse einer möglichen Unterrichtseinheit für die dritte Klasse durchgeführt.
- Der Begriff des Erzählens
- Forschungsstand zum Erwerb narrativer Fähigkeiten
- Die Bedeutung von Märchen für Kinder
- Didaktische Analyse einer Unterrichtseinheit zum Thema Märchen
- Planung einer Unterrichtsstunde mit dem Thema „Mein Märchen - Dein Märchen“
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung führt in die Thematik des Erzählens im Deutschunterricht ein und stellt die Relevanz des Themas für Kinder und den Unterricht heraus. Die Sachanalyse definiert den Begriff des Erzählens, differenziert zwischen „erzählen 1“ und „erzählen 2“ und beleuchtet den Forschungsstand zum Erwerb narrativer Fähigkeiten.
Die fachwissenschaftliche Analyse widmet sich dem Thema Märchen, erklärt die Unterscheidung zwischen Volks- und Kunstmärchen und erläutert die besonderen Merkmale von Märchen. Außerdem wird die Bedeutung von Märchen für Kinder hervorgehoben.
Die didaktische Analyse fokussiert auf die Planung einer Unterrichtseinheit zum Thema Märchen für die dritte Klasse. Hier werden die Lernziele im Hinblick auf den niedersächsischen Lehrplan und die Gestaltung der Unterrichtsstunde erläutert.
Schlüsselwörter (Keywords)
Erzählen, Narratives Lernen, Märchen, Volksmärchen, Kunstmärchen, Didaktik, Deutschunterricht, Kohäsive Fähigkeiten, Spracherwerb, Unterrichtsplanung, Lernziele, Grundschule.
- Quote paper
- Isabell Stock (Author), 2014, Literarisches Lernen im Deutschunterricht durch Erzählen und Zuhören. Eine didaktische Analyse zum Thema Märchen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/310046