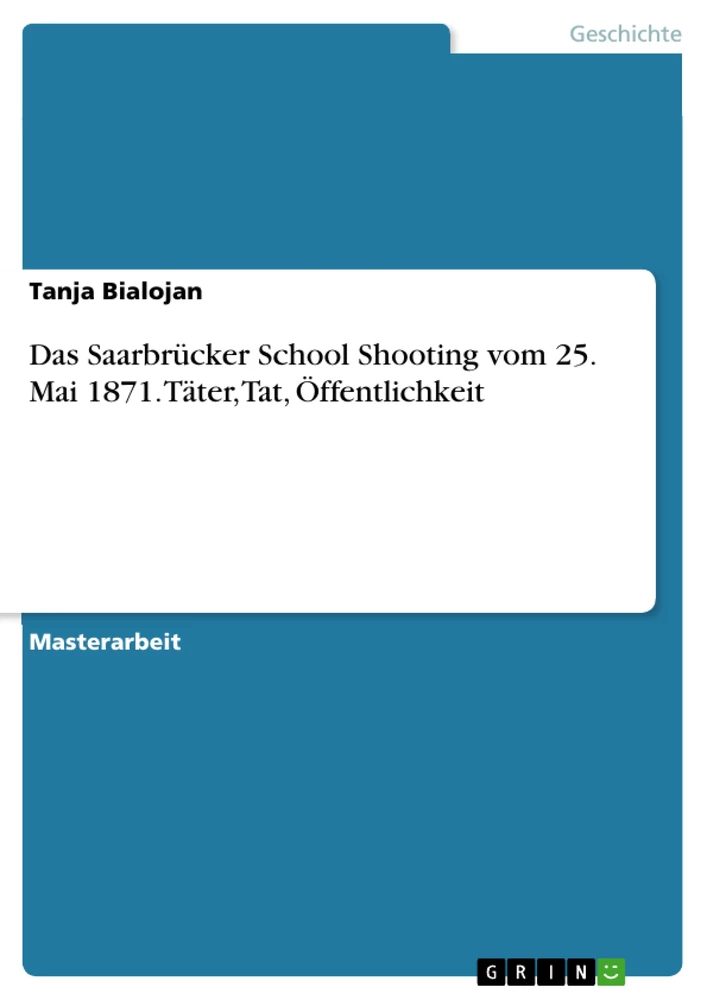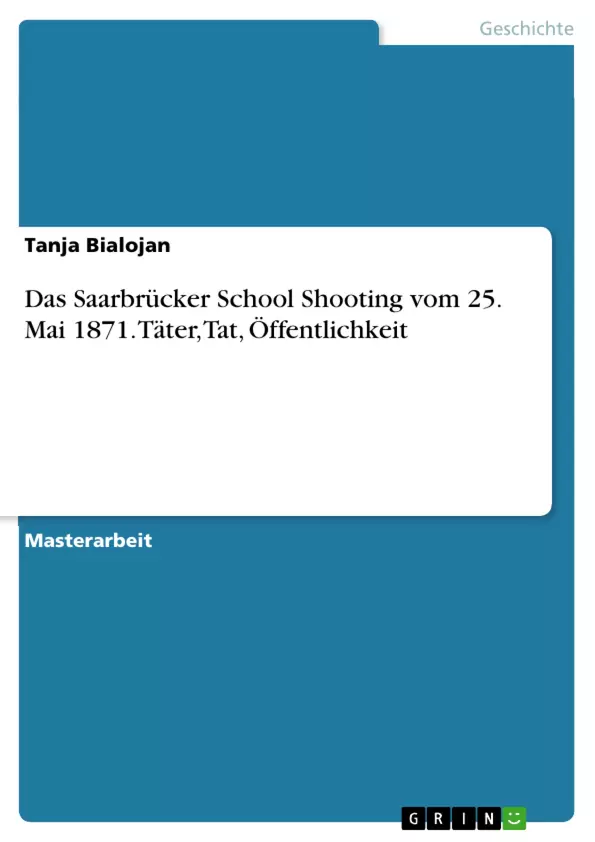Charlie Decker ist der 17-jährige Protagonist in Stephen Kings Roman „Amok“, der dem Phänomen School Shooting - einer Form schwerer, zielgerichteter Schulgewalt - ein fiktives, jedoch real nachvollziehbares Gesicht verleiht. Er erschießt zwei seiner Lehrer und hält seine Mathematikklasse für mehrere Stunden fest, wobei die Jugendlichen in einer Art Therapiestunde die Schwierigkeiten des Heranwachsens in einer amerikanischen Kleinstadt aufarbeiten und ihre inneren Wunden nach außen zu kehren scheinen. Decker lässt „die ganze Welt mit großem Lärm wissen“, dass er verletzt ist und es scheint, als wäre er nicht der Einzige.
Bevor King 1977 seinen Roman veröffentlichte, erschießen zwischen 1966 und 1975 fünf Schüler insgesamt neun Menschen und verwunden weitere 28 an US-amerikanischen und kanadischen Schulen. Decker schien somit zum fiktiven Gesicht eines nordamerikanischen Problems zu werden, das in Europa zum ersten Mal 1989 für Aufsehen sorgte, hier jedoch bis 1999 im Gegensatz zu den 79 nachgewiesenen nordamerikanischen Fällen nur insgesamt sieben Mal auftrat. Der Seltenheitswert, gerade auf europäischem Boden, machte tötungsintendierte Übergriffe von Jugendlichen im Schulkontext lange Zeit zu einem Phänomen nordamerikanischer Gewaltkultur. So wurde infolgedessen der Roman „Amok“ aufgrund öffentlicher Anschuldigungen in den 1990er Jahren von King aus dem Druck genommen. Der negative Vorbildcharakter war jedoch kein neuer Vorwurf.
Bereits 1871 hieß es in der Trierischen Volks-Zeitung:
„Americanische Schülerideen gedeihen auch mintunter auf deutschem Boden“, nachdem der 18-jährige Gymnasiast Julius Becker aus Saarbrücken am 25. Mai des Jahres zwei Mitschüler mit einem Taschenrevolver schwer verwundete. Der Duktus der Tat erscheint bekannt und doch hieß es in der bisherigen theoretischen Auseinandersetzung, dass es sich bei School Shootings um ein noch recht junges Phänomen schwerer zielgerichteter Schulgewalt handelt. War Becker demnach kein School Shooter, sondern ein regulärer Mörder? Wo liegt der Unterschied? Die Fragen, die sich im Zusammenhang mit einer historischen Untersuchung im Kontext der Schulamokforschung ergeben, stellen nicht nur aktuelle Erklärungsmuster für erschütternde Gewaltausbrüche in sicher geglaubten öffentlichen Institutionen auf die Probe. Sie eröffnen auch die Diskussion um den Mehrwert historischer Fallbeispiele für praxisorientierte Interventions- und Präventionsarbeit der Gegenwart. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. School Shooting - ein zeitloses Phänomen jugendlicher Gewaltausbrüche?
- 1.1. Forschungsinteresse und Leitfrage
- 1.2. Amokforschung mit Schwerpunkt School Shootings
- 1.2.1. Amerikanische und deutsche Schulamokforschung
- 1.2.2. Aufarbeitung des Falles Becker aus Saarbrücken
- 1.3. Quellenlage zum Fall Becker
- 1.4. Methodisches Vorgehen
- 2. Der Fall Becker: eine historische Einordnung
- 3. Täter: „hochfahrend und eingebildet, nicht aber verrückt“
- 3.1. Julius Becker aus Saarbrücken
- 3.2. Analyse Risikofaktoren
- 3.2.1. Individuell-biografische Faktoren
- 3.2.2. Individuell-schulische Faktoren
- 3.2.3. Waffenzugang
- 3.3. Erfahrungsgeschichte: Ein ‚harmloser Irrer‘?
- 3.4. Zwischenfazit
- 4. Tathergang: „frevelhafter“ Mordversuch oder School Shooting?
- 4.1. Ein Saarbrücker Mordversuch: „Wir stehen am Ende“
- 4.2. Warnung und Planung: Signale eines School Shootings
- 4.2.1. „Ich werde mich rächen“ - Tatankündigung: Leaking 1871
- 4.2.2. (K)ein Schema F - Tatverlauf damals und heute
- 4.2.3. Social Capital - Die legitimierte Blindheit von Gemeinschaften
- 4.3. Zwischenfazit
- 5. Öffentlichkeit: „Ein eben so seltsamer als bedauerlicher Vorfall“
- 5.1. Gerichtsverhandlung Saarbrücken
- 5.1.1. Assisenhof und Strafgesetzbuch
- 5.1.2. Zurechnungsfähigkeit Beckers
- 5.1.3. Öffentliches Interesse
- 5.2. Berichterstattung
- 5.2.1. Öffentliche Meinungsbildung
- 5.2.2. Aspekte der Singularität
- 5.3. „Schmerzliche Aufregung“: Ein öffentliches Trauma?
- 5.4. Zwischenfazit
- 6. School Shooting 1871 - ein historischer Nachweis
- 7. Bezeichnende Alternativen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Fall Julius Becker, einen Mordversuch an einem Saarbrücker Gymnasium im Jahr 1871, um zu klären, ob dieser nach heutigen Maßstäben als School Shooting einzustufen ist. Die historische Analyse soll den aktuellen Forschungsstand zur Schulamokforschung erweitern und den Mehrwert historischer Fallbeispiele für präventive Maßnahmen aufzeigen.
- Historische Einordnung von School Shootings
- Analyse von Risikofaktoren im Fall Becker
- Vergleich des Tathergangs mit aktuellen School Shootings
- Öffentliche Reaktionen und mediale Berichterstattung im historischen Kontext
- Bewertung des Falles Becker im Lichte der Schulamokforschung
Zusammenfassung der Kapitel
1. School Shooting - ein zeitloses Phänomen jugendlicher Gewaltausbrüche?: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über den Forschungsstand zu School Shootings, insbesondere in den USA und Deutschland. Es werden verschiedene Definitionen und Erklärungsansätze diskutiert, bevor die Leitfrage der Arbeit und die methodische Vorgehensweise vorgestellt werden. Der Fall Julius Becker wird als Ausgangspunkt für die Untersuchung der Frage nach der Zeitlosigkeit des Phänomens School Shooting eingeführt.
2. Der Fall Becker: eine historische Einordnung: Dieses Kapitel ordnet den Fall Becker historisch ein, indem es die politische, soziale und kulturelle Situation im Saarland im ausgehenden 19. Jahrhundert beschreibt. Es wird auf die Rolle Saarbrückens als preußische Kreisstadt und die Besonderheiten des bürgerlichen Bildungsanspruchs eingegangen, um den Kontext der Tat zu verstehen.
3. Täter: „hochfahrend und eingebildet, nicht aber verrückt“: Dieses Kapitel analysiert die Persönlichkeit Julius Beckers anhand biografischer Informationen und untersucht verschiedene Risikofaktoren aus der Schulamokforschung. Es werden seine familiäre Situation, seine Gesundheit und sein Verhalten im schulischen Kontext beleuchtet, um seine individuellen Verwundbarkeiten und möglichen Motive zu verstehen.
4. Tathergang: „frevelhafter“ Mordversuch oder School Shooting?: Dieses Kapitel rekonstruiert den Tathergang vom 25. Mai 1871 detailliert und untersucht Vorfeld und Verlauf der Tat im Lichte der Schulamokforschung. Es werden Warnsignale wie Leaking, Tatplanung und die Rolle des sozialen Kapitals analysiert, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu aktuellen Fällen herauszuarbeiten.
5. Öffentlichkeit: „Ein eben so seltsamer als bedauerlicher Vorfall“: Dieses Kapitel analysiert die öffentlichen Reaktionen auf den Fall Becker, indem es die Gerichtsverhandlung und die mediale Berichterstattung untersucht. Es wird die öffentliche Meinungsbildung und die Darstellung des Falles als Einzelfall im Gegensatz zu aktuellen Fällen, die oft als soziokulturelle Phänomene wahrgenommen werden, verglichen.
Schlüsselwörter
School Shooting, Schulamokforschung, Julius Becker, Risikofaktoren, Tatverlauf, öffentliche Reaktion, Sozialkapital, bürgerliches Männlichkeitsideal, historische Fallstudie, Leaking, Deutschland, 19. Jahrhundert.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: "School Shooting 1871 - Der Fall Julius Becker"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Mordversuch von Julius Becker an einem Saarbrücker Gymnasium im Jahr 1871. Zentral ist die Frage, ob dieser Fall nach heutigen Maßstäben als School Shooting einzustufen ist. Die Analyse soll den aktuellen Forschungsstand zur Schulamokforschung erweitern und den Wert historischer Fallbeispiele für präventive Maßnahmen belegen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die historische Einordnung von School Shootings, die Analyse von Risikofaktoren im Fall Becker (individuell-biografisch und schulisch), den Vergleich des Tathergangs mit aktuellen School Shootings, die öffentlichen Reaktionen und die mediale Berichterstattung im historischen Kontext, sowie eine Bewertung des Falles Becker im Lichte der modernen Schulamokforschung. Besonderes Augenmerk liegt auf der Untersuchung von Warnsignalen (Leaking), der Rolle des sozialen Kapitals und der öffentlichen Meinungsbildung.
Wer war Julius Becker?
Julius Becker war der Täter des Mordversuchs am Saarbrücker Gymnasium im Jahr 1871. Die Arbeit analysiert seine Persönlichkeit anhand biografischer Daten und untersucht Risikofaktoren, um seine Motive und individuellen Verwundbarkeiten zu verstehen. Er wird als "hochfahrend und eingebildet, nicht aber verrückt" beschrieben.
Wie wird der Tathergang rekonstruiert?
Der Tathergang vom 25. Mai 1871 wird detailliert rekonstruiert. Die Analyse berücksichtigt Vorfeld und Verlauf der Tat und untersucht Warnsignale wie "Leaking" (Tatankündigung), die Tatplanung und die Rolle des sozialen Kapitals. Vergleiche mit aktuellen School Shootings werden gezogen, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufzuzeigen.
Wie wurde der Fall Becker öffentlich wahrgenommen?
Die Arbeit analysiert die öffentlichen Reaktionen auf den Fall, indem sie die Gerichtsverhandlung, die mediale Berichterstattung und die öffentliche Meinungsbildung untersucht. Es wird ein Vergleich zwischen der Darstellung des Falls als Einzelfall im 19. Jahrhundert und der heutigen Wahrnehmung von School Shootings als soziokulturelle Phänomene angestellt.
Welche Quellen wurden verwendet?
Die Arbeit basiert auf einer detaillierten Quellenanalyse zum Fall Becker, deren Umfang im ersten Kapitel erläutert wird. Die Quellenlage wird im Kontext der amerikanischen und deutschen Schulamokforschung diskutiert.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit untersucht, ob der Fall Becker als historisches Beispiel für ein School Shooting gewertet werden kann. Sie liefert Erkenntnisse zur Entwicklung des Phänomens und zum Wert historischer Fallstudien für die Prävention von Schulamokläufen. Die konkreten Schlussfolgerungen werden am Ende der Arbeit zusammengefasst.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
School Shooting, Schulamokforschung, Julius Becker, Risikofaktoren, Tatverlauf, öffentliche Reaktion, Sozialkapital, bürgerliches Männlichkeitsideal, historische Fallstudie, Leaking, Deutschland, 19. Jahrhundert.
- Citar trabajo
- Tanja Bialojan (Autor), 2015, Das Saarbrücker School Shooting vom 25. Mai 1871. Täter, Tat, Öffentlichkeit, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/310106