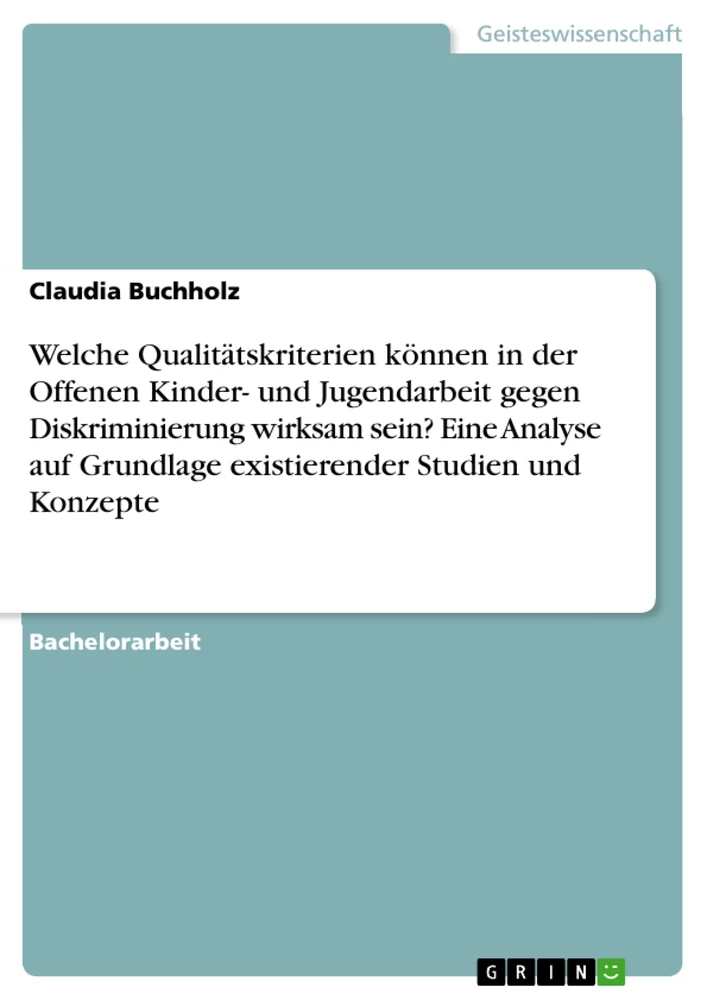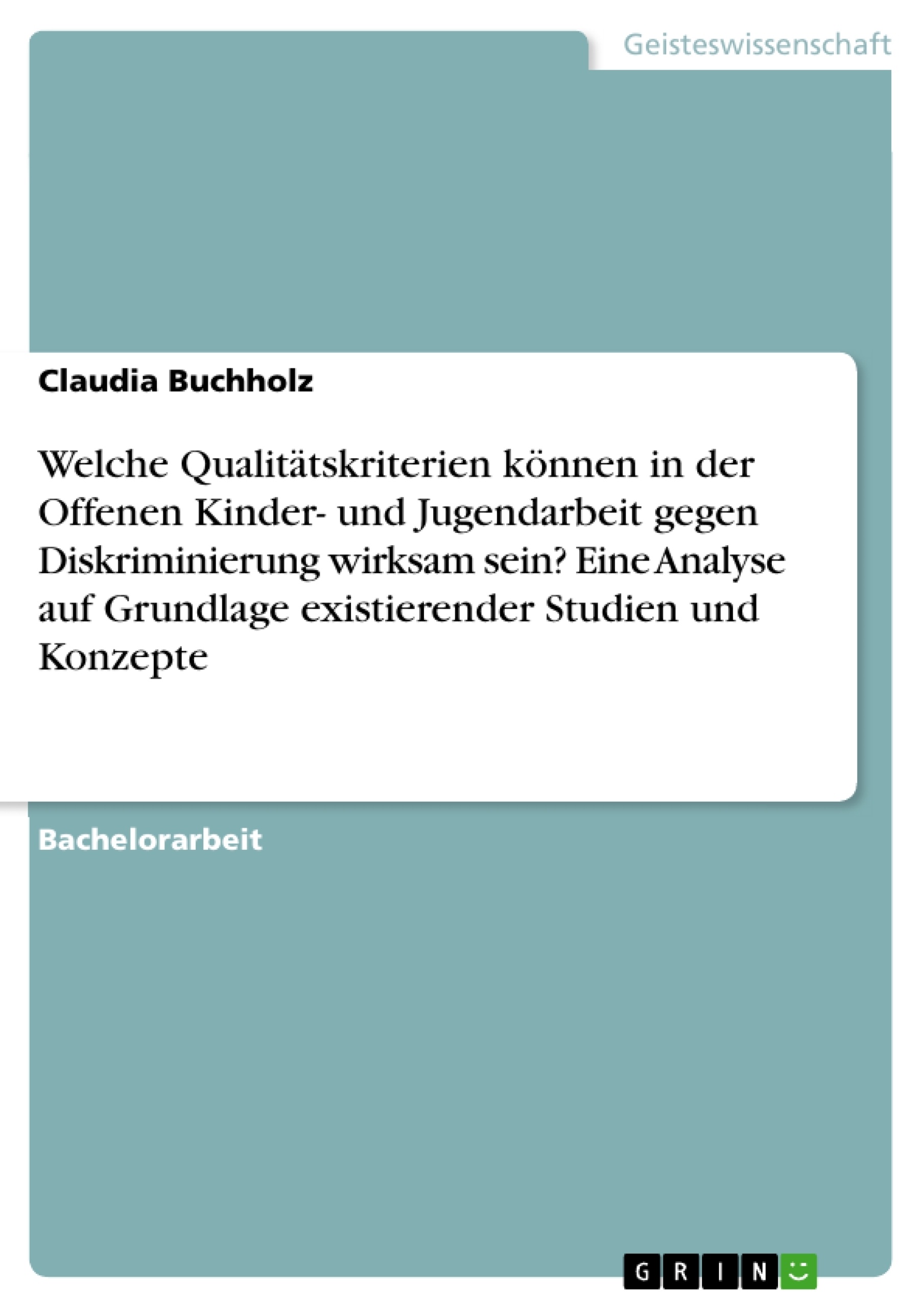Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die Frage zu beantworten, welche Qualitätskriterien in Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit gegen Diskriminierung wirksam sein können. Auf Grundlage existierender Theorien, Studien und praxisbezogener Konzepte werden fachliche und auf nachvollziehbare Weise begründete, zentrale Qualitätskriterien formuliert. Diese sollen dazu beitragen, Benachteiligungen und Ausgrenzungen in der pädagogischen Praxis zu erkennen und auf professionelle Weise zu thematisieren beziehungsweise zu bearbeiten.
Die verfolgte Intention besteht darin, einen einrichtungsinternen und einrichtungsübergreifenden Qualitätsentwicklungsprozess im Umgang mit Diskriminierung aber auch mit Vielfalt anzustoßen. Die in dieser Arbeit formulierten Kriterien fungieren dabei als fachlich begründeter Orientierungsrahmen, der es den Jugendfreizeiteinrichtungen und der Jugendarbeit im Allgemeinen ermöglicht, konkrete und kontextabhängige Handlungsschritte und -strategien zu entwickeln.
Um sich diesem Ziel zu nähern, bedarf es eines umfassenden Verständnisses von Diskriminierung in all ihren Erscheinungsformen und Auswirkungen auf Betroffene. In der vorliegenden Arbeit wird Diskriminierung in ihrer strukturellen Verwobenheit auf individueller, institutioneller und kultureller Ebene betrachtet. Deren mögliche Auswirkungen werden im Hinblick auf die Gesundheit, die Persönlichkeitsentwicklung und die eingeschränkten Teilhabechancen junger Menschen beschrieben.
Zur Erarbeitung konkreter fachlicher Qualitätskriterien, braucht es darüber hinaus ein grundlegendes Wissen über die Ursachen, Entstehungsmechanismen und Funktionen von diskriminierenden Verhaltensweisen auf individueller Ebene aber auch auf der Ebene von Intra- und Intergruppenkontexten. Dies gelingt durch das Heranziehen soziologischer und sozialpsychologischer Theorien, die sich u. a. mit der Entstehungen von Vorurteilen und Stereotypen aber auch mit Gruppenkonflikten und dem individuellen Selbstkonzept befassen. Darüber hinaus werden unter Einbeziehung pädagogischer Antidiskriminierungs- und Diversitätskonzepte gesellschaftlich verankerte Entstehungsmechanismen, Praktiken und Strukturen von Diskriminierung in den Blick genommen.
Das Ergebnis dieser Arbeit ist ein umfassender Orientierungsrahmen, der Handlungsbedarfe und -möglichkeiten im Umgang mit Diskriminierung auf der Ebene der einzelnen Mitarbeiter_innen, des gesamten Teams aber auch der Jugendfreizeiteinrichtung, formuliert.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Qualitätsentwicklung in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit
- 2.1 Qualitätsbegriff
- 2.2 Dimensionen von Qualität
- 2.3 Qualitätskriterien
- 2.4 Qualitätsprüfung und -entwicklung
- 3 Diskriminierung
- 3.1 Definitionen von Diskriminierung
- 3.1.1 Definition aus soziologischer Sicht
- 3.1.2 Definition aus psychologischer Sicht
- 3.1.3 Definition aus juristischer Sicht
- 3.1.4 Definition nach dem Social Justice und Diversity Konzept
- 3.2 Dimensionen von Diskriminierung
- 3.3 Ebenen von Diskriminierung
- 3.4 Merkmale und Formen von Diskriminierung
- 3.5 Intersektionalität von Diskriminierung
- 3.6 Auswirkungen von Diskriminierung
- 3.6.1 Auswirkungen auf die psychische und physische Gesundheit
- 3.6.2 Auswirkungen auf die Persönlichkeitsentwicklung
- 3.6.3 Auswirkungen auf die Teilhabe- und Entwicklungschancen
- 4 Das Arbeitsfeld der Offenen Kinder- und Jugendarbeit
- 4.1 Gesetzliche Grundlagen und Auftrag der Offenen Kinder- und Jugendarbeit
- 4.2 Arbeitsprinzipien der Offenen Kinder- und Jugendarbeit
- 4.3 Angebote der Offenen Kinder- und Jugendarbeit
- 4.4 Potentiale der Offenen Kinder- und Jugendarbeit
- 4.5 Ziele der Offenen Kinder- und Jugendarbeit
- 5 Offene Kinder und Jugendarbeit und Diskriminierung
- 5.1 Rechtlich verbindliche Prinzipien gegen Diskriminierung
- 5.1.1 Grundgesetz
- 5.1.2 Europäische Menschenrechtskonvention
- 5.1.3 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
- 5.2 Rechtlich unverbindlich Prinzipien gegen Diskriminierung
- 5.2.1 Allgemeine Erklärung der Menschenrechte
- 5.2.2 UN-Kinderrechtskonvention
- 5.3 Berufsethische Prinzipien gegen Diskriminierung
- 6 Entstehungsmechanismen von Diskriminierung
- 6.1 Vorurteile und Diskriminierung
- 6.1.1 Offene Vorurteile
- 6.1.2 Subtile Vorurteile
- 6.2 Theorie des realistischen Gruppenkonflikts
- 6.3 Stereotype
- 6.3.1 Soziale Kategorisierung und Stereotypisierung
- 6.3.2 Stereotype und Informationsverarbeitung
- 6.4 Theorie der sozialen Identität und der Selbstkategorisierung
- 6.4.1 Die Entstehung des Selbstkonzepts
- 6.4.2 Der Vorgang der Eigengruppenprojektion
- 6.5 Soziales Lernen
- 6.5.1 Elementares Lernen
- 6.5.2 Sozial-kognitives Lernen
- 6.5.3 Sozialisation
- 7 Theoriegeleitete Handlungsbedarfe und -möglichkeiten
- 7.1 Dekategorisierung
- 7.2 Wechselseitige Differenzierung durch Kontakte
- 7.3 Subgrouping
- 7.4 Prototypendefinition
- 7.5 Reduktion von Vorurteilen und Stereotypisierungen
- 7.5.1 Selbstreflexion
- 7.5.2 Klare Regeln und konsequentes Vorgehen
- 7.5.3 Vorbildfunktion
- 7.5.4 Stärkung von Selbstwert und Identität
- 8 Pädagogische Antidiskriminierungs- und Diversitykonzepte
- 8.1 Diversitypädagogik / Pädagogik der Vielfalt
- 8.2 Social Justice und Diversity Training
- 8.3 Anti-Bias-Ansatz / Vorurteilsbewusste Bildung
- 8.4 Antidiskriminierungspädagogik
- 8.5 Gesellschaftlicher Kontext von Diskriminierung
- 9 Konzeptübergreifende Handlungsbedarfe und -möglichkeiten
- 9.1 Ebene der Mitarbeiter_innen
- 9.1.1 Wahrnehmung von Diskriminierungen
- 9.1.2 Selbst- und Praxisreflektion
- 9.1.3 Gemeinsames Verständnis
- 9.1.4 Konsequentes Vorgehen
- 9.1.5 Öffentlich-politisches Handeln
- 9.2 Einrichtungsbezogene Ebene
- 9.2.1 Einrichtungsbezogene Barrieren erkennen und abbauen
- 9.2.2 Vielfalt widerspiegeln
- 9.2.3 Konzeptionelle und einrichtungsbezogene Verankerung
- 9.3 Ebene der Besucher_innen
- 9.3.1 Identitätsentwicklung und -stärkung
- 9.3.2 Schaffung von Kontakt- und Dialogmöglichkeiten
- 9.3.3 Individuelle Wahrnehmung und Unterstützung Betroffener
- 9.3.4 Räume schaffen
- 10 Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht Qualitätskriterien zur Bekämpfung von Diskriminierung in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit. Ziel ist es, wirksame Maßnahmen und Konzepte zu identifizieren und zu analysieren.
- Qualitätsentwicklung in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit
- Definitionen und Dimensionen von Diskriminierung
- Entstehungsmechanismen von Diskriminierung (Vorurteile, Stereotype, soziales Lernen)
- Theoriegeleitete Handlungsbedarfe und -möglichkeiten
- Pädagogische Antidiskriminierungs- und Diversitykonzepte
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Bachelorarbeit ein und beschreibt die Relevanz der Thematik. Sie umreißt den Forschungsansatz und die Struktur der Arbeit. Die zentrale Fragestellung nach wirksamen Qualitätskriterien gegen Diskriminierung in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit wird prägnant formuliert.
2 Qualitätsentwicklung in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für die Arbeit. Es definiert den Begriff der Qualität im Kontext der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, benennt relevante Qualitätsdimensionen und Kriterien und beschreibt Ansätze zur Qualitätsprüfung und -entwicklung. Diese Grundlagen bilden die Basis für die spätere Analyse von Maßnahmen gegen Diskriminierung.
3 Diskriminierung: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Auseinandersetzung mit dem Phänomen Diskriminierung. Es werden verschiedene Definitionen aus soziologischer, psychologischer und juristischer Perspektive vorgestellt und miteinander verglichen. Die Kapitelteile beleuchten Dimensionen, Ebenen, Merkmale, Formen und die Intersektionalität von Diskriminierung sowie deren weitreichende Auswirkungen auf die betroffenen Personen.
4 Das Arbeitsfeld der Offenen Kinder- und Jugendarbeit: Dieses Kapitel beschreibt das Arbeitsfeld der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, seine gesetzlichen Grundlagen und den damit verbundenen Auftrag. Es erläutert die Arbeitsprinzipien, Angebote, Potentiale und Ziele dieses wichtigen Bereichs der Jugendarbeit. Diese Beschreibung dient dazu, den Kontext für die Anwendung der Antidiskriminierungskriterien zu verdeutlichen.
5 Offene Kinder- und Jugendarbeit und Diskriminierung: Dieses Kapitel untersucht den Zusammenhang zwischen Offener Kinder- und Jugendarbeit und Diskriminierung. Es analysiert relevante rechtliche (verbindliche und unverbindliche) und berufsethische Prinzipien, die der Bekämpfung von Diskriminierung dienen. Diese rechtlichen und ethischen Grundlagen sind entscheidend für das Verständnis und die Umsetzung von Antidiskriminierungsmaßnahmen.
6 Entstehungsmechanismen von Diskriminierung: Das Kapitel beleuchtet die Ursachen und Mechanismen von Diskriminierung. Es betrachtet Vorurteile und Stereotype, die Theorie des realistischen Gruppenkonflikts, die Theorie der sozialen Identität und des sozialen Lernens. Diese theoretischen Modelle erklären, wie Diskriminierung entsteht und aufrechterhalten wird. Diese Erkenntnisse sind wesentlich für die Entwicklung effektiver Strategien gegen Diskriminierung.
7 Theoriegeleitete Handlungsbedarfe und -möglichkeiten: Basierend auf den im vorherigen Kapitel dargestellten Theorien werden in diesem Kapitel Handlungsansätze zur Reduktion von Diskriminierung erörtert. Es werden Methoden wie Dekategorisierung, wechselseitige Differenzierung, Subgrouping, Prototypendefinition und die Reduktion von Vorurteilen und Stereotypisierungen durch Selbstreflexion, klare Regeln und Vorbildfunktion untersucht. Diese Strategien bilden den Kern der Arbeit und stellen die Verbindung zu den Qualitätskriterien her.
8 Pädagogische Antidiskriminierungs- und Diversitykonzepte: Dieses Kapitel befasst sich mit verschiedenen pädagogischen Konzepten zur Bekämpfung von Diskriminierung, wie Diversitypädagogik, Social Justice und Diversity Training, Anti-Bias-Ansatz und Antidiskriminierungspädagogik. Diese Konzepte werden detailliert beschrieben und im Hinblick auf ihre Anwendbarkeit in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit analysiert. Die Kapitel zeigen die Vielfalt der vorhandenen pädagogischen Ansätze auf.
9 Konzeptübergreifende Handlungsbedarfe und -möglichkeiten: Abschließend werden in diesem Kapitel Handlungsempfehlungen auf verschiedenen Ebenen – Mitarbeiter_innen, Einrichtung und Besucher_innen – gegeben. Es werden konkrete Maßnahmen zur Prävention und Bekämpfung von Diskriminierung in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit vorgestellt. Die Empfehlungen sind praxisorientiert und berücksichtigen die unterschiedlichen Einflussfaktoren.
Schlüsselwörter
Diskriminierung, Offene Kinder- und Jugendarbeit, Qualitätskriterien, Antidiskriminierungspädagogik, Diversitypädagogik, Vorurteile, Stereotype, Social Justice, Inklusion, Qualitätsentwicklung, Handlungsempfehlungen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Qualitätskriterien zur Bekämpfung von Diskriminierung in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht Qualitätskriterien zur Bekämpfung von Diskriminierung in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit. Ziel ist die Identifizierung und Analyse wirksamer Maßnahmen und Konzepte.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunkte: Qualitätsentwicklung in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, Definitionen und Dimensionen von Diskriminierung, Entstehungsmechanismen von Diskriminierung (Vorurteile, Stereotype, soziales Lernen), theoriegeleitete Handlungsbedarfe und -möglichkeiten sowie pädagogische Antidiskriminierungs- und Diversitykonzepte.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in zehn Kapitel: Einleitung, Qualitätsentwicklung in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, Diskriminierung, Das Arbeitsfeld der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, Offene Kinder- und Jugendarbeit und Diskriminierung, Entstehungsmechanismen von Diskriminierung, Theoriegeleitete Handlungsbedarfe und -möglichkeiten, Pädagogische Antidiskriminierungs- und Diversitykonzepte, Konzeptübergreifende Handlungsbedarfe und -möglichkeiten und Fazit und Ausblick. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt des Themas.
Welche Definitionen von Diskriminierung werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet Definitionen von Diskriminierung aus soziologischer, psychologischer, juristischer und der Perspektive des Social Justice und Diversity Konzepts. Diese verschiedenen Perspektiven werden verglichen und analysiert.
Welche Entstehungsmechanismen von Diskriminierung werden untersucht?
Die Arbeit untersucht Vorurteile und Stereotype, die Theorie des realistischen Gruppenkonflikts, die Theorie der sozialen Identität und Selbstkategorisierung sowie soziales Lernen als Entstehungsmechanismen von Diskriminierung.
Welche Handlungsansätze zur Reduktion von Diskriminierung werden vorgestellt?
Es werden verschiedene Handlungsansätze vorgestellt, darunter Dekategorisierung, wechselseitige Differenzierung durch Kontakte, Subgrouping, Prototypendefinition und die Reduktion von Vorurteilen und Stereotypisierungen durch Selbstreflexion, klare Regeln, Vorbildfunktion und Stärkung von Selbstwert und Identität.
Welche pädagogischen Konzepte werden analysiert?
Die Arbeit analysiert Diversitypädagogik, Social Justice und Diversity Training, den Anti-Bias-Ansatz und Antidiskriminierungspädagogik. Die Anwendbarkeit dieser Konzepte in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit wird untersucht.
Auf welchen Ebenen werden Handlungsempfehlungen gegeben?
Handlungsempfehlungen werden auf drei Ebenen gegeben: Mitarbeiter_innen (Wahrnehmung, Selbstreflexion, gemeinsames Verständnis, Vorgehen, öffentliches Handeln), Einrichtung (Barrieren abbauen, Vielfalt widerspiegeln, konzeptionelle Verankerung) und Besucher_innen (Identitätsentwicklung, Kontaktmöglichkeiten, individuelle Unterstützung, Raumgestaltung).
Welche rechtlichen Grundlagen werden berücksichtigt?
Die Arbeit berücksichtigt das Grundgesetz, die Europäische Menschenrechtskonvention, das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und die UN-Kinderrechtskonvention.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Diskriminierung, Offene Kinder- und Jugendarbeit, Qualitätskriterien, Antidiskriminierungspädagogik, Diversitypädagogik, Vorurteile, Stereotype, Social Justice, Inklusion, Qualitätsentwicklung und Handlungsempfehlungen.
- Citation du texte
- Claudia Buchholz (Auteur), 2014, Welche Qualitätskriterien können in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit gegen Diskriminierung wirksam sein? Eine Analyse auf Grundlage existierender Studien und Konzepte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/310553