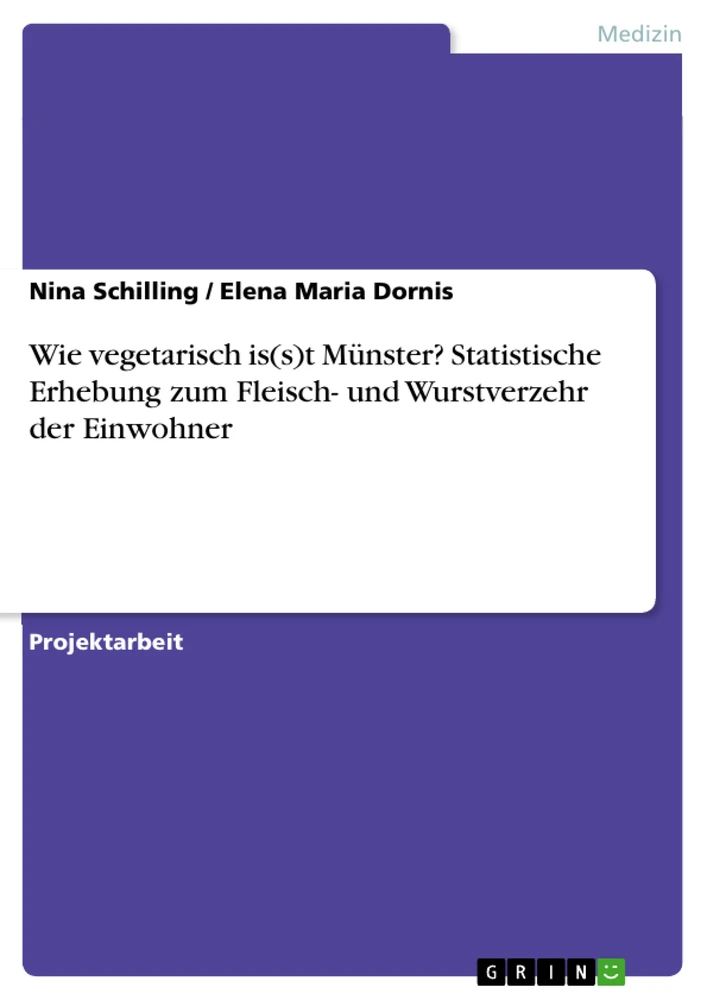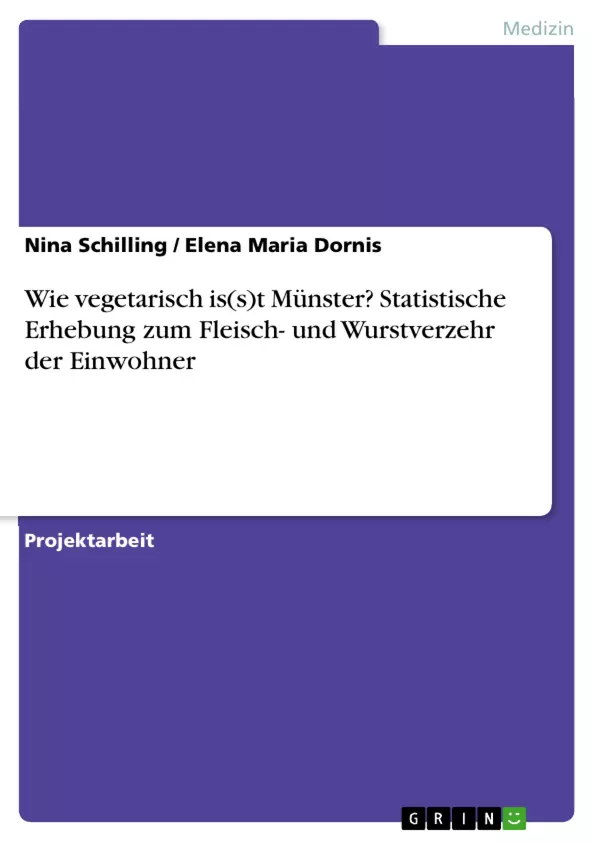„Wer sich vegetarisch ernährt, verringert seinen ökologischen Fußabdruck um rund eine Tonne CO2 und spart 650.000 Liter Wasser pro Jahr. Er verbraucht weniger Land und entschärft das Welthungerproblem, weil weniger Nahrungsmittel an Tiere verfüttert werden“.
Dieses Zitat von Sebastian Zösch, Geschäftsführer des Vegetarierbundes Deutschland, verdeutlicht die aktuelle Diskussion in den Medien zum Thema Massentierhaltung und deren ökologische Folgen. Darüber hinaus wirft es die Frage auf was gesünder ist, regelmäßig Fleisch zu essen oder sich vegetarisch zu ernähren.
Einer der Hauptauslöser dieser Debatte war das Erscheinen des Buches „Tiere essen“ („Eating animals“) von Jonathan Safran Foer 2009. Darin beschreibt Foer die Situation der Fleischproduktion in Amerika, wo „99 Prozent der verspeisten Schweine, Vögel, und Kühe aus Agrarfabriken“ (Nündel, 2010) stammen. Die Tiere leben dort auf kleinstem Raum, unter Qualen und für eine sehr kurze Lebensdauer. Auch in Deutschland gestaltet sich die Situation nicht besser. Hier stammen circa „98 Prozent aller Hühner und Schweine, die für den Verzehr bestimmt sind *…+ aus Massentierhaltung“ (Foer, 2010).
Die große Anzahl der Tiere die gehalten werden, erfordert eine enorme Menge an Futtermitteln, welche überwiegend aus Ländern importiert werden, in denen die Menschen selbst hungern. Durch Anbau, Verwendung von Düngern, Verarbeitung und Transport dieser Futtermittel, durch Tiertransporte, Schlachtung und Weiterverarbeitung des Fleisches, aber auch durch die Tiere selbst, entstehen Unmengen an Methan, Kohlenstoffdioxid und Stickoxiden – Gase, welche hauptsächlich für den Klimawandel verantwortlich sind. Laut einer Studie des unabhängigen Washingtoner Worldwatch Institute ist die Massentierhaltung sogar für „über 50 Prozent der globalen Treibhausemissionen verantwortlich“ (Allmaier, 2010). „Damit ist die Herstellung von einem Kilogramm Fleisch klimaschädlicher als eine 250km lange Autofahrt.“ (www.donnerstag-veggieday.de).
Doch wie gesund oder ungesund ist es sich vegetarisch zu ernähren?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Methode
- 2.1 Der Fragebogen
- 2.1.2 Erläuterungen zu den einzelnen Fragen
- 2.2 Statistik
- 3. Ergebnis
- 3.1 Gesamtstatistik
- 3.1.1 Gesamtstatistik nach Alter unterteilt
- 3.1.2 Gesamtstatistik nach Schulabschluss unterteilt
- 3.2 Männer
- 3.2.1 Männer nach Alter unterteilt
- 3.2.2 Männer nach Schulabschluss unterteilt
- 3.3 Frauen
- 3.3.1 Frauen nach Alter unterteilt
- 3.3.2 Frauen nach Schulabschluss unterteilt
- 3.1 Gesamtstatistik
- 4. Diskussion
- 4.1 Reflexion des Fragebogens
- 4.2 Reflexion der Umfrage
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Projektarbeit untersucht den Grad der vegetarischen Ernährung in Münster. Die Zielsetzung ist es, mittels eines Fragebogens Daten zu erheben und auszuwerten, um ein Bild des Ernährungsverhaltens der Münsteraner Bevölkerung zu erhalten. Die Ergebnisse werden anschließend diskutiert und reflektiert.
- Vegetarische Ernährung in Münster
- Ökologische und gesundheitliche Aspekte vegetarischer Ernährung
- Auswertung von Fragebogendaten
- Einfluss von Alter und Schulabschluss auf das Ernährungsverhalten
- Reflexion der Methodik
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und beleuchtet die aktuelle Diskussion um Massentierhaltung, deren ökologische Folgen und die gesundheitlichen Aspekte vegetarischer Ernährung. Sie verweist auf Studien und Quellen, die die negativen Auswirkungen von Fleischkonsum auf die Umwelt und die gesundheitlichen Vorteile einer vegetarischen Ernährung hervorheben. Das Zitat von Sebastian Zösch verdeutlicht die Dringlichkeit der Thematik. Die Einleitung mündet in die Forschungsfrage der Arbeit: "Wie vegetarisch ist Münster?".
2. Methode: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik der Untersuchung. Es erläutert den verwendeten Fragebogen, seine einzelnen Fragen und die statistischen Methoden, die zur Auswertung der Daten eingesetzt wurden. Die detaillierte Beschreibung der Methodik dient der Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse.
3. Ergebnis: Das Kapitel präsentiert die Ergebnisse der durchgeführten Umfrage. Es gliedert die Daten nach Gesamtstatistik, getrennten Statistiken für Männer und Frauen und unterteilt diese jeweils nach Alter und Schulabschluss. Die Ergebnisse liefern einen quantitativen Überblick über das Ernährungsverhalten der Befragten in Münster.
4. Diskussion: In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Umfrage kritisch diskutiert und reflektiert. Es werden die Stärken und Schwächen des verwendeten Fragebogens analysiert, sowie mögliche Einflussfaktoren auf die Ergebnisse thematisiert. Die Diskussion dient dazu, die Ergebnisse im Kontext zu betrachten und deren Aussagekraft zu bewerten.
Schlüsselwörter
Vegetarische Ernährung, Münster, Fragebogen, Umfrage, Massentierhaltung, ökologische Folgen, gesundheitliche Aspekte, Ernährungsverhalten, Alter, Schulabschluss, Statistik, Auswertung, Reflexion.
Häufig gestellte Fragen zur Projektarbeit: Vegetarische Ernährung in Münster
Was ist der Gegenstand dieser Projektarbeit?
Die Projektarbeit untersucht den Grad der vegetarischen Ernährung in Münster. Sie zielt darauf ab, mittels eines Fragebogens Daten zum Ernährungsverhalten der Münsteraner Bevölkerung zu erheben, auszuwerten und zu diskutieren.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die vegetarische Ernährung in Münster, ökologische und gesundheitliche Aspekte vegetarischer Ernährung, die Auswertung von Fragebogendaten, den Einfluss von Alter und Schulabschluss auf das Ernährungsverhalten sowie eine Reflexion der Methodik.
Welche Methodik wurde angewendet?
Die Untersuchung basiert auf einem Fragebogen, dessen Fragen und statistische Auswertungsmethoden detailliert im Kapitel 2 beschrieben werden. Die Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Methodik wird betont.
Wie sind die Ergebnisse der Umfrage strukturiert?
Die Ergebnisse (Kapitel 3) gliedern sich in eine Gesamtstatistik, separate Statistiken für Männer und Frauen, jeweils unterteilt nach Alter und Schulabschluss. Dies liefert einen quantitativen Überblick über das Ernährungsverhalten der Befragten.
Wie werden die Ergebnisse diskutiert?
Kapitel 4 beinhaltet eine kritische Diskussion und Reflexion der Ergebnisse. Es werden Stärken und Schwächen des Fragebogens analysiert und mögliche Einflussfaktoren auf die Ergebnisse thematisiert. Die Diskussion zielt auf eine Bewertung der Aussagekraft der Ergebnisse.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Vegetarische Ernährung, Münster, Fragebogen, Umfrage, Massentierhaltung, ökologische Folgen, gesundheitliche Aspekte, Ernährungsverhalten, Alter, Schulabschluss, Statistik, Auswertung, Reflexion.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Methode, Ergebnisse, Diskussion und Fazit. Das Inhaltsverzeichnis bietet eine detaillierte Übersicht der Unterkapitel.
Welche Forschungsfrage steht im Mittelpunkt der Arbeit?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: "Wie vegetarisch ist Münster?".
Welche Aspekte der vegetarischen Ernährung werden beleuchtet?
Die Arbeit beleuchtet sowohl die ökologischen Folgen der Massentierhaltung und den Fleischkonsums als auch die gesundheitlichen Vorteile vegetarischer Ernährung.
Wie wird die Einleitung gestaltet?
Die Einleitung führt in das Thema ein, beleuchtet die aktuelle Diskussion um Massentierhaltung und deren Folgen und verweist auf Studien und Quellen, die die negativen Auswirkungen von Fleischkonsum auf die Umwelt und die gesundheitlichen Vorteile einer vegetarischen Ernährung hervorheben. Ein Zitat von Sebastian Zösch unterstreicht die Dringlichkeit der Thematik.
- Citar trabajo
- Nina Schilling (Autor), Elena Maria Dornis (Autor), 2011, Wie vegetarisch is(s)t Münster? Statistische Erhebung zum Fleisch- und Wurstverzehr der Einwohner, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/311457