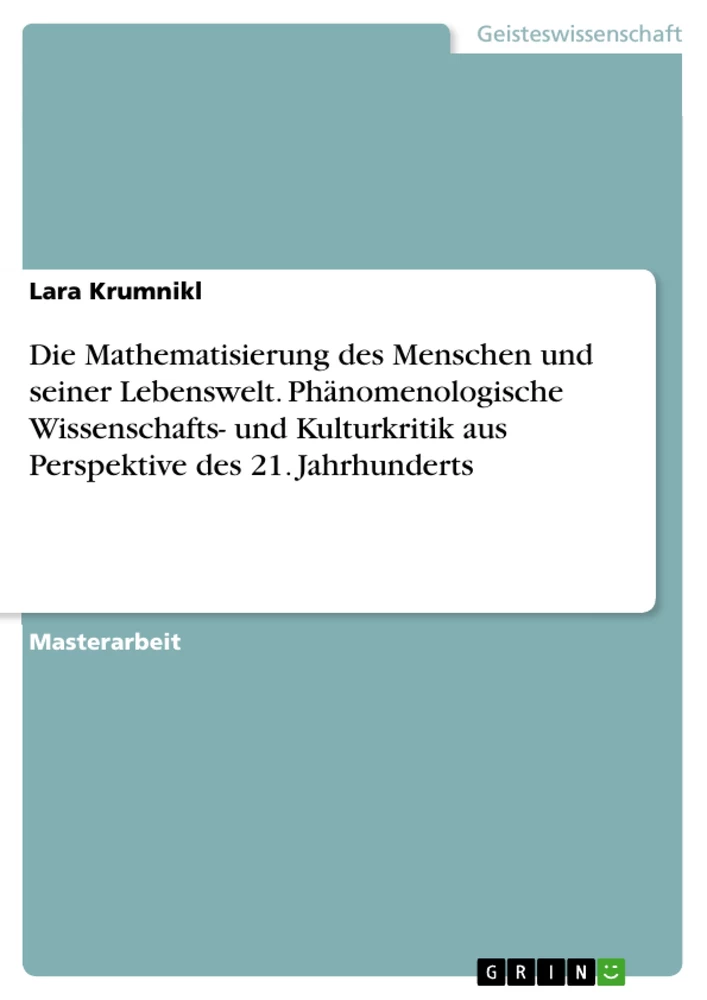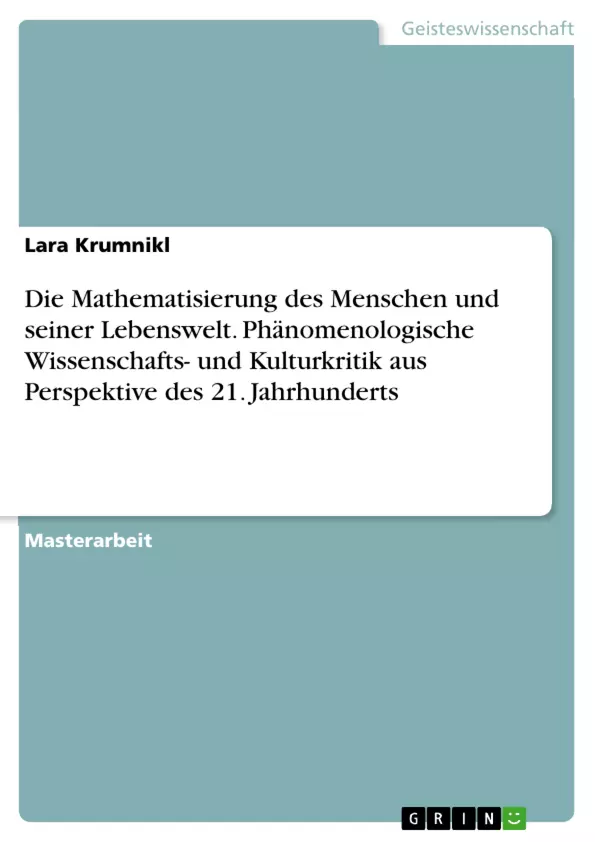Mein Ziel ist es in dieser Arbeit, die in dem Roman "Corpus delicti" von Juli Zeh beschriebene Sinnkrise unter philosophischer Perspektive genauer zu untersuchen. Juli Zehs erschaffene Gesellschaft ist geprägt von einer extrem rationalistischen Denkweise, die die Individualität des einzelnen Menschen und seine geistigen Qualitäten vernachlässigt, geradezu wortwörtlich wegrationalisiert. Der Mensch wird betrachtet als eine Summe seiner Werte, seiner Leistung; die Summe eines messbaren, mathematisierten Status. Sämtliche lebensweltliche Phänomene werden einzig und allein aus naturwissenschaftlicher Perspektive betrachtet.
Ich werde mich vor allem auf die Ursachen und Symptome der sogenannten „Krise“ konzentrieren, weswegen das übergeordnete Thema „Die Mathematisierung des Menschen und der Lebenswelt“ lautet. Der Roman repräsentiert in etwa den Fokus, den ich bei meiner Untersuchung wähle, nämlich den der Mathematisierung im Sinne eines zunehmenden Einflusses physikalistischer Reduktionsprozesse der modernen Naturwissenschaften auf unser Menschen- und Weltverständnis.
Doch diese Thematik ist keines Falles eine Neue. Die behandelte Thematik im Roman bildet nur einen kleinen Ausschnitt einer Denkweise einer traditionellen Kritik an der Mathematisierung unserer Lebenswelt. Einer der Begründer dieser Strömung ist der Philosoph Edmund Husserl. Auch der Phänomenologe sprach in seiner „Krisis der europäischen Wissenschaften“ von 1935 von einer Sinnkrise, ausgelöst durch eine Mathematisierung und Objektivierung der Lebenswelt.
Mein Hauptanliegen wird es sein, aufzuzeigen, welche auffälligen Parallelen sich in seiner phänomenologischen Wissenschafts- und Kulturkritik und aktuellen kritischen Untersuchungen und Publikationen finden. Ich möchte zeigen, dass beispielsweise aktuelle Kritiker wie Juli Zeh, letztendlich von nahezu identischen gesellschaftlichen Entwicklungen und ideologischen Tendenzen sprechen, wie bereits vor knapp einem Jahrhundert Edmund Husserl. So wird sich meine Arbeit sowohl klassischen, philosophischen Schriften widmen, die dieses Thema behandeln, als auch aktuellen, modernen Untersuchungen und Auseinandersetzungen und schließlich möchte ich auch selbst, ohne Grundlage von Texten, Symptome und mögliche Konsequenzen der prognostizierten Sinnkrise in unserer Gesellschaft des 21. Jahrhunderts aufzeigen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Phänomenologische Wissenschafts- und Kulturkritik
- „Die Krisis der europäischen Wissenschaften“ von Husserl
- Wandel der Wissenschaften
- Mathematisierung der Füllen
- Vergessen der Lebenswelt
- Das Dogma der Naturwissenschaften und die Philosophie
- Das Individuum in der Rolle des Mitmenschen von Löwith
- Umwelt als „ent-objektivierte“ Mitwelt
- Nicht-Objektivität von Objekten
- Die Henrysche Barbarei – eine phänomenologische Kulturkritik
- Zwischenfazit I
- Einfluss der Naturwissenschaft auf unser Welt- und Menschenverständnis im 21. Jahrhundert
- Thesen
- Das Verhältnis der Geistes- und Naturwissenschaften
- Die Debatte um Gehirn und Geist
- Exkurs: Psychologismus
- Mathematisierung unseres Weltverständnisses
- Der vermessene Mensch
- Der Mensch als Zahlenkolonne
- Die gesellschaftlichen Folgen und ein neu entstehendes Menschenbild
- Ökonomisierung durch Mathematisierung
- Zwischenfazit III
- Schluss (nicht enthalten)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Mathematisierung des Menschen und seiner Lebenswelt aus phänomenologischer Perspektive. Sie analysiert kritisch den Einfluss naturwissenschaftlicher Denkweisen auf unser Welt- und Selbstverständnis im 21. Jahrhundert. Der Roman "Corpus Delicti" von Juli Zeh dient als Fallbeispiel für eine dystopische Zukunftsvision, die die potenziellen Folgen einer solchen Mathematisierung aufzeigt.
- Phänomenologische Wissenschaftskritik
- Der Einfluss der Naturwissenschaften auf das Menschenbild
- Mathematisierung und Ökonomisierung des Lebens
- Verlust von Individualität und geistigen Werten
- Gesellschaftliche Folgen der Selbstoptimierung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und stellt den Roman "Corpus Delicti" von Juli Zeh als Ausgangspunkt für die Untersuchung der Mathematisierung des Menschen und seiner Lebenswelt vor. Sie skizziert die dystopische Zukunftsvision des Romans und deren Relevanz für die philosophische Fragestellung.
Phänomenologische Wissenschafts- und Kulturkritik: Dieses Kapitel untersucht verschiedene phänomenologische Ansätze zur Kritik von Wissenschaft und Kultur. Es analysiert Husserls "Krisis der europäischen Wissenschaften", Löwiths Betrachtung des Individuums in der Rolle des Mitmenschen und eine phänomenologische Kulturkritik. Der Fokus liegt auf der Mathematisierung der Wirklichkeit und dem Vergessen der Lebenswelt.
Einfluss der Naturwissenschaft auf unser Welt- und Menschenverständnis im 21. Jahrhundert: Dieses Kapitel beleuchtet den aktuellen Einfluss naturwissenschaftlicher Perspektiven auf unser Verständnis von Mensch und Welt. Es diskutiert das Verhältnis von Geistes- und Naturwissenschaften, die Debatte um Gehirn und Geist und die zunehmende Mathematisierung unseres Weltverständnisses im 21. Jahrhundert. Es analysiert, wie diese Entwicklungen unser Denken und Handeln prägen.
Der vermessene Mensch: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Folgen der Mathematisierung des Menschen. Es beschreibt den Menschen als eine quantifizierbare Größe, analysiert die gesellschaftlichen Auswirkungen dieser Sichtweise und untersucht die Ökonomisierung durch Mathematisierung. Die Entstehung eines neuen Menschenbildes, geprägt von Selbstoptimierung und Leistungsdruck, steht im Mittelpunkt der Analyse.
Schlüsselwörter
Phänomenologie, Wissenschaftskritik, Mathematisierung, Lebenswelt, Naturwissenschaften, Geisteswissenschaften, Menschenbild, Selbstoptimierung, Ökonomisierung, Dystopie, "Corpus Delicti", Juli Zeh, Individualität, Gesellschaftskritik.
Häufig gestellte Fragen zu "Mathematisierung des Menschen und seiner Lebenswelt"
Was ist das Thema der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit untersucht kritisch die Mathematisierung des Menschen und seiner Lebenswelt aus phänomenologischer Perspektive. Sie analysiert den Einfluss naturwissenschaftlichen Denkens auf unser Selbst- und Weltverständnis im 21. Jahrhundert und beleuchtet die potenziellen gesellschaftlichen Folgen dieser Entwicklung.
Welche Methoden werden in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit verwendet eine phänomenologische Herangehensweise. Sie analysiert verschiedene phänomenologische Ansätze zur Wissenschafts- und Kulturkritik (Husserl, Löwith) und wendet diese auf die Thematik der Mathematisierung an. Der Roman "Corpus Delicti" von Juli Zeh dient als Fallbeispiel für eine dystopische Zukunftsvision.
Welche Autoren und Werke werden behandelt?
Die Arbeit bezieht sich auf die Werke von Edmund Husserl ("Die Krisis der europäischen Wissenschaften"), Karl Löwith und Juli Zeh ("Corpus Delicti"). Der Fokus liegt auf der Analyse der phänomenologischen Kritik an der Wissenschaft und der Anwendung dieser Kritik auf die moderne Entwicklung der Mathematisierung.
Welche Aspekte der Mathematisierung werden untersucht?
Die Arbeit untersucht verschiedene Aspekte der Mathematisierung, darunter die Mathematisierung der Wirklichkeit, das Vergessen der Lebenswelt, den Einfluss auf das Menschenbild, die Ökonomisierung des Lebens, den Verlust von Individualität und geistigen Werten sowie die gesellschaftlichen Folgen der Selbstoptimierung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur phänomenologischen Wissenschafts- und Kulturkritik, ein Kapitel zum Einfluss der Naturwissenschaften auf unser Welt- und Menschenverständnis im 21. Jahrhundert, ein Kapitel zum "vermessenen Menschen" und einen Schluss (nicht enthalten im Preview). Jedes Kapitel analysiert spezifische Aspekte der Mathematisierung und deren Folgen.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für die Arbeit?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind Phänomenologie, Wissenschaftskritik, Mathematisierung, Lebenswelt, Naturwissenschaften, Geisteswissenschaften, Menschenbild, Selbstoptimierung, Ökonomisierung, Dystopie, "Corpus Delicti", Juli Zeh, Individualität und Gesellschaftskritik.
Wie wird der Roman "Corpus Delicti" in die Arbeit integriert?
Der Roman "Corpus Delicti" von Juli Zeh dient als Fallbeispiel, um die dystopischen Zukunftsvisionen einer umfassenden Mathematisierung des Menschen und seiner Lebenswelt zu illustrieren und die theoretischen Überlegungen zu konkretisieren.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit (basierend auf dem Preview)?
Basierend auf dem Preview lässt sich ableiten, dass die Arbeit zu dem Schluss kommen wird, dass die zunehmende Mathematisierung des Menschen und seiner Lebenswelt weitreichende gesellschaftliche Folgen hat, die kritisch reflektiert werden müssen. Die Phänomenologie bietet ein geeignetes Werkzeug, um diese Folgen zu analysieren und zu bewerten.
- Citation du texte
- Lara Krumnikl (Auteur), 2015, Die Mathematisierung des Menschen und seiner Lebenswelt. Phänomenologische Wissenschafts- und Kulturkritik aus Perspektive des 21. Jahrhunderts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/311911