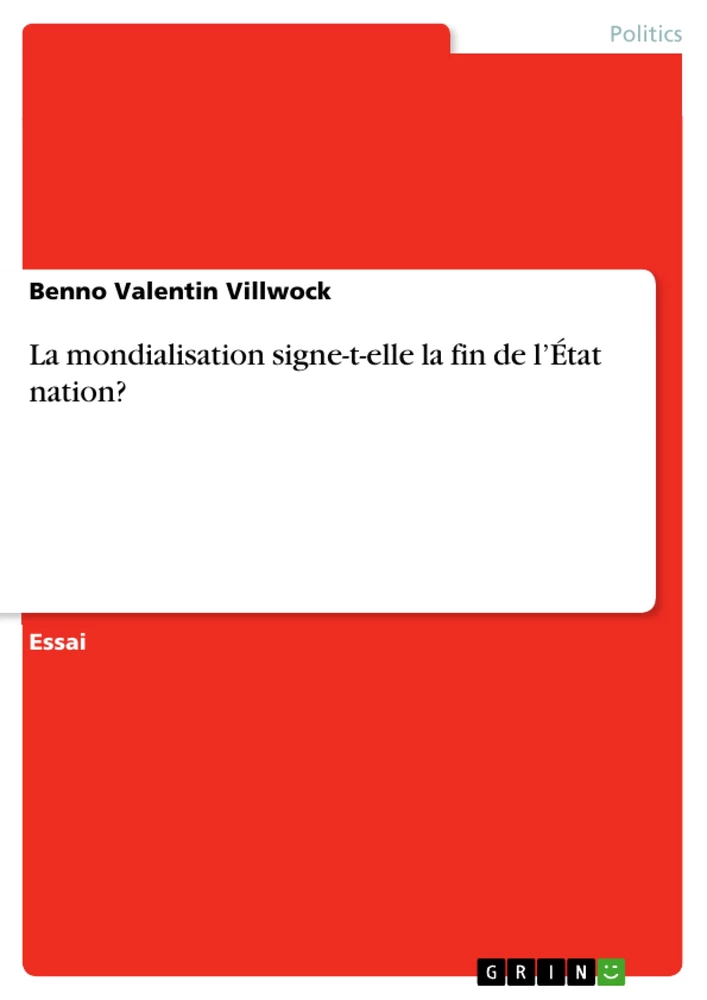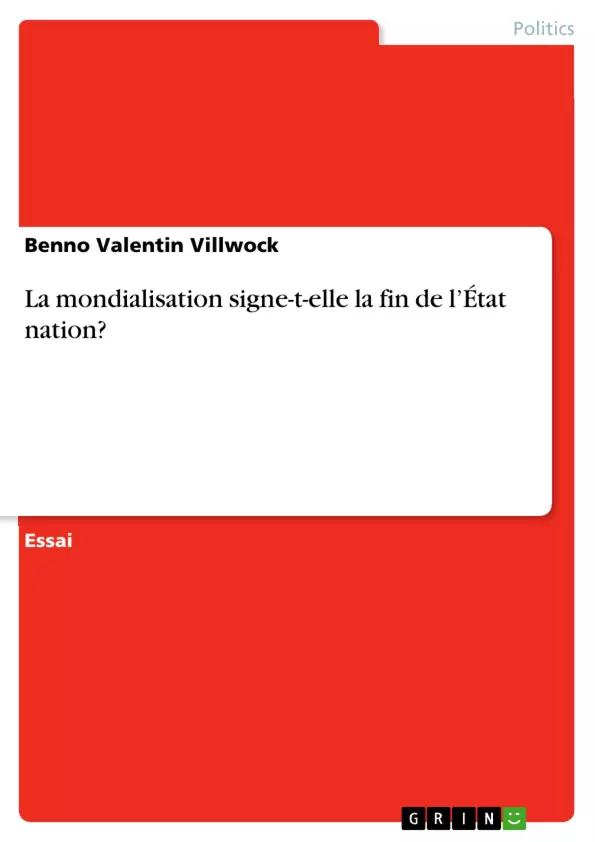Les effets politiques de la mondialisation sont estimés tout autant qu'en révolutionnaires que contradictoires. On pourrait d'un coté interpréter l'époque actuelle comme étant période de transition. Une transition causée par le déplacement du pouvoir étatique d'une proportion historique. La mondialisation retirait de l'État, depuis longtemps la forme d'organisation politique incontestablement dominante, de son autorité en transférant de ses fonctions habituelles aux auteures trans- et inter-étatique. Parmi ces acteurs surtout, et dans ce qui suit focalisés, les organisations internationales (OI), les organisations non-gouvernementales transnationales (ONG) et les entreprises transnationales (ET). En revanche, les sceptiques de ce développement constatent que les États nation maintiennent énergiquement leur autorité dans plusieurs domaines principales du gouvernement. Et cela à bon escient, comme sur la scène internationale ce sont seuls les États qui possèdent la légitimité de médiatiser leurs populations et d'établir un encadrement du droit obligeant. Selon la perception moderne, un gouvernement, soit nationale soit internationale, n'est légitime qu'il remplisse les conditions de la responsabilité et de la transparence. Voilà le problème de la régence d'une multitude des acteurs différents.
Le sujet de cet essai est donc la souveraineté étatique de fait et fonctionnellement contesté par les effets politiques de la mondialisation. Ce premier doit, dans ce qui suit, être défini comme : L'autorité suprême de l'État sur son territoire national (souveraineté interne) et dans l'ordre international (souveraineté externe), où il n'est limité que par ses propres engagements.
Les questions qui se posent pour cet Écrit sont les suivantes :
1. Est-ce que l'État nation est un modèle d’organisation humaine obsolète, dépassé par des acteurs inter- et transnationales qui sont mieux capable de remplir ses anciennes fonctions sur une planète d'interdépendances mondiales?
2. Est-ce que la mondialisation signe-t-elle sur le temps long la fin de l'État nation?
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Introduction
- I Erste Teil: Der Nationalstaat überholt?
- Kapitel 1: Internationale Organisationen
- Section 1: Die UN
- Section 2: Regionale Organisationen. Das EU-Modell
- Section 3: Ständige Internationale Gerichtshöfe
- Paragraf 1: Der Internationale Gerichtshof
- Paragraf 2: Der Internationale Strafgerichtshof
- Kapitel 2: Nichtregierungsorganisationen
- Section 1: Legitimität, guter Zweck und Vertretung der Zivilgesellschaft
- Section 2: Einfluss, der sich verbreitet und den Nationalstaat übertrifft
- Kapitel 3: Die Ökonomie der Globalisierung
- Section 1: Das Freihandelsregime
- Section 2: Transnationale Unternehmen
- II Zweiter Teil: Der Nationalstaat als unverzichtbarer und legitimer Akteur
- Kapitel 1: Internationale Organisationen
- Section 1: Die UN
- Section 2: Regionale Organisationen. Das EU-Modell
- Section 3: Ständige Internationale Gerichtshöfe
- Paragraf 1: Der Internationale Gerichtshof
- Paragraf 2: Der Internationale Strafgerichtshof
- Kapitel 2: Nichtregierungsorganisationen
- Section 1: Legitimationsdefizit
- Section 2: Begrenzter Einfluss von NGOs
- Kapitel 3: Ökonomie der Globalisierung, Staaten in Aktion
- Section 1: Das Freihandelsregime, eine Schöpfung der Staaten
- Section 2: Unternehmen, juristische Personen, die dem Staatsrecht unterliegen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Dieser Essay befasst sich mit der Souveränität des Staates und untersucht, wie sie durch die politischen Auswirkungen der Globalisierung in Frage gestellt wird. Der Essay definiert sowohl den Begriff des Nationalstaates als auch der Globalisierung und untersucht anschließend, ob der Nationalstaat durch trans- und internationale Akteure wie Internationale Organisationen (IO), Nichtregierungsorganisationen (NGO) und multinationale Unternehmen (MNU) an Einfluss verliert. Der Essay analysiert die Rolle dieser Akteure und ihre Auswirkungen auf die Souveränität des Staates. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Frage, ob die Globalisierung langfristig zum Ende des Nationalstaates führt.
- Die Auswirkungen der Globalisierung auf die Souveränität des Nationalstaates
- Die Rolle internationaler Organisationen, Nichtregierungsorganisationen und transnationaler Unternehmen
- Die Legitimität und Relevanz des Nationalstaates im globalisierten Kontext
- Die Frage nach der Zukunft des Nationalstaates in einer globalisierten Welt
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Der erste Teil des Essays untersucht die These, dass der Nationalstaat durch trans- und internationale Akteure an Bedeutung verliert. Kapitel 1 konzentriert sich auf Internationale Organisationen, wobei die UN als Beispiel für einen globalen Sicherheitsmechanismus, die Europäische Union als Modell für Regionalisierung und permanente Gerichtshöfe als Vertreter eines internationalen Rechtssystems betrachtet werden. Kapitel 2 befasst sich mit Nichtregierungsorganisationen und beleuchtet ihre wachsende Legitimität sowie ihren Einfluss auf die internationale Politik. Kapitel 3 analysiert die Ökonomie der Globalisierung, insbesondere das Freihandelsregime und die Rolle transnationaler Unternehmen.
Schlüsselwörter (Keywords)
Der Essay beschäftigt sich mit zentralen Themen der internationalen Beziehungen und der Globalisierung, wie zum Beispiel der Souveränität des Staates, der Legitimität von Institutionen, der Rolle von transnationalen Akteuren, dem Freihandelsregime und der Interdependenz in einer globalisierten Welt. Die Analyse basiert auf zentralen Begriffen wie dem Nationalstaat, internationalen Organisationen, Nichtregierungsorganisationen, transnationalen Unternehmen und der Globalisierung.
Häufig gestellte Fragen
Führt die Globalisierung zum Ende des Nationalstaates?
Der Essay untersucht diese Frage kontrovers. Während transnationale Akteure an Macht gewinnen, behalten Nationalstaaten in vielen Kernbereichen der Regierung ihre Autorität und Legitimität.
Welche Rolle spielen internationale Organisationen (IO) für die staatliche Souveränität?
Organisationen wie die UN oder die EU übernehmen Funktionen, die früher allein dem Staat vorbehalten waren, was die klassische Souveränität sowohl intern als auch extern herausfordert.
Wie beeinflussen NGOs die internationale Politik?
Nichtregierungsorganisationen (NGOs) gewinnen an Einfluss, indem sie die Zivilgesellschaft vertreten und Themen setzen, die über nationale Grenzen hinausgehen. Allerdings wird oft ihr Mangel an demokratischer Legitimation kritisiert.
Können transnationale Unternehmen die Macht von Staaten einschränken?
Ja, durch das Freihandelsregime und ihre ökonomische Stärke können multinationale Unternehmen Druck auf staatliche Gesetzgebungen ausüben. Dennoch bleiben sie juristische Personen, die letztlich dem Staatsrecht unterliegen.
Warum bleibt der Nationalstaat als Akteur unverzichtbar?
Staaten besitzen als einzige Akteure die völkerrechtliche Legitimität, ihre Bevölkerung verbindlich zu vertreten und einen rechtlich verpflichtenden Rahmen zu setzen.
- Citar trabajo
- Benno Valentin Villwock (Autor), 2012, La mondialisation signe-t-elle la fin de l’État nation?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/312172