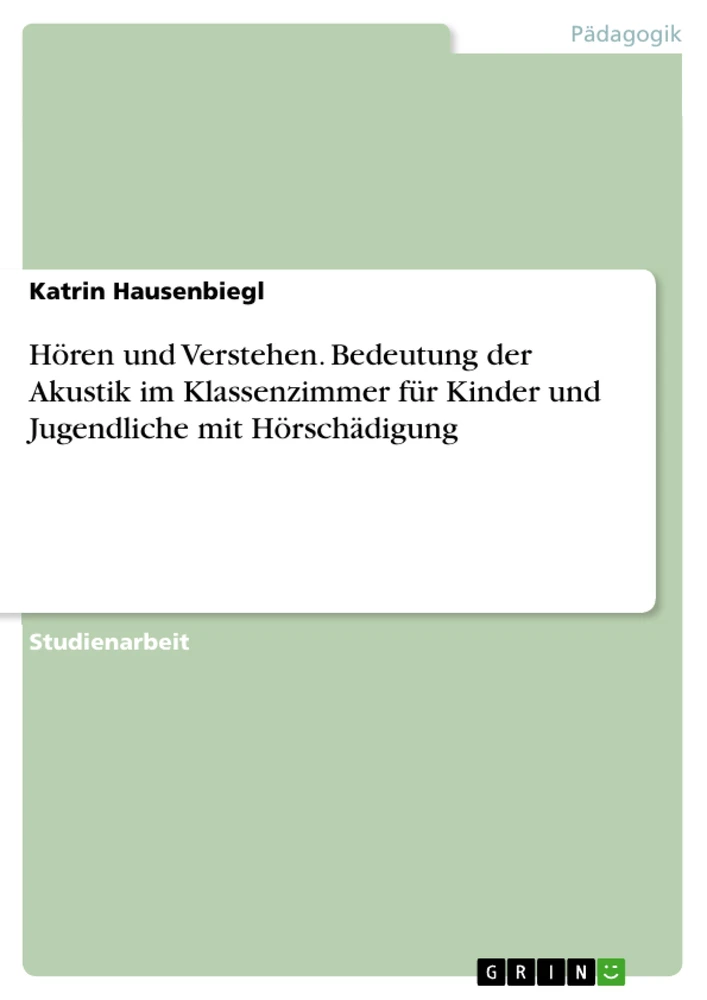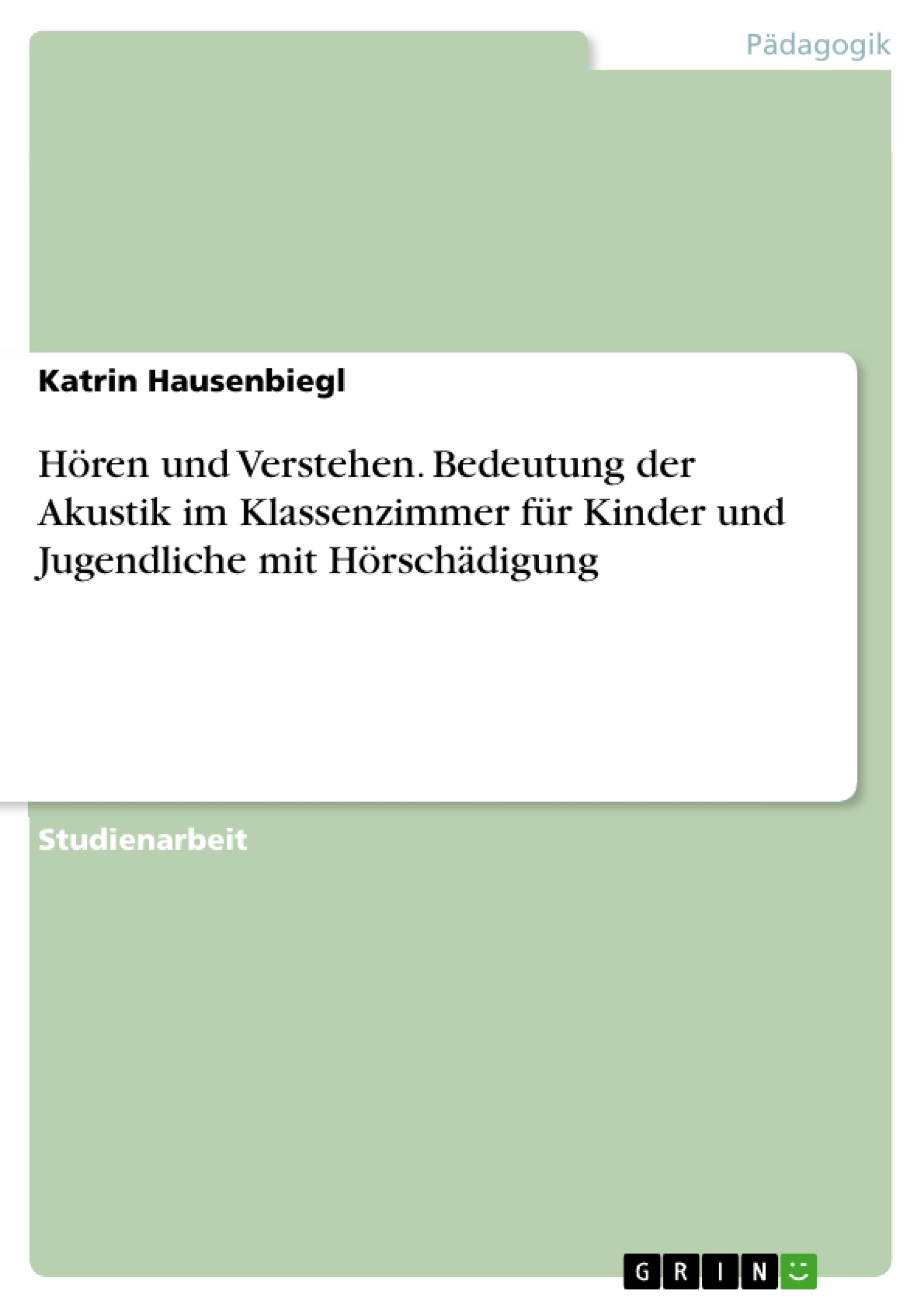Wo viele Menschen, insbesondere Kinder, an einem Ort sind, da ist auch Lärm. Dieser Lärm muss nicht zwangsläufig als Störung empfunden werden. So ist Lachen und Kreischen von Kindern auf einem Spielplatz doch mehr „Musik in den Ohren“. Die wenigsten, vor allem die Kinder selbst, nehmen es nicht als Störung wahr.
In der Schule jedoch sieht das ganz anders aus: Hier liegt der Fokus darauf, etwas Neues zu lernen. Und das Neue wird, früher wie heute, fast ausschließlich verbal vermittelt. Kinder haben beim Verstehen noch mehr Schwierigkeiten als Erwachsene. Sie brauchen deshalb eine ruhigere Umgebung, doch diese ist in einem Klassenzimmer kaum zu finden. Es gibt sowohl externe als auch interne Lärmquellen. Diese stören das Verstehen und somit auch das Lernen.
Kinder sind also schon von vornherein eigentlich benachteiligt. Es gibt aber Kinder, die zusätzlich eine sensorische Beeinträchtigung (Hör- oder Sehschädigung) haben und daher gleich doppelt benachteiligt werden. Das Zitat von Arthur Schopenhauer trifft in dieser Problematik den Punkt: Die Kinder werden nicht nur gestört und abgelenkt von Lärm, sondern sind auch gedanklich mehr damit beschäftigt, überhaupt irgendetwas zu verstehen, als mit dem Gesagten weiterzuarbeiten und weiterzudenken.
„Lärm ist die bedeutendste von allen Störungen. Es ist nicht allein eine Störung, es ist mehr als eine Spaltung des Denkens.“ (Arthur Schopenhauer)
Um genauer zu verstehen, welche besonderen Bedürfnisse die Schülerschaft der Hörgeschädigten haben, wird im ersten Abschnitt das Hören und Verstehen beleuchtet, zunächst das „normale“ Hören und danach die Unterschiede beim Hören mit einer Hörschädigung. Im zweiten Abschnitt wird genauer auf die akustische Situation im Klassenzimmer eingegangen. Anschließend werde mögliche Veränderungsmaßnahmen erläutert, die die Situation im Klassenzimmer verbessern können.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Hören und Verstehen
- 2.1 "Normales" Hören und Verstehen
- 2.2 Hören und Verstehen mit einer Hörschädigung
- 3. Situation im Klassenraum
- 3.1 Lärm im Wandel
- 3.2 Einflussfaktoren auf die Sprachverständlichkeit
- 3.2.1 Distanz
- 3.2.2 Störschall und Signal-Rausch-Abstand
- 3.2.3 Nachhall und Nachhallzeit
- 3.3 Verbesserung der Raumakustik
- 4. Fazit
- 5. Verzeichnis
- 5.1 Literatur
- 5.2 Bilder
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Bedeutung der Klassenraumakustik für Kinder und Jugendliche mit Hörschädigung. Ziel ist es, die besonderen Herausforderungen für hörgeschädigte Schüler im Klassenzimmer zu beleuchten und mögliche Verbesserungsmaßnahmen aufzuzeigen. Die Arbeit basiert auf der Analyse von Hörfähigkeit, Sprachverständnis und den Einflussfaktoren der Raumakustik auf das Lernen.
- Beeinträchtigung des Sprachverständnisses durch Lärm bei Hörschädigung
- Einflussfaktoren der Raumakustik auf die Sprachverständlichkeit
- Unterschiede im Hör- und Sprachverständnis zwischen Kindern und Erwachsenen
- Notwendige Anpassungen der Lernumgebung für hörgeschädigte Schüler
- Möglichkeiten zur Verbesserung der Klassenraumakustik
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und verdeutlicht die besondere Problematik von Lärm für Kinder und Jugendliche mit Hörschädigungen. Sie betont die doppelte Benachteiligung dieser Schülergruppe und skizziert den Aufbau der Arbeit, der sich mit dem Hören und Verstehen, der akustischen Situation im Klassenzimmer und möglichen Verbesserungsmaßnahmen auseinandersetzt. Das Zitat von Arthur Schopenhauer unterstreicht die zentrale Bedeutung des Problems: Lärm stört nicht nur, sondern behindert auch das Denken und die kognitiven Prozesse erheblich, insbesondere bei Kindern mit eingeschränkter Hörfähigkeit.
2. Hören und Verstehen: Dieses Kapitel differenziert zwischen dem "normalen" Hören und Verstehen und dem Hören und Verstehen bei einer Hörschädigung. Es wird erläutert, dass "perfektes Hören" die Wahrnehmung von 100% der Informationen im Sprachsignal bedeutet, jedoch ein geringerer Prozentsatz zum Verständnis ausreicht. Dabei wird der Unterschied zwischen Erwachsenen und Kindern hervorgehoben: Während Erwachsene mit 50-60% der Informationen auskommen, benötigen Kinder 90-100%, besonders in der Schule, da ihnen Erfahrung und Weltwissen zum Schließen von Informationslücken fehlen. Das Kapitel beleuchtet die "Sprachbanane" und die besondere Bedeutung hochfrequenter Konsonanten für das Verständnis, unterstützt durch die Erläuterung des Phänomens des Flüsterns.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Klassenraumakustik und Hörschädigung
Was ist das zentrale Thema dieses Textes?
Der Text untersucht die Auswirkungen von Klassenraumakustik auf Kinder und Jugendliche mit Hörschädigung. Im Fokus stehen die Herausforderungen für hörgeschädigte Schüler im Unterricht und mögliche Verbesserungen der Lernumgebung.
Welche Aspekte des Hörens und Verstehens werden behandelt?
Der Text differenziert zwischen "normalem" Hören und dem Hören mit Hörschädigung. Er beleuchtet den Unterschied im Informationsbedarf zum Sprachverständnis zwischen Erwachsenen und Kindern (Erwachsene benötigen 50-60%, Kinder 90-100%), die Bedeutung hochfrequenter Konsonanten und den Einfluss von Lärm und Hintergrundgeräuschen.
Welche Einflussfaktoren der Raumakustik werden betrachtet?
Der Text analysiert den Einfluss von Distanz, Störschall, Signal-Rausch-Abstand und Nachhall auf die Sprachverständlichkeit im Klassenzimmer. Es wird deutlich gemacht, wie diese Faktoren die Hörleistung von Kindern mit Hörschädigung besonders beeinträchtigen.
Wie wird die Problematik von Lärm im Klassenzimmer behandelt?
Der Text betont die negative Auswirkung von Lärm auf das Sprachverständnis, insbesondere bei hörgeschädigten Schülern. Es wird auf die doppelte Benachteiligung dieser Schülergruppe hingewiesen und die Notwendigkeit von Maßnahmen zur Lärmreduzierung hervorgehoben.
Welche Verbesserungsmaßnahmen zur Verbesserung der Raumakustik werden vorgeschlagen?
Der Text skizziert Möglichkeiten zur Verbesserung der Raumakustik im Klassenzimmer, um die Lernbedingungen für hörgeschädigte Schüler zu optimieren. Konkrete Maßnahmen werden jedoch nicht detailliert beschrieben.
Welche Kapitel umfasst der Text und worum geht es jeweils?
Der Text gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung (Einführung in die Thematik), Hören und Verstehen (Differenzierung zwischen normalem und beeinträchtigtem Hören), Situation im Klassenraum (Einflussfaktoren der Raumakustik), Fazit (Zusammenfassung der Ergebnisse) und Verzeichnis (Literatur und Bilder). Jedes Kapitel befasst sich mit einem Aspekt der Thematik, beginnend mit einer allgemeinen Einführung und endend mit einer Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse.
Welche Zielsetzung verfolgt der Text?
Der Text zielt darauf ab, die besonderen Herausforderungen für hörgeschädigte Schüler im Klassenzimmer aufzuzeigen und mögliche Verbesserungsmaßnahmen aufzuzeigen. Er untersucht die Beeinträchtigung des Sprachverständnisses durch Lärm, die Einflussfaktoren der Raumakustik und notwendige Anpassungen der Lernumgebung.
Für wen ist dieser Text relevant?
Dieser Text ist relevant für Pädagogen, Audiologen, Eltern von hörgeschädigten Kindern und alle, die sich mit der Inklusion von hörgeschädigten Schülern im Bildungssystem auseinandersetzen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Text?
Schlüsselwörter sind: Klassenraumakustik, Hörschädigung, Sprachverständnis, Lärm, Signal-Rausch-Abstand, Nachhall, Inklusion, Lernumgebung, Hörfähigkeit.
- Citar trabajo
- Katrin Hausenbiegl (Autor), 2015, Hören und Verstehen. Bedeutung der Akustik im Klassenzimmer für Kinder und Jugendliche mit Hörschädigung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/313163