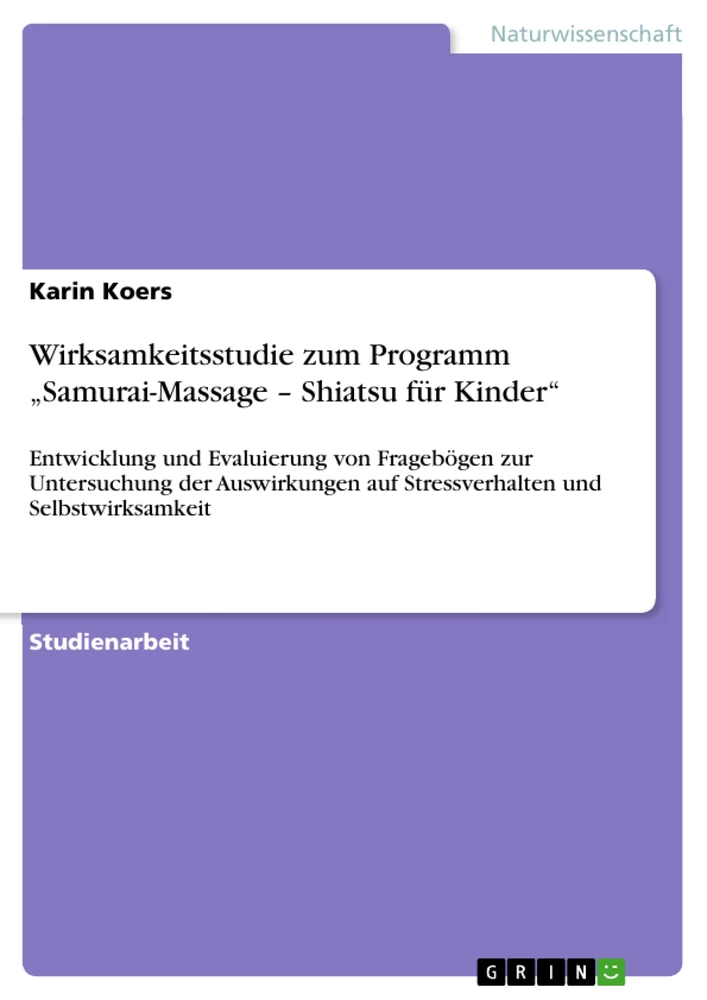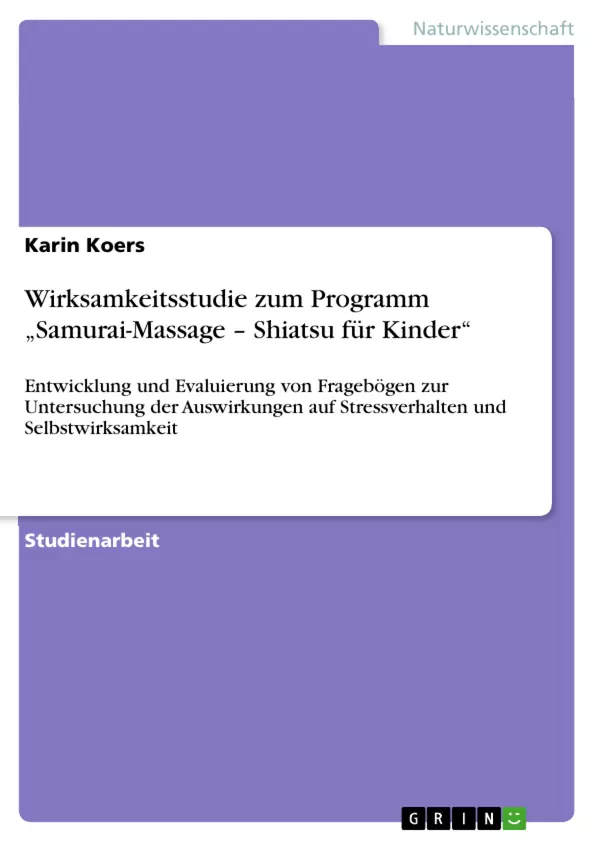Die vorliegende Arbeit untersucht im Rahmen eines Pilotprojekts die Wirkungsweise des Samurai-Programms, einer Abfolge von Shiatsu-Übungen für Schüler, auf das Stressverhalten und die Selbstwirksamkeit von Schülern. In einer zweistufigen, fragebogengestützten Erhebung werden hierzu von Schülern Daten zum Umgang mit Stress (Innensicht) und von den Lehrern Informationen zu den Erwartungen und Wirkungen des Programms (Außensicht) erhoben. Für die Schüler wird auf einen vorhandenen Fragebogen zu Stress und Stressbewältigung bei Kindern und Jugendlichen zurückgegriffen (SSKJ 3-8). Die Entwicklung des Fragebogens für Lehrer erfolgt im Rahmen dieser Arbeit. Basierend auf einem explorativ angelegten Eingangsfragebogen wird im Projektverlauf rekursiv der Folgefragebogen entwickelt und der Standardisierungsgrad so schrittweise erhöht. In der Auswertung werden die Ergebnisse beider Befragungsteile aggregiert und zur Bewertung der aufgestellten Hypothesen bezüglich der Wirksamkeit des Programms unter den Aspekten Selbstwirksamkeit, Sozialkompetenz und Körperhaltung herangezogen.
Die Erkenntnisse dieser Pilotstudie fließen ein in geplante Langzeitstudie zum Einsatz des Samurai-Programms ein.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- ZUSAMMENFASSUNG
- 1 EINLEITUNG
- 2 FORSCHUNGSSTAND UND THEORIE
- 2.1 THEORETISCHER UND EMPIRISCHER FORSCHUNGSSTAND ZUM THEMA
- 2.1.1 Shiatsu für Kinder – Hintergründe und Wirkungsansatz
- 2.1.2 Stress und Selbstwirksamkeit
- 2.1.3 Forschungsstand
- 2.2 THEORETISCHES MODELL DER STUDIE
- 3 FRAGESTELLUNGEN UND HYPOTHESEN
- 4 METHODE
- 4.1 UNTERSUCHUNGSDESIGN
- 4.1.1 Elemente der Befragung
- 4.1.2 Ethische Betrachtung und Informationspflicht
- 4.2 INSTRUMENTE UND MESSGERÄTE
- 4.2.1 Bewertung des SSKJ 3-8 zum Einsatz als Schülerfragebogen
- 4.2.2 Lehrer-Fragebogen
- 4.2.3 Begleitendes Interview
- 4.3 STICHPROBENKONSTRUKTION
- 4.3.1 Geplante Stichprobe
- 4.3.2 Tatsächliche Stichprobe
- 4.4 UNTERSUCHUNGSDURCHFÜHRUNG
- 4.5 DATENANALYSE
- 5 ERGEBNISSE
- 5.1 STICHPROBENBESCHREIBUNG
- 5.2 ERGEBNISSE ZU DEN EINZELNEN FRAGESTELLUNGEN UND HYPOTHESEN
- 5.2.1 Vergleich mit den standardisierten Werten
- 5.2.2 Signifikanz der Veränderungen
- 5.2.3 Prüfung der Hypothese „Selbstwirksamkeit“
- 5.2.4 Prüfung der Hypothese „Sozialkompetenz“
- 5.2.5 Prüfung der Hypothese „Körperhaltung“
- 5.3 WEITERE BEFUNDE
- 5.3.1 Änderungen am Schülerfragebogen
- 5.3.2 Änderungen am Lehrerfragebogen
- 6 ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK
- 7 LITERATURVERZEICHNIS
- A ANHANG
- A.1 ERGEBNISSE DER LEHRERFRAGEBÖGEN
- A.1.1 Fragebogen zum Projektstart
- A.1.2 Fragebogen zum Projektende
- A.2 DATENERFASSUNG UND -ANALYSE
- A.2.1 Wertelabels zum Schülerfragebogen
- A.2.2 Logfile Definition der Skalen
- A.2.3 Logfile Klassifikation nach Normwerten
- A.3 ERGEBNISSE DER DATENANALYSE
- A.3.1 Häufigkeitstabellen der Skalen
- A.3.2 Spezifische Häufigkeitstabellen Mädchen
- A.3.3 Veränderungen nach klassifizierten Skalen, Klasse 6f
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Arbeit zielt darauf ab, die Wirksamkeit des Samurai-Programms, einer Reihe von Shiatsu-Übungen für Schüler, auf das Stressverhalten und die Selbstwirksamkeit von Schülern im Rahmen eines Pilotprojekts zu untersuchen. Das Programm wird in mehreren Klassen eines hessischen Gymnasiums eingeführt und seine Auswirkungen mittels mehrstufiger Befragungen von Schülern und Lehrkräften erfasst.
- Wirksamkeit von Shiatsu bei Kindern in Bezug auf Stressverhalten
- Entwicklung und Evaluierung von Fragebögen zur Erfassung von Stress und Selbstwirksamkeit bei Schülern
- Eignung des Samurai-Programms als Interventionsprogramm in schulischen Kontexten
- Bedeutung von Selbstwirksamkeit im Umgang mit Stresssituationen
- Explorativer Ansatz zur Gewinnung von Erkenntnissen für zukünftige groß angelegte Studien
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Kapitel 1: Einleitung: Einführung des Themas, Bedeutung von Wirksamkeitsstudien in der Komplementärtherapie, Zielsetzung und Aufbau der Studie
- Kapitel 2: Forschungsstand und Theorie: Vorstellung von Shiatsu und dem Samurai-Programm, Definition von Stress und Selbstwirksamkeit, Übersicht des aktuellen Forschungsstandes zum Thema
- Kapitel 3: Fragestellungen und Hypothesen: Definition der in der Studie untersuchten Thesen zur Wirksamkeit des Samurai-Programms in Bezug auf Selbstwirksamkeit, Sozialkompetenz und Körperhaltung
- Kapitel 4: Methode: Beschreibung des Untersuchungsdesigns, der verwendeten Instrumente (Fragebögen, Interview), Stichprobenkonstruktion, Durchführung und Datenanalyse
- Kapitel 5: Ergebnisse: Beschreibung der Stichprobe, Ergebnisse der Datenanalyse, Vergleich mit den standardisierten Werten des Fragebogens, statistische Signifikanz der Veränderungen, Prüfung der aufgestellten Hypothesen
Schlüsselwörter (Keywords)
Shiatsu, Samurai-Massage, Stressverhalten, Selbstwirksamkeit, Kinder, Jugendliche, Schule, Pilotprojekt, Fragebogen, Wirksamkeitsstudie, SSKJ 3-8, explorative Untersuchung, Begleitendes Interview, Datenanalyse, Methodenentwicklung, Optimierungspotential, Evaluation.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das „Samurai-Programm“?
Das Samurai-Programm ist eine strukturierte Abfolge von Shiatsu-Übungen, die speziell für Kinder im Schulalltag entwickelt wurden, um Stress abzubauen und die Körperwahrnehmung zu fördern.
Wie wirkt Shiatsu auf Schüler?
Shiatsu kann helfen, das Stressverhalten zu verbessern, die Konzentration zu steigern, die Sozialkompetenz innerhalb der Klasse zu stärken und die Körperhaltung zu korrigieren.
Was war das Ziel der Wirksamkeitsstudie?
Die Pilotstudie untersuchte, inwieweit das Programm die Selbstwirksamkeit und das Stressbewältigungsverhalten der Schüler positiv beeinflusst.
Welche Instrumente wurden zur Datenerhebung genutzt?
Es wurden standardisierte Fragebögen für Schüler (SSKJ 3-8), neu entwickelte Fragebögen für Lehrer sowie begleitende Interviews eingesetzt.
Was bedeutet Selbstwirksamkeit im Kontext dieser Studie?
Selbstwirksamkeit bezeichnet die Überzeugung der Schüler, schwierige Situationen und Herausforderungen (wie Stress in der Schule) aus eigener Kraft erfolgreich bewältigen zu können.
- Quote paper
- Karin Koers (Author), 2013, Wirksamkeitsstudie zum Programm „Samurai-Massage – Shiatsu für Kinder“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/313730