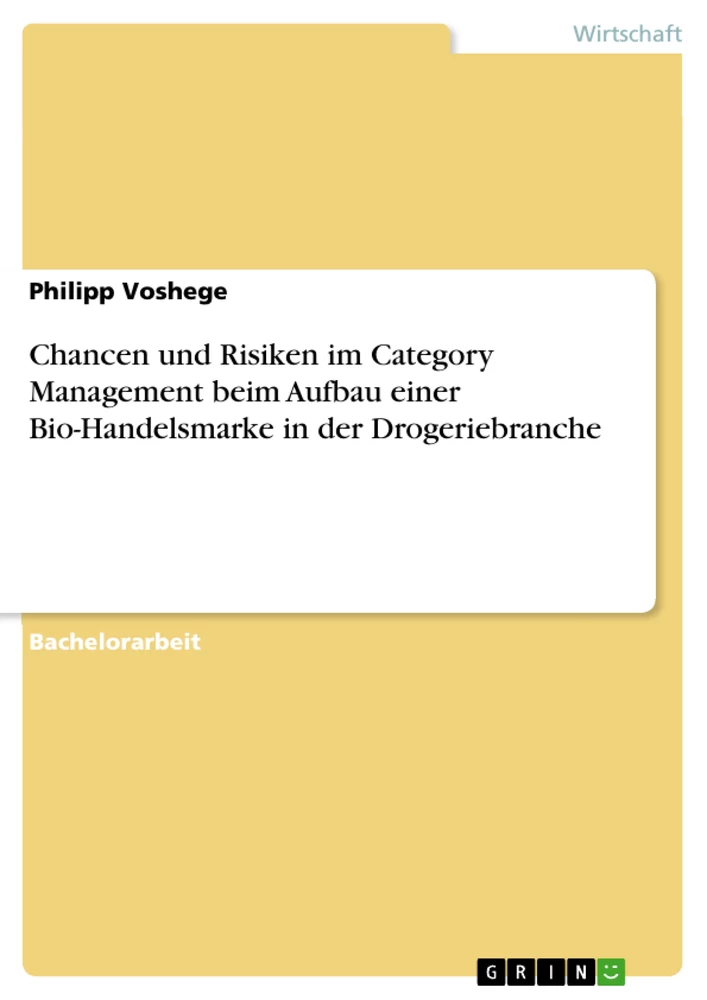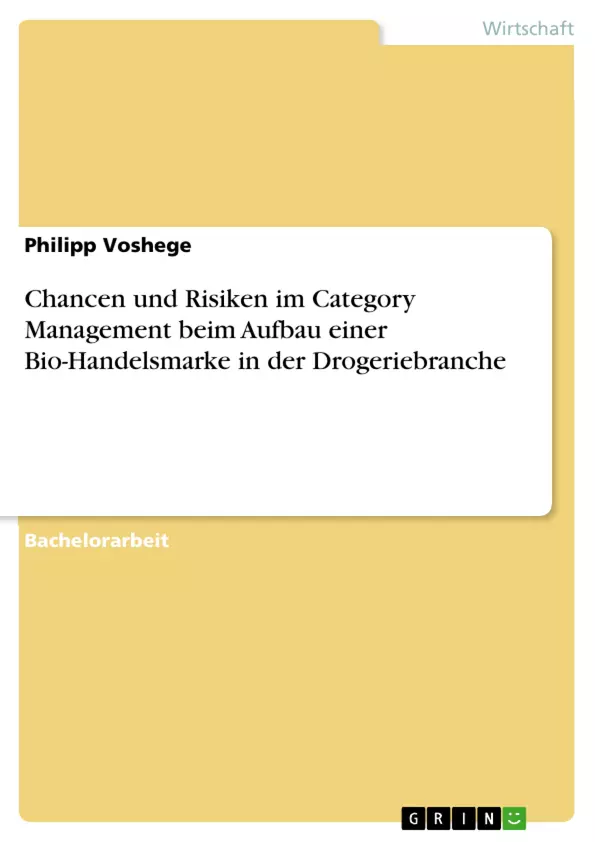Die Eigenprodukte der Handelsketten im deutschen Lebensmitteleinzelhandel (LEH), sog. Handelsmarken, nehmen einen immer größeren Anteil im Rahmen des Gesamtsortiments ein. Im Jahre 2015 machen Handelsmarken bereits über vierzig Pro-zent des Gesamtumsatzes im deutschen LEH aus. Eine ähnliche Entwicklung vollzieht sich innerhalb des Lebensmittelsektors der großen Drogerieketten.
Die großen Drogeriehandelsunternehmen bieten vor allem biologische Lebensmittel im Trockensortiment an und gehen zunehmend dazu über, in diesem Bereich auch eigene Bio-Handelsmarken anzubieten. So führt die große Drogeriemarktkette Rossmann seit 2003 die Bio-Handelsmarke „enerBiO“ mit inzwischen mehr als 340 Produkten. Die marktführende Drogeriemarktkette dm-drogerie markt bringt im April diesen Jahres die eigene Bio-Handelsmarke „dm Bio“ auf den Markt und tritt damit zu der bisher und auch weiterhin bei dm-drogerie markt geführten Bio-Herstellermarke „Alnatura“ in Konkurrenz. Insofern bezieht sich die Fragestellung nach Chancen und Risiken beim Aufbau einer Bio-Handelsmarke in der Drogeriebranche auf einen sehr realen Hinter-grund, den es in dieser Arbeit zu beleuchten gilt. Das in der Fragestellung genannte Category Management erhält seine Bedeutung durch die hohe Relevanz dieser Methode für das moderne Marketing.
Ein Handelsunternehmen, welches selbst die Verantwortung für Herstellung und Vermarktung einer eigenen Bio-Handelsmarke übernimmt, setzt sich damit einem großen Umstrukturierungsprozess aus, der in finanzieller und organisatorischer Hinsicht viele Unwägbarkeiten beinhaltet. Bei der Unternehmensführung müssen die Aussichten auf einen erfolgreichen Prozess stärker gewichtet sein als die Bedenken, sonst könnte ein solches Projekt nicht gestartet werden. Klarheit kann ein Unternehmen in dieser strategischen Entscheidungssituation nur durch eine umfassende rationale Analyse des Für und Wider dieses Vorhabens gewinnen.
Vor diesem Hintergrund ist es die zentrale Zielsetzung dieser Arbeit auf der Basis der Fachliteratur herauszuarbeiten, welche Chancen und welche Risiken sich im Category Management beim Aufbau einer Bio-Handelsmarke in der Drogeriebranche ergeben und die beiden Pole in einer abschließenden Beurteilung gegeneinander abzuwägen. Die Analyse nimmt keinen konkreten Bezug auf die erwähnte Umstrukturierung bei dem Handelsunternehmen dm-drogerie markt, da das Unternehmen dazu keine für eine Analyse relevanten Details veröffentlicht hat.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Problemstellung und Zielsetzung
- 1.2 Vorgehensweise und Aufbau
- 2. Category Management (CM)
- 2.1 Historische Entwicklung im Rahmen des Efficient Consumer Response-Konzepts
- 2.1.1 Veränderung auf Konsumentenseite
- 2.1.2 Veränderung auf Handelsseite
- 2.1.3 Veränderung auf Herstellerseite
- 2.1.4 Von Konfrontation zu Kooperation
- 2.1.5 Efficient Consumer Response (ECR)
- 2.1.6 Supply Chain Management (SCM)
- 2.1.7 Category Management (CM)
- 2.2 Begriffsbestimmung Category Management (CM)
- 2.3 Konzeptmerkmale
- 2.3.1 Zielsetzung
- 2.3.2 Organisationsformen
- 2.3.2.1 CM auf Handelsseite
- 2.3.2.2 CM auf Herstellerseite
- 2.3.2.3 Kooperatives CM
- 2.3.3 Datenanalyse
- 2.3.3.1 Kundennähe durch Marktforschung
- 2.3.3.2 Auswertung der PoS-Daten
- 2.3.3.3 Kennzahlen
- 2.3.3.4 Controlling
- 2.3.3.5 Empirische Erfolgsforschung
- 2.4 Achtschrittiger CM-Planungsprozess
- 2.4.1 Kategorie-Definition
- 2.4.2 Kategorie-Rolle
- 2.4.3 Kategorie-Analyse
- 2.4.4 Kategorie-Ziele
- 2.4.5 Kategorie-Strategien
- 2.4.6 Kategorie-Taktiken
- 2.4.7 Kategorie-Planumsetzung
- 2.4.8 Kategorie-Erfolgskontrolle
- 2.5 Basisstrategien
- 2.5.1 Efficient Assortment
- 2.5.2 Efficient Promotion
- 2.5.3 Efficient Product Introduction
- 2.1 Historische Entwicklung im Rahmen des Efficient Consumer Response-Konzepts
- 3. Bio-Handelsmarken
- 3.1 Begriffsbestimmungen
- 3.1.1 Bio-Lebensmittel
- 3.1.2 Marke
- 3.1.3 Handelsmarke
- 3.1.4 Bio-Handelsmarke
- 3.2 Marktsituation von Bio-Lebensmitteln in Deutschland
- 3.2.1 Historie
- 3.2.2 Umsätze
- 3.2.3 Sortimente
- 3.3 Motive für den Kauf von Bio-Lebensmitteln
- 3.4 Beschaffungsproblematik
- 3.5 Bio-Handelsmarken im CM-Planungsprozess
- 3.5.1 Kundenbedürfnisse und Unternehmensstrategie
- 3.5.2 Kategorie-Definition und Kategorie-Rolle
- 3.5.3 Bio-Sortimentsstrategien
- 3.5.4 Bio-Handelsmarken-Taktiken
- 3.1 Begriffsbestimmungen
- 4. Marktstruktur in der Drogeriebranche
- 4.1 Begriffsbestimmung Drogerie
- 4.2 Umsatz und Marktanteile
- 4.3 Branchenspezifischer CM-Planungsprozess
- 4.3.1 Unternehmensstrategien, Kundenbedürfnisse und Enabling Technologies
- 4.3.2 Kategorie-Definition und Kategorie-Rolle Babynahrung
- 4.3.3 Kategorie-Analyse
- 4.3.4 Kategorie-Planumsetzung
- 4.3.5 Kategorie-Erfolgskontrolle
- 5. Aufbau einer Bio-Handelsmarke im Category Management der Drogeriebranche
- 5.1 Idealtypischer CM-Planungsprozess – Fallbeispiel
- 5.1.1 Unternehmensstrategie
- 5.1.2 Kundenbedürfnisse
- 5.1.3 Kategorie-Definition und -Rolle
- 5.1.4 Kategorie-Analyse und -Ziele
- 5.1.5 Kategorie-Strategien
- 5.1.6 Kategorie-Taktiken
- 5.1.7 Kategorie-Planumsetzung
- 5.1.8 Kategorie-Erfolgskontrolle
- 5.2 Chancen und Risiken
- 5.2.1 Vorteile durch CM und ECR
- 5.2.2 Beschaffungsproblematik und Kundenvertrauen
- 5.2.3 Konflikte mit Hersteller
- 5.2.4 Operative Gesichtspunkte
- 5.2.5 Strategische Gesichtspunkte
- 5.1 Idealtypischer CM-Planungsprozess – Fallbeispiel
- 6. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Chancen und Risiken des Aufbaus einer Bio-Handelsmarke im Category Management (CM) der deutschen Drogeriebranche. Die zentrale Fragestellung wird anhand eines Fallbeispiels und der Analyse relevanter Fachliteratur beantwortet.
- Category Management als strategisches Konzept im Handel
- Definition und Marktsituation von Bio-Handelsmarken
- Marktstruktur der deutschen Drogeriebranche
- Idealtypischer CM-Planungsprozess für Bio-Handelsmarken
- Chancen-Risiken-Analyse für den Aufbau einer Bio-Handelsmarke
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Arbeit untersucht Chancen und Risiken beim Aufbau einer Bio-Handelsmarke in der Drogeriebranche unter Verwendung von Category Management. Der Fokus liegt auf einer rationalen Analyse der Vor- und Nachteile dieses Vorhabens für Handelsunternehmen, basierend auf der Fachliteratur.
2 Category Management (CM): Dieses Kapitel beleuchtet das Category Management-Konzept als integralen Bestandteil von Efficient Consumer Response (ECR). Es beschreibt die historische Entwicklung, die Definition des Begriffs, die Konzeptmerkmale (Zielsetzung, Organisationsformen, Datenanalyse), den achtschrittigen Planungsprozess und die drei Basisstrategien (Efficient Assortment, Efficient Promotion, Efficient Product Introduction). Der Schwerpunkt liegt auf der kundenorientierten Steuerung von Warengruppen zur Steigerung von Umsatz und Gewinn.
3 Bio-Handelsmarken: Dieses Kapitel definiert Bio-Lebensmittel und Handelsmarken und beschreibt die Marktsituation von Bio-Lebensmitteln in Deutschland, einschließlich Umsatzentwicklung, Sortimentsgestaltung und Käufermotiven. Es beleuchtet die Beschaffungsproblematik im Bio-Bereich und zeigt auf, wie Bio-Handelsmarken in den CM-Planungsprozess integriert werden können. Der Fokus liegt auf Kundenbedürfnissen, der Definition von Bio-Handelsmarken-Kategorien und verschiedenen Sortimentsstrategien.
4 Marktstruktur in der Drogeriebranche: Dieses Kapitel beschreibt die Marktstruktur der deutschen Drogeriebranche, inklusive Umsatzanteile der wichtigsten Akteure. Es analysiert einen konkreten CM-Planungsprozess eines gemeinsamen Projekts von dm-drogerie markt und Nestlé im Bereich Babynahrung, um branchenspezifische Besonderheiten aufzuzeigen.
5 Aufbau einer Bio-Handelsmarke im Category Management der Drogeriebranche: Dieses Kapitel präsentiert ein fiktives Fallbeispiel einer Drogeriemarktkette, die eine Bio-Handelsmarke einführen möchte. Es beschreibt einen idealtypischen CM-Planungsprozess, inklusive Unternehmensstrategie, Kundenbedürfnisse, Kategorie-Definition und -Rolle, Kategorie-Analyse und -Ziele, Kategorie-Strategien und -Taktiken, Kategorie-Planumsetzung und -Erfolgskontrolle. Abschließend werden die Chancen und Risiken dieses Vorhabens diskutiert, unter Berücksichtigung von operativen und strategischen Aspekten, sowie potenzieller Konflikte mit Herstellern.
Schlüsselwörter
Category Management, Efficient Consumer Response (ECR), Bio-Handelsmarken, Drogeriebranche, Marktstruktur, Kundenbedürfnisse, Sortimentsgestaltung, Preisstrategie, Verkaufsförderung, Risiken, Chancen, Bio-Lebensmittel, Marktforschung, Kooperation, Handelsmarken, Herstellermarken.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Aufbau einer Bio-Handelsmarke im Category Management der Drogeriebranche
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Chancen und Risiken des Aufbaus einer Bio-Handelsmarke im Category Management (CM) der deutschen Drogeriebranche. Die zentrale Fragestellung wird anhand eines Fallbeispiels und der Analyse relevanter Fachliteratur beantwortet.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Category Management als strategisches Konzept im Handel, die Definition und Marktsituation von Bio-Handelsmarken, die Marktstruktur der deutschen Drogeriebranche, einen idealtypischen CM-Planungsprozess für Bio-Handelsmarken und eine Chancen-Risiken-Analyse für den Aufbau einer Bio-Handelsmarke.
Was ist Category Management (CM)?
Das zweite Kapitel erläutert das Category Management-Konzept als integralen Bestandteil von Efficient Consumer Response (ECR). Es beschreibt die historische Entwicklung, Begriffsbestimmung, Konzeptmerkmale (Zielsetzung, Organisationsformen, Datenanalyse), den achtschrittigen Planungsprozess und drei Basisstrategien (Efficient Assortment, Efficient Promotion, Efficient Product Introduction). Der Schwerpunkt liegt auf der kundenorientierten Steuerung von Warengruppen zur Umsatz- und Gewinnsteigerung.
Was sind Bio-Handelsmarken und wie ist ihre Marktsituation?
Kapitel drei definiert Bio-Lebensmittel und Handelsmarken und beschreibt die Marktsituation von Bio-Lebensmitteln in Deutschland, inklusive Umsatzentwicklung, Sortimentsgestaltung und Käufermotiven. Es beleuchtet die Beschaffungsproblematik im Bio-Bereich und zeigt, wie Bio-Handelsmarken in den CM-Planungsprozess integriert werden können. Der Fokus liegt auf Kundenbedürfnissen, der Definition von Bio-Handelsmarken-Kategorien und verschiedenen Sortimentsstrategien.
Wie ist die Marktstruktur der deutschen Drogeriebranche?
Kapitel vier beschreibt die Marktstruktur der deutschen Drogeriebranche, inklusive Umsatzanteile der wichtigsten Akteure. Es analysiert einen konkreten CM-Planungsprozess eines gemeinsamen Projekts von dm-drogerie markt und Nestlé im Bereich Babynahrung, um branchenspezifische Besonderheiten aufzuzeigen.
Wie sieht ein idealtypischer CM-Planungsprozess für eine Bio-Handelsmarke aus?
Kapitel fünf präsentiert ein fiktives Fallbeispiel einer Drogeriemarktkette, die eine Bio-Handelsmarke einführen möchte. Es beschreibt einen idealtypischen CM-Planungsprozess, inklusive Unternehmensstrategie, Kundenbedürfnisse, Kategorie-Definition und -Rolle, Kategorie-Analyse und -Ziele, Kategorie-Strategien und -Taktiken, Kategorie-Planumsetzung und -Erfolgskontrolle.
Welche Chancen und Risiken birgt der Aufbau einer Bio-Handelsmarke?
Im fünften Kapitel werden die Chancen und Risiken dieses Vorhabens diskutiert, unter Berücksichtigung von operativen und strategischen Aspekten, sowie potenzieller Konflikte mit Herstellern.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Category Management, Efficient Consumer Response (ECR), Bio-Handelsmarken, Drogeriebranche, Marktstruktur, Kundenbedürfnisse, Sortimentsgestaltung, Preisstrategie, Verkaufsförderung, Risiken, Chancen, Bio-Lebensmittel, Marktforschung, Kooperation, Handelsmarken, Herstellermarken.
- Citar trabajo
- Philipp Voshege (Autor), 2015, Chancen und Risiken im Category Management beim Aufbau einer Bio-Handelsmarke in der Drogeriebranche, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/313770