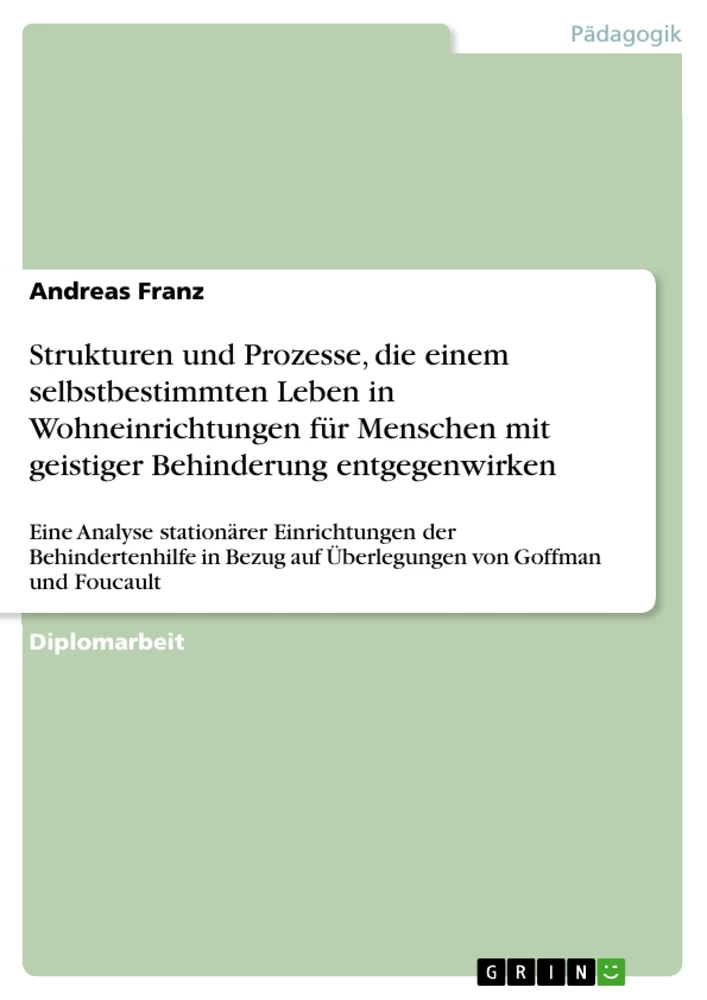Der Autor untersucht Strukturen und Prozesse in stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe, die einem selbstbestimmten Leben der dort lebenden Menschen entgegenwirken. Dabei geht er zunächst auf aktuelle Entwicklungen im sonderpädagogischen Diskurs ein, eher er die Situation der in Wohnheimen für Menschen mit geistiger Behinderung lebenden Menschen mit der Situation von Straffälligen und Deliquenten in Foucaults "Überwachen und Strafen" und der Situation der Insassen in Goffmans "totalen Institutionen" vergleicht.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Theoretischer Rahmen
- Die Relevanz von Bildungsqualität
- Schlüsselkonzepte der Bildungsqualität
- Forschungsstand und -lücken
- Methodisches Vorgehen
- Datenerhebung und -aufbereitung
- Analyseverfahren
- Ergebnisse der Analyse
- Qualität der Bildungsangebote
- Chancengleichheit und soziale Ungleichheit
- Faktoren, die die Bildungsqualität beeinflussen
- Diskussion
- Interpretation der Ergebnisse
- Implikationen für die Praxis
- Zukünftige Forschungsbedarfe
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Arbeit zielt darauf ab, die Bildungsqualität in Deutschland zu untersuchen. Sie analysiert die relevanten Schlüsselkonzepte und den aktuellen Forschungsstand, um die wichtigsten Faktoren zu identifizieren, die die Bildungsqualität beeinflussen.
- Bildungsqualität und ihre Bedeutung
- Schlüsselkonzepte der Bildungsqualität
- Faktoren, die die Bildungsqualität beeinflussen
- Chancengleichheit und soziale Ungleichheit im Bildungssystem
- Implikationen für die Bildungspolitik und -praxis
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Einleitung: Dieses Kapitel liefert eine Einführung in die Thematik der Bildungsqualität in Deutschland und skizziert die Relevanz des Themas sowie die Zielsetzung und Struktur der Arbeit.
- Theoretischer Rahmen: Dieses Kapitel beleuchtet die zentralen Konzepte der Bildungsqualität und diskutiert den aktuellen Forschungsstand sowie relevante Forschungsergebnisse.
- Methodisches Vorgehen: Dieses Kapitel beschreibt die angewandte Methodik, einschließlich Datenerhebung, Datenaufbereitung und Analyseverfahren.
- Ergebnisse der Analyse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Analyse der Bildungsqualität in Deutschland. Es werden wichtige Erkenntnisse zur Qualität der Bildungsangebote, Chancengleichheit und den Faktoren, die die Bildungsqualität beeinflussen, gewonnen.
- Diskussion: Dieses Kapitel interpretiert die Ergebnisse und leitet daraus Implikationen für die Bildungspolitik und -praxis ab. Es werden auch zukünftige Forschungsbedarfe diskutiert.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen der Bildungsqualität in Deutschland, darunter Bildungsstandards, Leistungsniveaus, Chancengleichheit, soziale Ungleichheit, Lehrkräftequalität, Schulqualität, Bildungsmanagement, Bildungspolitik und Bildungsreformen.
- Citation du texte
- Andreas Franz (Auteur), 2015, Strukturen und Prozesse, die einem selbstbestimmten Leben in Wohneinrichtungen für Menschen mit geistiger Behinderung entgegenwirken, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/313862