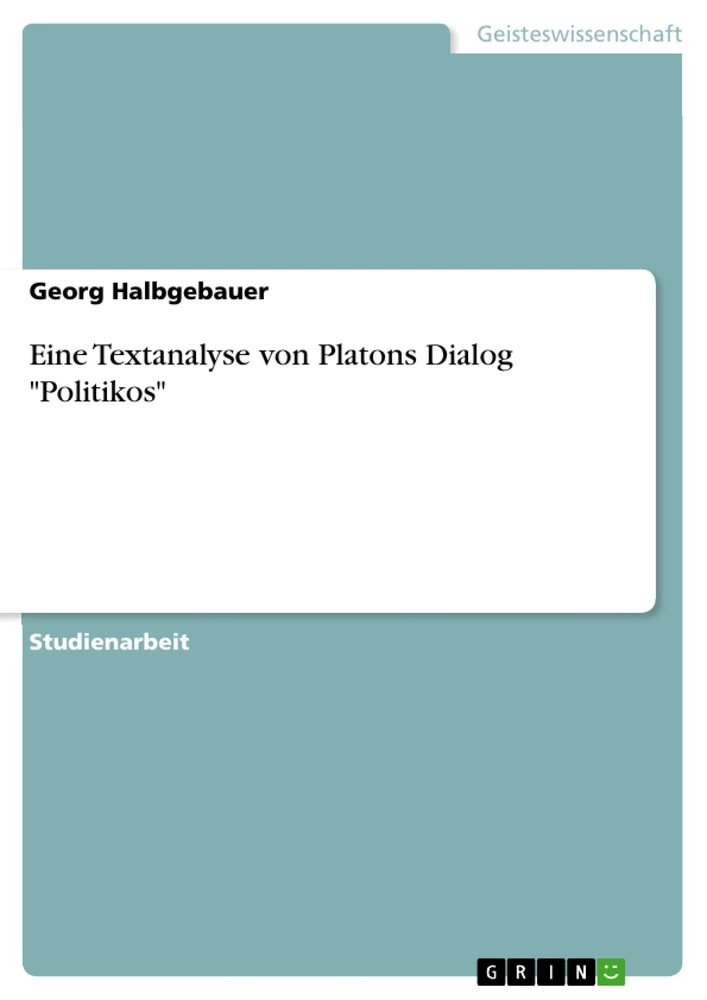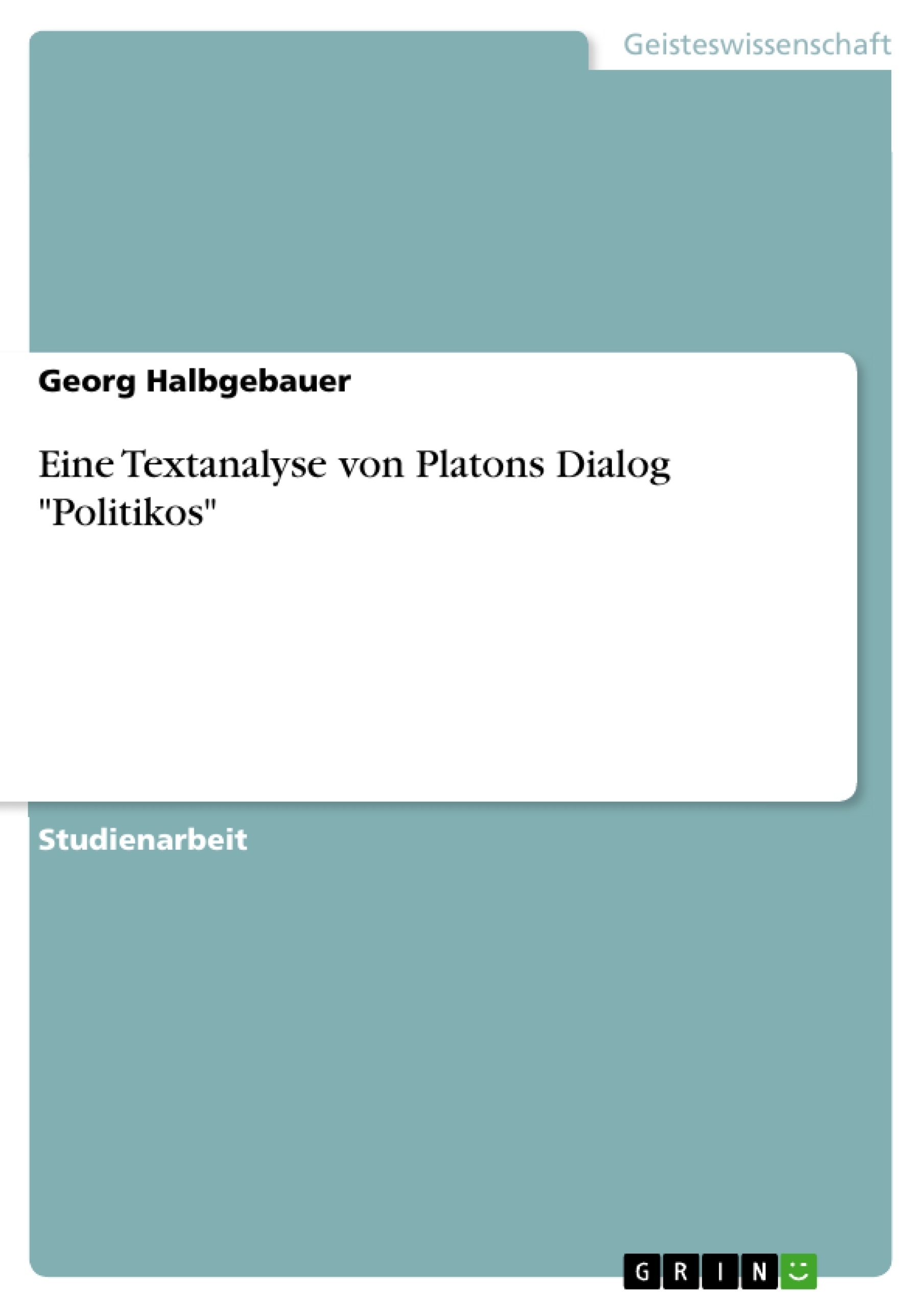Der Dialog „Politikos“ ist ein um 365/347 v. Chr. Entstandenes Werk aus der Feder Platons (428 – 348 v.Chr.). Es gehört zur zweiten Tetralogie, ist seinem Spätwerk zuzuordnen und gehört hierbei schwerpunktmäßig zur politischen Philosophie. Platon war ein Schüler des Sokrates und Begründer der Ideenlehre. Sein umfangreich erhaltenes philosophisches Werk übte und übt großen Einfluss auf die abendländische Philosophie aus.
Das wahre und kunstgerechte Werkzeug zur philosophischen Erkenntnisgewinnung ist der Dialog sowie die ebenfalls im „Siebten Brief" angeführte Methode der Fünf Erkenntnisstufen, an deren Anfang die sprachliche Benennung einer Sache steht. Dieser folgt die Definition des Wortes durch das Bezeichnete. Die sprachliche Bestimmung übergeordnet ist das bezeichnete Objekt selbst. Die nächsthöhere Stufe bildet die deduzierte theoretische Erkenntnis über eine Sache. Und die Krönung des Erkenntnisprozesses bildet die Schau der Ideen selbst.
Dementsprechend weisen Platons Dialoge oft über sich hinaus, bleiben eine Antwort auf die von ihnen aufgeworfene Frage schuldig und wirken oft mehr literarisch verspielt als philosophisch ernst. In diesem Kontext ließe sich vermuten, dass die Konzeption seiner Texte als Dialog eine implizite Aufforderung an den Leser beinhaltet, selbst philosophische Diskussionen zu führen statt sich im Studierzimmer zu verbarrikadieren. Außerdem bietet die Dialogform den Vorteil, dass der Autor hinter die sprechenden Charaktere zurücktreten kann, kein Zwang zu inhaltlicher Geschlossenheit besteht und der Leser mehr zum Mitdenken animiert wird, als dies bei einer reinen Lehrschrift der Fall wäre.
Inhaltlich sucht Platon im „Politikos“ nach einer präzisen Bestimmung des Staatsmannes und der besten Staatsform. Da diese Fragestellung allerding im Grunde genommen bereits in seinem Dialog „Politeia“ ausreichend beantwortet wurde, ist der „Politikos“ wohl weniger inhaltlich als eher als methodisches Lehrbeispiel von Interesse.
Dialektisch hat hier natürlich nichts mit These, Antithese und Synthese oder dem hegelianischen Relativismus zu tun, sondern es geht lediglich um eine präzise philosophische Begriffsarbeit vermittels der dihairetischen Methode. Dabei wird ein Begriff solange in mindestens zwei Unterbegriffe geteilt, bis keine Teilung mehr möglich ist, um so zum Wesen einer Sache vorzudringen. Neben einer präzisen Begriffsdefinition führt sie auch zu einem hierarchischen System von Ober- und Unterbegriffen.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Einleitung
- Kapitel 1.
- Kapitel 2.
- Kapitel 3.
- Kapitel 4.
- Kapitel 5.
- Kapitel 6.
- Kapitel 7.
- Kapitel 8.
- Kapitel 9.
- Kapitel 10.
- Kapitel 11.
- Kapitel 12.
- Kapitel 13-16.
- Kapitel 17.
- Kapitel 18.
- Kapitel 19.
- Kapitel 20.
- Kapitel 21.-23
- Kapitel 24. und 25.
- Kapitel 27.-30. sowie 42. und 43.
- Kapitel 31.
- Kapitel 32.
- Kapitel 33.
- Kapitel 34. und 35.
- Kapitel 36.
- Kapitel 37. und 38.
- Kapitel 39.
- Kapitel 40.
- Kapitel 41.
- Kapitel 44. und 45.
- Kapitel 46.
- Kapitel 47.
- Kapitel 48.
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit „Platon: Politikos. Eine Analyse“ zielt darauf ab, Platons Dialog „Politikos“ zu analysieren und die zentralen Aussagen des Werkes zu beleuchten. Die Arbeit konzentriert sich dabei auf die Kapitelstruktur des Werkes und untersucht die spezifischen Eigenheiten der einzelnen Abschnitte.
- Die philosophische Bedeutung des „Politikos“ im Kontext der platonischen Schriften.
- Die dialektische Methode und ihre Anwendung im „Politikos“
- Platons Konzept des Staatsmannes und der besten Staatsform
- Die Beziehung zwischen Wissen, Macht und Herrschaft im „Politikos“
- Die Rolle des Dialogs in der platonischen Philosophie und seine Bedeutung für das Verständnis des „Politikos“
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in den Dialog „Politikos“ und Platons Leben und Werk. Anschließend werden die einzelnen Kapitel des Dialogs in einer systematischen Reihenfolge analysiert.
Kapitel 1 stellt die beteiligten Personen im Dialog vor, darunter Sokrates, Theodorus und ein namenloser Fremder. Kapitel 2 befasst sich mit der Unterscheidung zwischen handelnder und einsehender Erkenntnis und argumentiert, dass die wahre Königskunst Teil der einsehenden Erkenntnis ist. In Kapitel 3 wird die einsehende Erkenntnis weiter in beurteilende und gebietende Erkenntnis unterteilt. Kapitel 4 erklärt den Unterschied zwischen der Herrschaft des „Stamms der Herolde“ und der selbstgebietenden Erkenntnis, die für die wahre Herrscherkunst steht.
Die Arbeit setzt die Analyse der weiteren Kapitel des „Politikos“ fort, indem sie die zentralen Argumente und Gedankengänge des Dialogs beleuchtet.
Schlüsselwörter
Schlüsselwörter für die Arbeit sind: Platon, „Politikos“, dialektische Methode, Staatsmann, Herrscherkunst, einsehende Erkenntnis, beurteilende Erkenntnis, gebietende Erkenntnis, Staatsform, Dialog, Philosophie.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema von Platons Dialog "Politikos"?
Platon sucht im "Politikos" nach einer präzisen Bestimmung des wahren Staatsmannes und der besten Staatsform.
Was versteht man unter der dihäretischen Methode?
Es ist eine Methode der Begriffsarbeit, bei der ein Begriff systematisch in Unterbegriffe geteilt wird, um zum Wesen einer Sache vorzudringen.
Warum wählte Platon die Dialogform für seine Werke?
Die Dialogform animiert den Leser zum Mitdenken und fordert ihn auf, selbst philosophische Diskussionen zu führen, statt nur passiv zu lehren.
Welche Rolle spielt die "einsehende Erkenntnis" im Politikos?
Platon argumentiert, dass die wahre Königskunst zur einsehenden Erkenntnis gehört, die weiter in beurteilende und gebietende Erkenntnis unterteilt wird.
In welche Tetralogie wird der "Politikos" eingeordnet?
Das Werk gehört zur zweiten Tetralogie und wird Platons Spätwerk zugeordnet.
- Citation du texte
- Georg Halbgebauer (Auteur), 2012, Eine Textanalyse von Platons Dialog "Politikos", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/314065