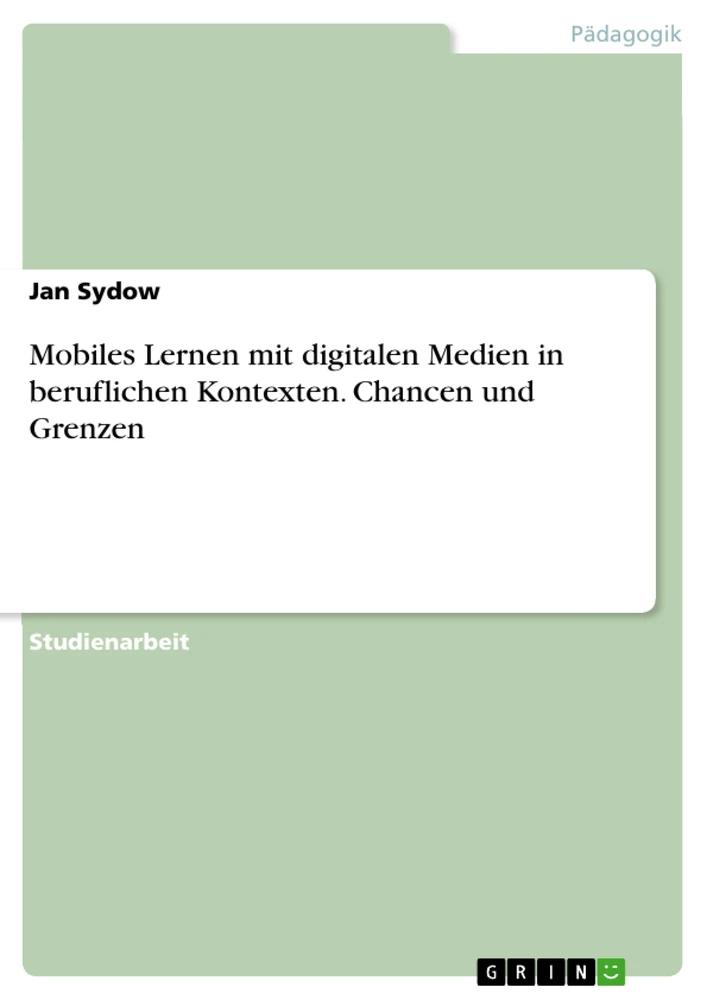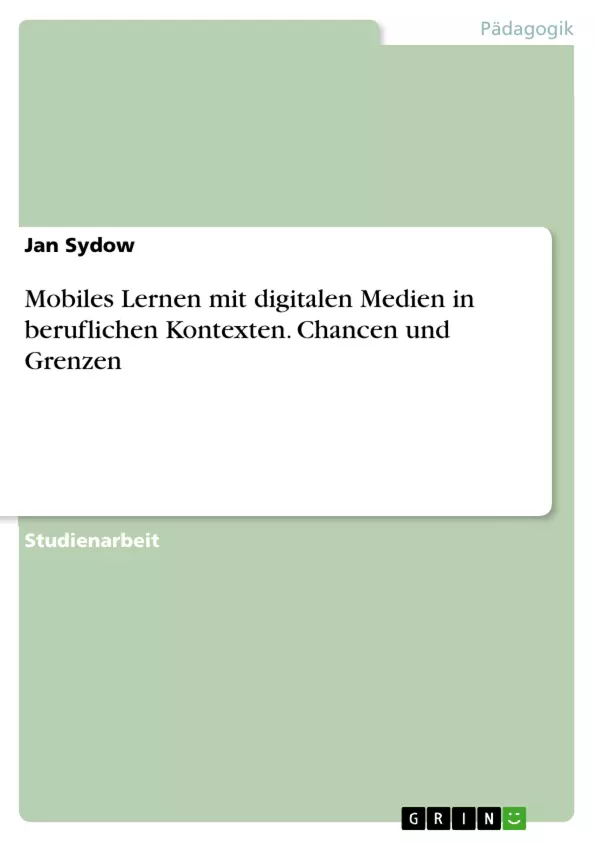Der technologische Fortschritt im Kommunikations- und IT-Bereich hat den Umgang des Menschen mit Wissen und Lernen nachhaltig verändert. Wissen stellt heute ein Gut dar, dass durch eine immer kürzere Gültigkeit gekennzeichnet ist und den Lernenden vor die wachsende Herausforderung stellt, sich in immer kürzeren Abständen und unter ständig wandelnden Bedingungen Wissen so effektiv wie möglich anzueignen.
Neben den klassischen Bereichen der Schule und der institutionalisierten Aus- und Weiterbildung ist in den letzten Jahrzehnten der Bereich der beruflichen Bildung immer stärker in den Fokus gerückt. Die Anforderung einer fortlaufenden und effektiven Qualifizierung der eigenen Mitarbeiter stellt für Unternehmen zunehmend einen relevanten Faktor in Fragen der Wirtschaftlich- und Wettbewerbsfähigkeit dar. In den letzten Jahren haben sich neben der Etablierung von E-Learning und Blended Learning – ausgehend von einem rasanten Fortschreiten in der Mobiltechnologie – eine Vielzahl neuer didaktischer Konzeptionen und Einsatzszenarien innerhalb der beruflichen Bildung entwickelt. In diesem Zusammenhang ist es vor allem das Mobile Lernen mit digitalen Medien, das dem steigenden Bedarf nach Wissens- und Lerneinheiten am Arbeitsplatz und im Prozess der Arbeit zu entsprechen scheint. Es ermöglicht dem Lernenden innerhalb beruflicher Kontexte schnell und unkompliziert, bedarfsgerecht und ortsunabhängig auf Lerninhalte und Informationen zuzugreifen und sich diese anzueignen.
Mit der wachsenden Relevanz des Mobilen Lernens wurde in der Vergangenheit allerdings zunehmend deutlich, dass zum einen der Bereich des formellen Lernens im Fokus steht und zum anderen Lehr- und Lernprozesse zu stark an den Bedingungen und Potentialen digitaler Medien ausgerichtet sind. Dabei erfährt gerade der Bereich des informellen Lernens in der beruflichen Bildung eine wachsende Bedeutung, ohne dass diese Entwicklung in der Vergangenheit lerntheoretisch bzw. didaktisch-konzeptionell in einem angemessenen Maße berücksichtigt würde. Die Forschungsfrage, die die vorliegende Arbeit im Folgenden zu beantworten suchen wird, lautet daher, ob in beruflichen Kontexten Lernprozesse durch das Mobile Lernen mit digitalen Medien gefördert werden können.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretische und begriffliche Überlegungen
- 2.1. Mobiles Lernen
- 2.2. Digitale Medien
- 2.3. Lernen in beruflichen Kontexten
- 3. Theoretische Überlegungen
- 3.1. Konstruktivistische Lerntheorien
- 3.2. Der Ansatz des situierten Lernens
- 3.3. Instruktionsdesigns des Situierten Lernens
- 3.4. Mikrolernen
- 4. Mobiles Lernen im Beruf
- 4.1. Potentiale des Mobilen Lernens mit digitalen Medien
- 4.2. Grenzen des Mobilen Lernens in beruflichen Kontexten
- 4.3. Dimensionen eines erfolgreichen Einsatzes Mobilen Lernens in beruflichen Kontexten
- 5. Schlussbetrachtung
- 5.1. Zusammenfassung
- 5.2. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht das Mobile Lernen mit digitalen Medien im Kontext beruflicher Bildung und analysiert die Chancen und Grenzen dieses Ansatzes. Die Arbeit zielt darauf ab, die theoretischen Grundlagen des Mobilen Lernens zu beleuchten und die Relevanz des Ansatzes für die Praxis zu beleuchten. Die Arbeit befasst sich mit den Potenzialen des Mobilen Lernens, aber auch mit den Herausforderungen, die sich aus der Nutzung digitaler Medien im Berufsleben ergeben.
- Der Einfluss des technologischen Fortschritts auf Lernprozesse
- Die Bedeutung des informellen Lernens in der beruflichen Bildung
- Theoretische Grundlagen des Mobilen Lernens und des Situierten Lernens
- Potentiale und Grenzen des Mobilen Lernens mit digitalen Medien in beruflichen Kontexten
- Bedingungen für einen erfolgreichen Einsatz des Mobilen Lernens in der Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Mobilen Lernens in der beruflichen Bildung ein und stellt die Relevanz des Themas dar. Sie beleuchtet die Herausforderungen des stetigen Wissenswandels und die Bedeutung von effektiven Lernprozessen in der Arbeitswelt.
Das zweite Kapitel widmet sich der begrifflichen und theoretischen Abgrenzung relevanter Begriffe, wie Mobiles Lernen, Digitale Medien und Lernen in beruflichen Kontexten. Hier werden verschiedene Definitionen und Perspektiven auf diese Begriffe beleuchtet und die spezifischen Herausforderungen bei der Abgrenzung dieser Konzepte herausgearbeitet.
Das dritte Kapitel präsentiert verschiedene theoretische Ansätze, die für das Verständnis des Mobilen Lernens relevant sind. Dazu gehören konstruktivistische Lerntheorien, der Ansatz des situierten Lernens, Instruktionsdesigns des Situierten Lernens und das Konzept des Mikrolernens. Die Kapitel beleuchtet die Relevanz dieser Theorien für den Einsatz digitaler Medien in der beruflichen Bildung.
Das vierte Kapitel befasst sich mit den Chancen und Grenzen des Mobilen Lernens in beruflichen Kontexten. Es werden die Potentiale des Mobilen Lernens für die berufliche Bildung, aber auch die damit verbundenen Herausforderungen und Limitationen dargelegt. Die Kapitel beleuchtet verschiedene Aspekte, wie z. B. die Förderung der Flexibilität, die Unterstützung der bedarfsgerechten Wissensaneignung und die Integration von Lernprozessen in den Arbeitsalltag.
Schlüsselwörter
Mobiles Lernen, Digitale Medien, Berufliche Bildung, Situiertes Lernen, Konstruktivistische Lerntheorien, Mikrolernen, Potentiale, Grenzen, Kontextualisierung, Personalisierung, Reflexion, E-Learning, Blended Learning.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Vorteile von mobilem Lernen im Beruf?
Mobiles Lernen ermöglicht den ortsunabhängigen und bedarfsgerechten Zugriff auf Wissen direkt am Arbeitsplatz und integriert Lernprozesse in den laufenden Arbeitsprozess.
Was ist der Unterschied zwischen formellem und informellem Lernen?
Formelles Lernen findet in institutionalisierten Rahmen statt (z.B. Kurse), während informelles Lernen oft unbewusst und spontan während der Arbeit geschieht – ein Bereich, der durch mobile Medien gestärkt wird.
Was versteht man unter „Situiertem Lernen“?
Es ist ein lerntheoretischer Ansatz, der davon ausgeht, dass Lernen am effektivsten ist, wenn es in einem authentischen Kontext und einer realen Anwendungssituation stattfindet.
Was ist „Mikrolernen“?
Mikrolernen bezeichnet das Lernen in sehr kurzen Einheiten (Häppchen), was sich ideal für die Nutzung auf mobilen Endgeräten während kurzer Arbeitspausen eignet.
Wo liegen die Grenzen des mobilen Lernens?
Grenzen können technische Hürden, Ablenkungspotenziale, mangelnde didaktische Konzepte oder die Überforderung durch die ständige Verfügbarkeit von Informationen sein.
- Quote paper
- Jan Sydow (Author), 2015, Mobiles Lernen mit digitalen Medien in beruflichen Kontexten. Chancen und Grenzen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/314243