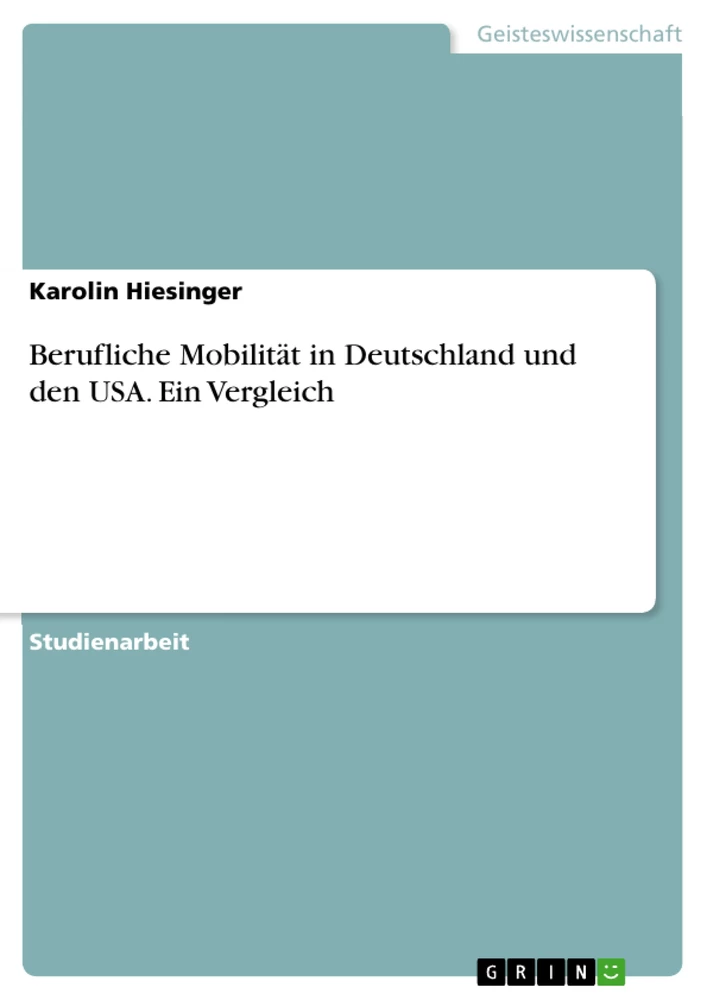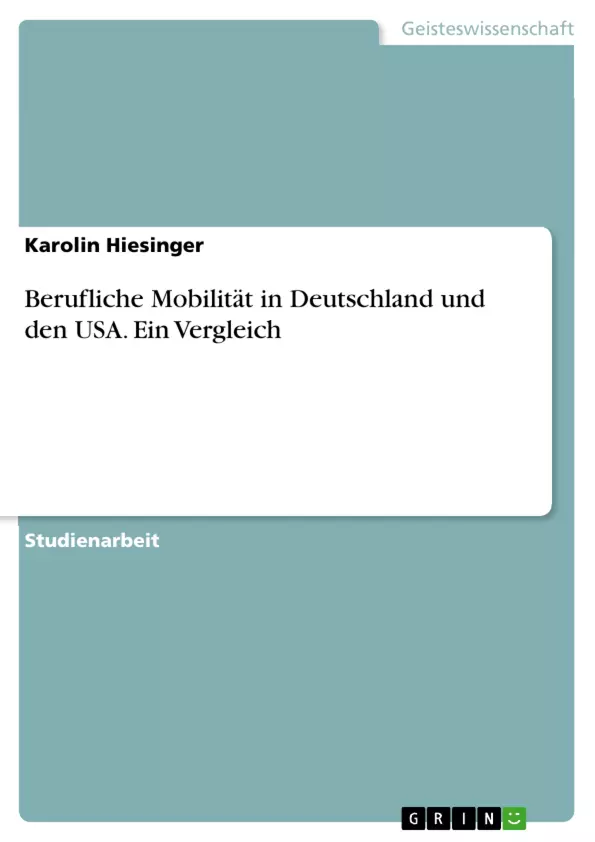Diese Arbeit stellt die Frage nach der Destabilisierung und Destandardisierung von Erwerbsverläufen in Deutschland und will die institutionellen Einflüsse auf die berufliche Mobilität in Deutschland und Amerika vergleichend analysieren und dabei vor allem den Fokus auf die (Aus-)Bildungssysteme setzen. Insbesondere soll die Frage diskutiert werden, ob dieses institutionelle System in Deutschland an Bindungskraft verliert und sich der einst sehr starre und von Beruflichkeit geprägte deutsche Arbeitsmarkt im Zuge globaler Veränderungen und Flexibilitätsanforderungen dem von jeher als flexibel geltenden amerikanischen Arbeitsmarkt angleicht.
In Deutschland spielt der erlernte Beruf durch die historisch bedingte enge institutionelle Verknüpfung des Berufsbildungssystems mit der auf dem Arbeitsmarkt ausgeübten Beschäftigung immer noch eine wichtige Rolle. Berufswechsel werden daher oftmals negativ assoziiert, weil sie häufig nicht freiwillig stattfinden, denn die Kosten des Wechsels scheinen durch Umschulung und Verlust des erlernten Wissens den Nutzen zu übersteigen.
Stattdessen ergibt sich berufliche Mobilität vielmehr aus der Arbeitslosigkeit heraus, wird also erzwungen. Daher scheinen Phasen der atypischen Beschäftigung und der Arbeitslosigkeit die berufliche Mobilität positiv zu beeinflussen. Andersherum kann von einer hohen beruflichen Mobilität auf diese oft negativ assoziierten Phasen im Lebenslauf, also einer Abweichung von der idealtypischen Normalbiographie, zurückgeschlossen werden, weil Individuen scheinbar nicht freiwillig aus ihrem erlernten Beruf aussteigen würden.
Eine weitaus weniger negative Perspektive auf die berufliche Mobilität existiert auf dem Arbeitsmarkt in den Vereinigten Staaten von Amerika. Dort ist die institutionelle Kopplung zwischen beruflicher Bildung und Beschäftigung wesentlich loser und damit nicht darauf ausgelegt, Individuen auf eine lebenslange Beschäftigung im selben Beruf auszubilden. Weil kein ausschließlich berufsspezifisches Wissen erworben wurde, sind die Kosten beruflicher Wechsel geringer und diese Wechsel daher wahrscheinlicher.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung mit Forschungsfrage
- 2. Berufliche Mobilität: Theoretische Ansätze
- 2.1 Matching auf dem Arbeitsmarkt.
- 2.2 Beruf als Institution
- 3. Arbeitsmärkte in Deutschland und US-Amerika
- 3.1 Institutionelle Bedingungen in Deutschland und den USA: nationale (Aus-)Bildungssysteme
- 3.2 Berufliche Mobilität: Methodische Besonderheiten und Herausforderungen
- 3.3 Der Einfluss der Institutionen auf die berufliche Mobilität
- 3.4 Jüngste Entwicklungen der beruflichen Mobilität in Deutschland: Annäherung an das amerikanische System durch Destandardisierung?
- 4. Fazit und Ausblick: Zukünftige Entwicklungen der beruflichen Mobilität.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die berufliche Mobilität im deutsch-amerikanischen Vergleich, indem sie die institutionellen Unterschiede zwischen den beiden Ländern in den Fokus nimmt. Ziel ist es, die Auswirkungen dieser Unterschiede auf die berufliche Mobilität von Individuen zu analysieren.
- Institutionelle Rahmenbedingungen der beruflichen Mobilität in Deutschland und den USA
- Theoretische Ansätze zur Erklärung beruflicher Mobilität
- Methodische Herausforderungen bei der Analyse beruflicher Mobilität
- Der Einfluss von Bildungssystemen auf die berufliche Mobilität
- Zukünftige Entwicklungen der beruflichen Mobilität im deutsch-amerikanischen Kontext
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung mit Forschungsfrage
Dieses Kapitel führt in das Thema berufliche Mobilität im deutsch-amerikanischen Vergleich ein und stellt die Forschungsfrage der Arbeit vor. Es beleuchtet die aktuelle Debatte über die Zunahme atypischer Beschäftigungsformen und die Erosion des Normalarbeitsverhältnisses. - Kapitel 2: Berufliche Mobilität: Theoretische Ansätze
In diesem Kapitel werden verschiedene theoretische Ansätze zur Erklärung beruflicher Mobilität vorgestellt, darunter das Matching-Modell und die Theorie des Berufs als Institution. - Kapitel 3: Arbeitsmärkte in Deutschland und US-Amerika
Dieses Kapitel vergleicht die Arbeitsmärkte in Deutschland und den USA, wobei der Fokus auf den institutionellen Rahmenbedingungen, insbesondere den nationalen Bildungssystemen, liegt. Es beleuchtet die methodischen Besonderheiten und Herausforderungen bei der Analyse beruflicher Mobilität und diskutiert den Einfluss der Institutionen auf die berufliche Mobilität. - Kapitel 4: Fazit und Ausblick: Zukünftige Entwicklungen der beruflichen Mobilität.
Dieses Kapitel fasst die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammen und gibt einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen der beruflichen Mobilität im deutsch-amerikanischen Kontext.
Schlüsselwörter
Berufliche Mobilität, Arbeitsmarkt, Deutschland, USA, Bildungssystem, Institution, Matching, Normalarbeitsverhältnis, Atypische Beschäftigung, Destandardisierung.
Häufig gestellte Fragen
Wie unterscheidet sich die berufliche Mobilität in Deutschland und den USA?
In Deutschland ist sie durch starre Beruflichkeit und enge Kopplung an Abschlüsse geprägt, während der US-Arbeitsmarkt wesentlich flexibler und weniger abschlussgebunden ist.
Warum sind Berufswechsel in Deutschland oft negativ besetzt?
Sie finden oft unfreiwillig aus Arbeitslosigkeit heraus statt und sind aufgrund des hohen Spezialisierungswerts des erlernten Berufs mit hohen Wechselkosten verbunden.
Welchen Einfluss hat das Bildungssystem auf die Mobilität?
Das deutsche duale System bildet sehr spezifisch aus, was die Bindung an einen Beruf stärkt; das US-System vermittelt breiteres Wissen, was Wechsel erleichtert.
Was bedeutet „Destandardisierung“ von Erwerbsverläufen?
Es beschreibt die Abkehr von der klassischen Normalbiografie hin zu atypischen Beschäftigungen, häufigeren Jobwechseln und Phasen der Umorientierung.
Gleicht sich der deutsche Arbeitsmarkt dem amerikanischen an?
Die Arbeit diskutiert, ob Deutschland durch globale Flexibilitätsanforderungen seine starre Beruflichkeit verliert und sich dem US-Modell annähert.
- Citation du texte
- Karolin Hiesinger (Auteur), 2014, Berufliche Mobilität in Deutschland und den USA. Ein Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/316886