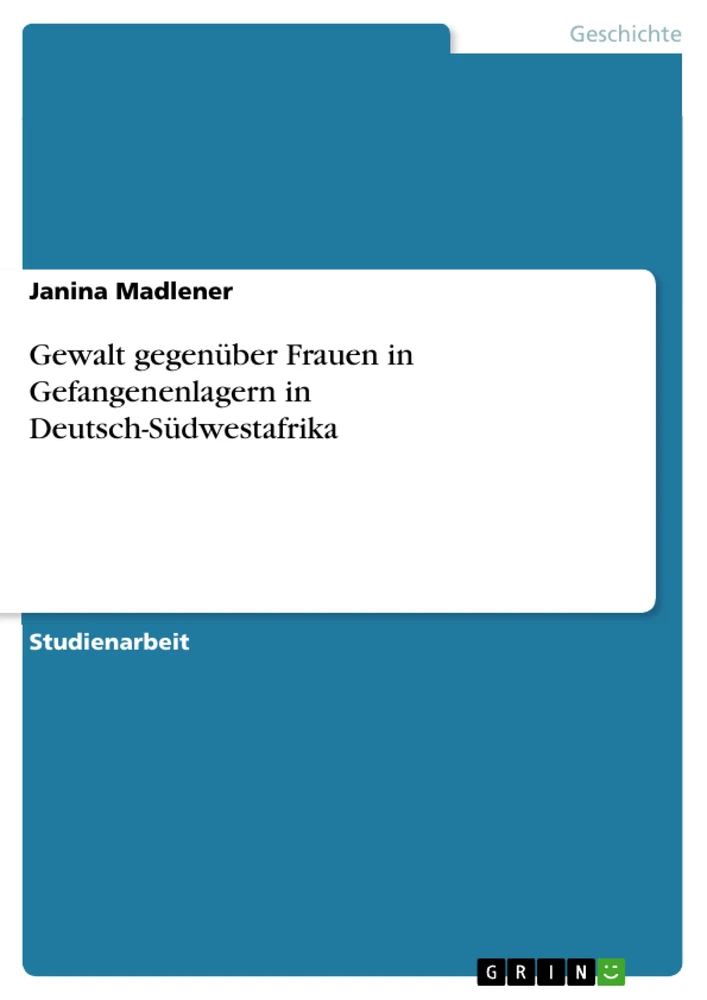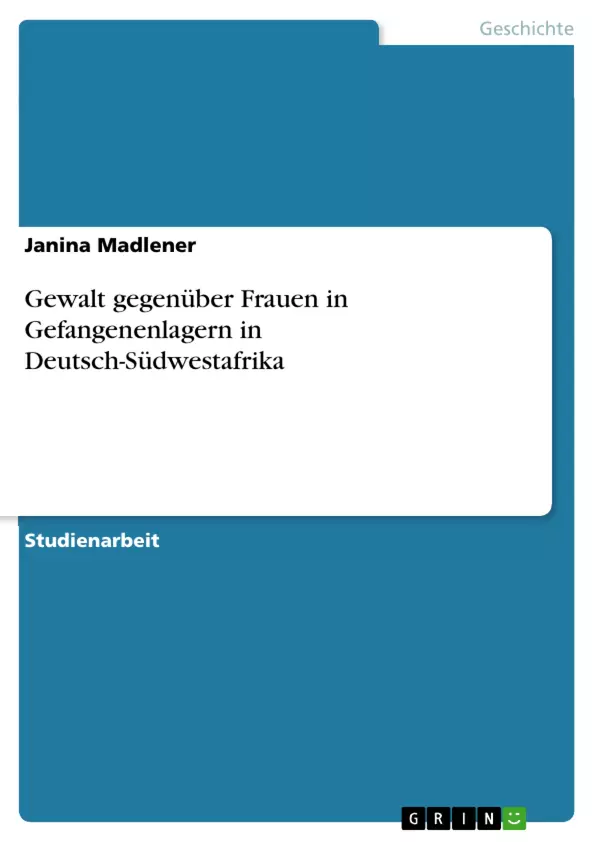Ausgehend von den in Swakopmund, Okahandja, Windhuk und auf der Haifischinsel in der Lüderitzbucht errichteten Gefangenenlagern soll, exemplarisch untersucht an Augenzeugenberichten, in der vorliegenden Arbeit der Frage nachgegangen werden, welchen spezifischen Formen der Gewalt Frauen innerhalb der Gefangenlagern in Deutsch-Südwestafrika zur Kolonialzeit zu Opfer fielen. Der hierbei zu untersuchende Zeitraum ist Januar 1905 bis zur Entlassung der letzten Kriegsgefangenen im Januar 1908.
Im Fokus liegt die Deutsche Kolonialmacht in Deutsch Südwest-Afrika. Auch andere europäische Kolonialmächte gingen im Zuge der Kolonisierung Afrikas gewaltsam gegen die indigene Bevölkerung vor. Auch hatten bereits Spanien und Großbritannien von der Errichtung von „Konzentrationslagern“ Gebrauch gemacht. Diese sind allerdings nicht Teil des Folgenden.
Verschiedene junge Beiträge von Gesine Krüger und Jürgen Zimmerer befassen sich mit der Thematik. Die Definition von Heinrich Popitz zu Gewalt legt Grundlagen, ebenso wie die Beiträge von Jan Philipp Reemtsma zu „extremer Gewalt“. Die exemplarischen Augenzeugenberichte des Blue Books werden mithilfe verschiedener Beiträge des von Joachim Zeller und Jürgen Zimmerer herausgegebenen Sammelbandes sowie Gesine Krügers Arbeit zum Kriegsbewusstsein und zur Geschichtsbewältigung untersucht.
Inhaltsverzeichnis
- I. EINLEITUNG
- II. HAUPTTEIL
- 1. Was ist Gewalt?
- 1.1. Definition Heinrich Popitz
- 1.2. Definition „Extreme Gewalt“
- 2. Warum wird Gewalt an Frauen untersucht?
- 3. Formen der Gewalt
- 3.1. Unzureichende Ernährung und Versorgung
- 3.2. Zwangsarbeiten innerhalb und außerhalb der Konzentrationslager
- 3.3. Körperliche Gewalt und Ermordung
- 3.4. Sexuelle Gewalt
- 4. Die Genoziddebatte und der Begriff des Konzentrationslagers
- 1. Was ist Gewalt?
- III. SCHLUSS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die spezifischen Formen von Gewalt, denen Frauen in Gefangenenlagern in Deutsch-Südwestafrika zwischen Januar 1905 und Januar 1908 ausgesetzt waren. Sie konzentriert sich auf die Lager in Swakopmund, Okahandja, Windhuk und auf der Haifischinsel in der Lüderitzbucht und analysiert Augenzeugenberichte, um die Auswirkungen von Gewalt auf Frauen in diesen Lagern aufzuzeigen.
- Die Definition von Gewalt im Kontext des deutschen Kolonialismus.
- Die spezifischen Formen der Gewalt gegen Frauen in Gefangenenlagern, einschließlich Ernährungsmangel, Zwangsarbeit, körperlicher Gewalt und sexueller Gewalt.
- Die Rolle der Gefangenenlager im größeren Kontext des Herero- und Namakriegs und der Genoziddebatte.
- Der Begriff des Konzentrationslagers und seine Anwendung auf die deutschen Gefangenenlager in Südwest-Afrika.
- Die Bedeutung der Augenzeugenberichte für die Analyse der Gewalt gegen Frauen in den Lagern.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit dar und erläutert die Bedeutung des Themas. Sie geht auf die Geschichte der deutschen Kolonialisierung in Südwest-Afrika ein und betont die Rolle der Gewalt im Krieg gegen die Herero und Nama. Die Einleitung führt auch die wichtigsten Quellen für die Arbeit ein, darunter Augenzeugenberichte und Sekundärliteratur.
Der Hauptteil der Arbeit beginnt mit einer Definition von Gewalt, die auf die Arbeiten von Heinrich Popitz und Jan Philipp Reemtsma Bezug nimmt. Anschließend werden verschiedene Formen der Gewalt, denen Frauen in den Lagern ausgesetzt waren, untersucht, einschließlich Ernährungsmangel, Zwangsarbeit, körperlicher Gewalt und sexueller Gewalt. Die Kapitel des Hauptteils analysieren diese Formen von Gewalt im Detail anhand von konkreten Beispielen aus Augenzeugenberichten.
Schlüsselwörter
Deutsche Kolonialgeschichte, Deutsch-Südwestafrika, Gewalt gegen Frauen, Gefangenenlager, Genozid, Herero, Nama, Augenzeugenberichte, Heinrich Popitz, Jan Philipp Reemtsma, Extreme Gewalt, Konzentrationslager.
Häufig gestellte Fragen
Welche Formen der Gewalt erlebten Frauen in Deutsch-Südwestafrika?
Frauen waren unzureichender Ernährung, Zwangsarbeit, körperlichen Misshandlungen, Ermordungen und systematischer sexueller Gewalt ausgesetzt.
Was war die Haifischinsel?
Ein berüchtigtes Gefangenenlager in der Lüderitzbucht, das für seine extrem hohen Sterberaten und grausamen Bedingungen bekannt war.
Wie wird „extreme Gewalt“ in diesem Kontext definiert?
Die Arbeit bezieht sich auf Jan Philipp Reemtsma und Heinrich Popitz, um Gewalt zu beschreiben, die über die reine physische Einwirkung hinausgeht und auf die Vernichtung der Person abzielt.
Welche Rolle spielten Augenzeugenberichte?
Berichte aus dem sogenannten „Blue Book“ dienen als zentrale Quelle, um die spezifischen Leiden der indigenen Frauen (Herero und Nama) zu dokumentieren.
Wird die Situation als Genozid eingestuft?
Ja, die Arbeit ordnet die Ereignisse in die aktuelle Genoziddebatte ein und nutzt den Begriff des Konzentrationslagers zur Beschreibung der deutschen Lagerstrukturen.
- Citation du texte
- Janina Madlener (Auteur), 2013, Gewalt gegenüber Frauen in Gefangenenlagern in Deutsch-Südwestafrika, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/317219