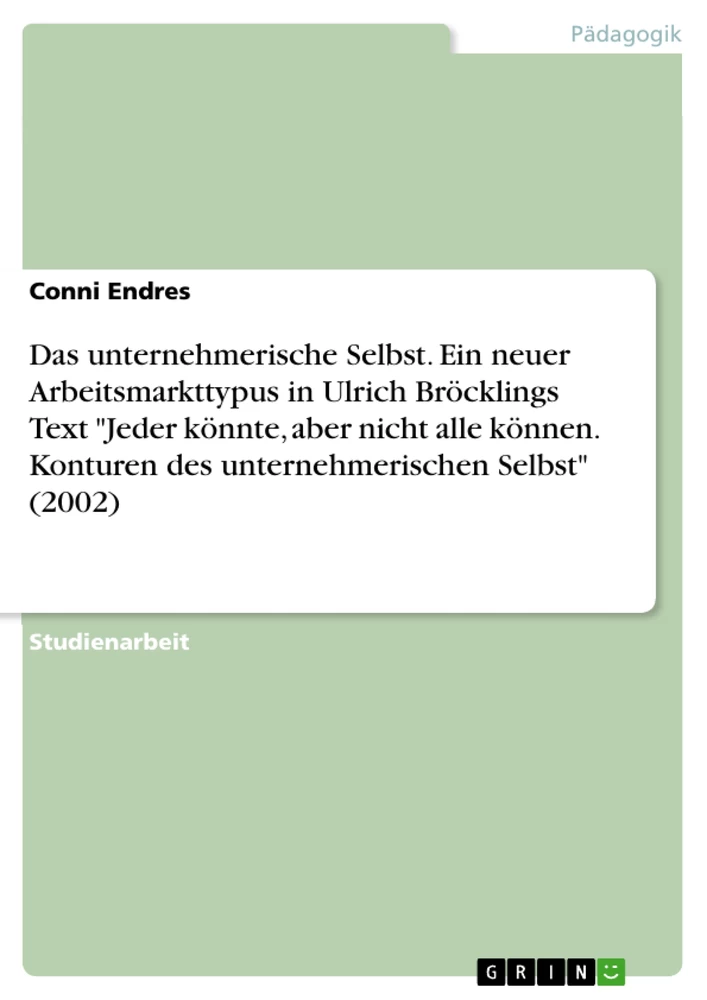In seinem Text schreibt Bröckling nicht über das persönliche Selbst, sondern über das unternehmerische Selbst, über einen neuen Arbeitsmarkttypus. Diese Theorie geht über die Arbeitswelt hinaus und schließt auch den Bildungsprozess mit ein.
Bröklings Text ist eine kritische Zeitgeistanlayse, wie in den folgenden Textabschnitt ersichtlich wird: „Er findet sich in veränderten Formen der Betriebsorganisation (Stichwort: Intrapreneurship) ebenso wie in ‚neuen Steuerungsmodellen‘ der öffentlichen Verwaltung (Stichwort: Bürger als Kunde), in zeitgenössischen politischen Leitbildern (Stichwort: aktivierender Staat) wie in den Curricula von Schulen und Universitäten (Stichwort: Knowledge-Unternehmer), in Fördermaßnahmen für Arbeitslose (Stichwort: lebenslanges Lernen), ‚humanistischen‘ Psychotechniken (Stichwort: personal growth) oder den allgegenwärtigen Evaluationen (Stichwort: Qualitätsverbesserung)“ (Bröckling 2002, S. 1). All diese Stichwörter, die er aufzählt, versteht er als Phänomene unseres Zeitalters, die kritisch zu hinterfragen sind. In seiner Arbeit geht er auf die Auswirkungen dieser Strömungen näher ein. Das eigentliche Ansinnen seines Textes ist, dem Leser vor Augen zu führen, dass wir in einer Ideologie leben. Aus diesem Grund müsse die Überlegung stattfinden, wie eine Ideologie definiert werden kann, was diese kennzeichnet, welche Funktion sie hat und welche Gefahren sie mit sich bringt.
Inhaltsverzeichnis
- Viva la muerte
- Das unternehmerische Selbst
- Die 'Durchsetzung neuer Kombinationen'
- Theorie und Praxis
- Antiintellektuelles Ressentiment
- Soziale Integration durch den Markt
- Dynamik der Ausgrenzung: Survival oft he fittest
- Leben wir in einem ideologischen Land?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text von Ulrich Bröckling analysiert kritisch die Ideologie des „unternehmerischen Selbst“ und seine Auswirkungen auf verschiedene Bereiche der Gesellschaft, von der Arbeitswelt bis hin zum Bildungssystem.
- Kritik an der Ideologie des „unternehmerischen Selbst“
- Analyse der Auswirkungen dieser Ideologie auf die Arbeitswelt, das Bildungssystem und die Gesellschaft
- Diskussion der Rolle des Marktes als Medium sozialer Integration
- Untersuchung der Dynamik der Ausgrenzung im Kontext des „survival of the fittest“
- Reflexion über die Gefahren einer ideologischen Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Viva la muerte
Bröckling kritisiert die Verbreitung von Begriffen wie „Intrapreneurship“, „Bürger als Kunde“ und „lebenslanges Lernen“, die seiner Ansicht nach Ausdruck eines neuen Zeitgeistes sind, der kritisch zu hinterfragen ist.
Das unternehmerische Selbst
Das Kapitel analysiert das Konzept des „unternehmerischen Selbst“ und seine Anforderungen an den Einzelnen. Bröckling kritisiert die hohen Ansprüche, die an den Unternehmer gestellt werden, und die Gefahr des Burn-outs.
Soziale Integration durch den Markt
Bröckling diskutiert die These, dass der Markt soziale Integration schafft. Er hinterfragt die Integration von Menschen, die am Markt nicht teilnehmen können oder wollen und kritisiert die Gefahr der Ausgrenzung.
Dynamik der Ausgrenzung: Survival oft he fittest
Das Kapitel untersucht die Dynamik der Ausgrenzung im Kontext des „survival of the fittest“. Bröckling zeigt auf, dass nicht alle Menschen die gleichen Chancen haben, am Markt erfolgreich zu sein, und kritisiert die Ungleichheit der Ausgangsbedingungen.
Schlüsselwörter
Unternehmerisches Selbst, Ideologie, Markt, soziale Integration, Ausgrenzung, „survival of the fittest“, Arbeitswelt, Bildungssystem, Zeitgeist, Kritik, Analyse, Theorie, Praxis.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das „unternehmerische Selbst“ nach Ulrich Bröckling?
Es handelt sich um einen neuen Arbeitsmarkttypus und ein Leitbild, bei dem Individuen dazu angehalten werden, sich selbst wie ein Unternehmen zu führen, sich ständig zu optimieren und eigenverantwortlich für ihren Erfolg am Markt zu sorgen.
In welchen gesellschaftlichen Bereichen zeigt sich dieses Konzept?
Bröckling sieht das unternehmerische Selbst in der Betriebsorganisation (Intrapreneurship), der öffentlichen Verwaltung (Bürger als Kunde), im Bildungssystem (Knowledge-Unternehmer) und in der Arbeitslosenförderung (lebenslanges Lernen).
Welche Kritik übt Bröckling an dieser Ideologie?
Er kritisiert, dass dieser permanente Optimierungszwang zu psychischer Belastung führen kann und eine Dynamik der Ausgrenzung („Survival of the fittest“) schafft, die jene benachteiligt, die die geforderten Leistungen nicht erbringen können.
Was bedeutet „Soziale Integration durch den Markt“?
Es beschreibt die Vorstellung, dass gesellschaftliche Teilhabe primär über die erfolgreiche Teilnahme am Marktgeschehen definiert wird, was jedoch zur Ausgrenzung marktferner Gruppen führt.
Warum bezeichnet Bröckling dies als Ideologie?
Weil das Konzept des unternehmerischen Selbst als alternativlose Wahrheit präsentiert wird, die das gesamte Denken und Handeln durchdringt und gesellschaftliche Machtstrukturen verschleiert.
- Citar trabajo
- Conni Endres (Autor), 2016, Das unternehmerische Selbst. Ein neuer Arbeitsmarkttypus in Ulrich Bröcklings Text "Jeder könnte, aber nicht alle können. Konturen des unternehmerischen Selbst" (2002), Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/317414