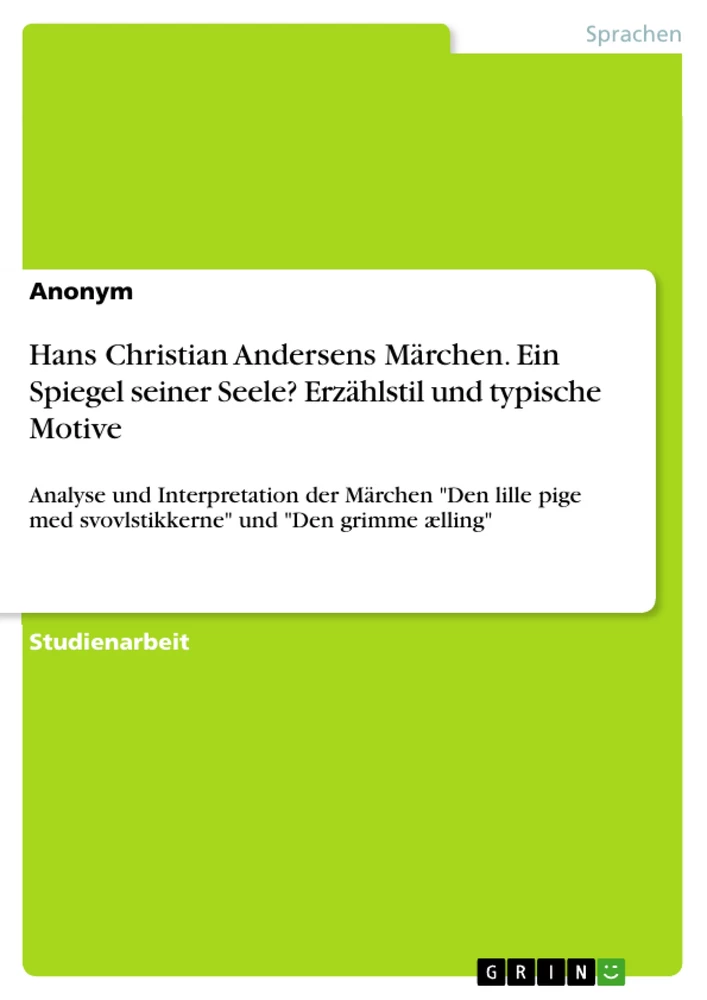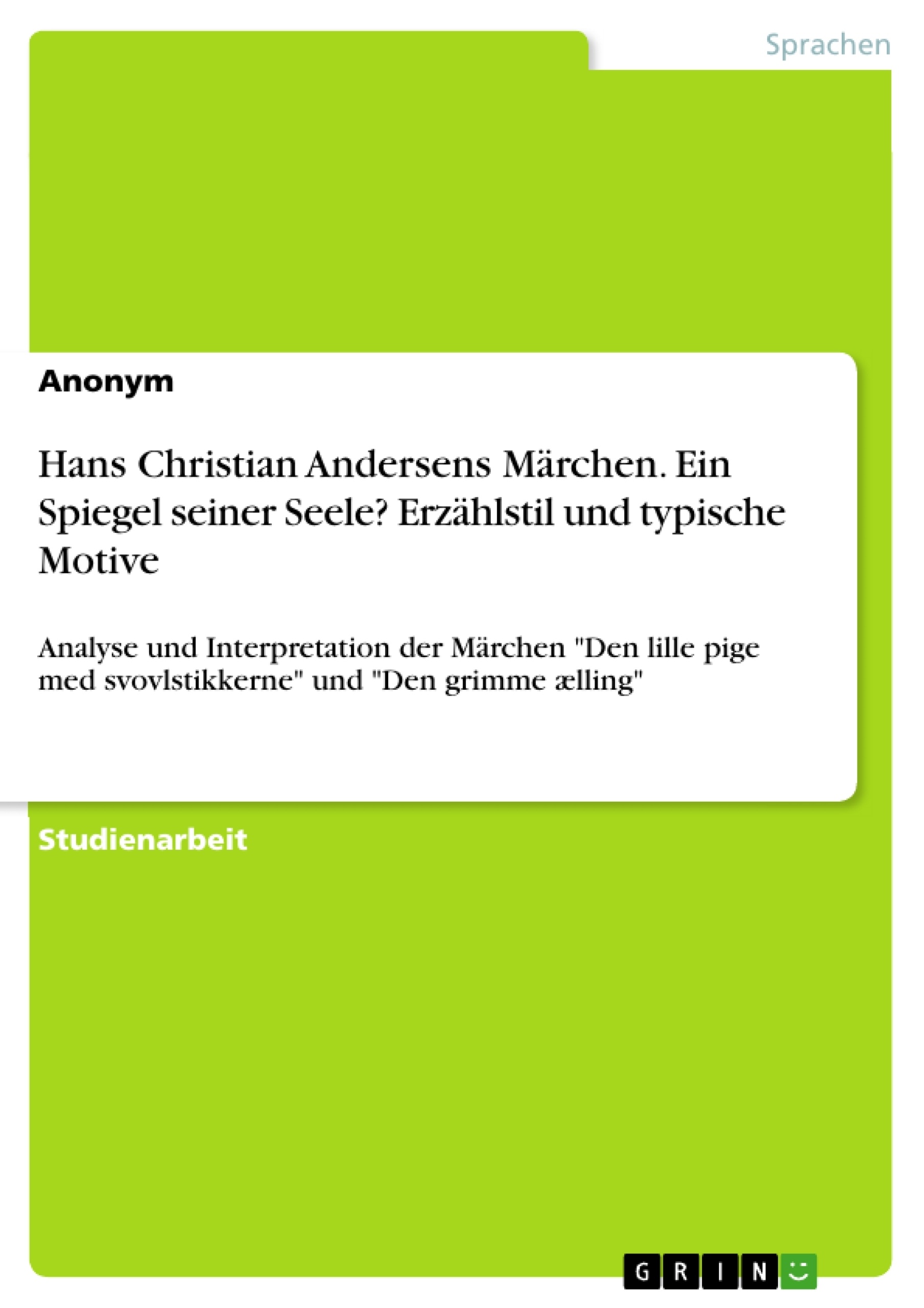Diese Arbeit befasst sich mit dem Leben Hans Christian Andersens und dessen Verbindung zu seinen Märchen. Die Analyse einzelner Märchen von H.C. Andersen soll verdeutlichen, wie sehr er seine eigenen Erlebnisse in seiner Dichtung verarbeitet.
Einleitend dazu werden das Volksmärchen und das Kunstmärchen kurz näher erläutert. Der erste Teil wird sich dann mit dem Dichter selbst befassen. Es wird zunächst eine Biographie gegeben und dann näher auf den Mensch H.C. Andersen eingegangen. Der zweite Teil befasst sich dann mit Andersens Märchendichtung. Hierbei wird vermehrt auf Andersens Erzählstil, typische Motive und die Stimmung der Märchen eingegangen. Der folgende Abschnitt beinhaltet die Analyse folgender Märchen von H.C. Andersen:
"Den lille pige med svovlstikkerne" und "Den grimme ælling".
Abschließend folgen eine Auswertung der Analysen sowie eine Zusammenfassung der gesamten Arbeit. Ziel dieser Arbeit ist es zu prüfen, ob Andersens Märchen als Spiegel seiner Seele gesehen werden können.
„Mit liv er et smukt eventyr, saa rigt og lyksaligt!“
So lautet der erste Satz von Hans Christian Andersens Selbstbiographie "Mit Livs Eventyr" und hebt die enge Verbundenheit Andersens zur Märchendichtung hevor.
Doch betrachtet man Andersens Leben genauer, lässt sich herausfinden, dass dieses weit davon entfernt war „reich und glücklich“ zu sein. Er war ein von Zweifeln geplagter Mensch mit Selbstmordgedanken, welcher beinahe auf selbstquälerische Art und Weise lebte.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Volksmärchen und Kunstmärchen
- 3. Hans Christian Andersen
- 3.1. Andersens Leben
- 3.2. Der Mensch H.C. Andersen
- 4. Andersens Märchen
- 4.1. Andersens Erzählstil
- 4.2. Typische Motive
- 5. Analyse und Interpretation der Märchen
- 5.1. Den lille pige med svovlstikkerne
- 5.2. Den grimme ælling
- 6. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die enge Verbindung zwischen dem Leben Hans Christian Andersens und seinen Märchen. Ziel ist es zu analysieren, inwiefern seine persönlichen Erfahrungen und Erlebnisse seine literarische Arbeit widerspiegeln und ob seine Märchen tatsächlich als „Spiegel seiner Seele“ betrachtet werden können. Die Arbeit beleuchtet dabei sowohl biographische Aspekte als auch stilistische und motivische Eigenheiten seiner Märchendichtung.
- Andersens Biographie und seine Entwicklung als Dichter
- Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Volksmärchen und Kunstmärchen
- Analyse von Andersens Erzählstil und typischen Motiven
- Interpretation ausgewählter Märchen im Kontext von Andersens Leben
- Die Frage nach dem autobiographischen Gehalt von Andersens Märchen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem autobiographischen Gehalt von Andersens Märchen. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und benennt die analysierten Märchen. Der einleitende Zitat aus Andersens Autobiografie kontrastiert dessen selbstgeschaffenes Bild eines glücklichen Lebens mit der Realität seiner oft schwierigen Lebensumstände. Die Einleitung dient als Brücke zwischen der Selbstdarstellung Andersens und der kritischen Auseinandersetzung mit seinem Werk.
2. Volksmärchen und Kunstmärchen: Dieses Kapitel differenziert zwischen Volksmärchen und Kunstmärchen. Es beschreibt die typischen Merkmale von Volksmärchen, wie die mündliche Überlieferung, die einfache Struktur und das stets positive Ende. Im Gegensatz dazu werden die Merkmale des Kunstmärchens herausgearbeitet, darunter die Freiheit des Dichters im Umgang mit den traditionellen Elementen, die oft vorhandenen sozialkritischen Inhalte und das Fehlen eines garantierten "guten Endes". Die Kapitel dient als notwendiger Rahmen, um Andersens Position als innovativer Kunstmärchenerzähler im Kontext der bestehenden Tradition zu verorten.
3. Hans Christian Andersen: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Leben und der Persönlichkeit Hans Christian Andersens. Es beleuchtet seine schwierige Kindheit, seinen Weg nach Kopenhagen und seine Entwicklung zum bekannten Dichter. Der Abschnitt über Andersens Leben schildert den Aufstieg aus ärmlichen Verhältnissen und die Herausforderungen, die er überwinden musste, um seinen Traum von literarischem Erfolg zu verwirklichen. Der Abschnitt über den Menschen Andersen beschreibt ihn als eine komplexe Persönlichkeit, die durch Minderwertigkeitskomplexe geprägt war.
4. Andersens Märchen: Dieses Kapitel analysiert Andersens Erzählstil und typische Motive in seinen Märchen. Es untersucht, wie er Elemente aus Volksmärchen verwendet und gleichzeitig neue Wege beschreitet. Der Fokus liegt auf den wiederkehrenden Motiven, der Sprache und der Stimmung seiner Geschichten, die oftmals zwiespältig und ambivalent sind. Das Kapitel dient als Grundlage für die detailliertere Analyse ausgewählter Märchen in Kapitel 5.
Schlüsselwörter
Hans Christian Andersen, Märchen, Volksmärchen, Kunstmärchen, Autobiographie, Erzählstil, Motive, Sozialkritik, Biographie, Minderwertigkeitskomplexe, Den lille pige med svovlstikkerne, Den grimme ælling.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse der Märchen von Hans Christian Andersen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die enge Verbindung zwischen dem Leben Hans Christian Andersens und seinen Märchen. Das Hauptziel ist die Analyse, inwiefern Andersens persönliche Erfahrungen seine literarische Arbeit widerspiegeln und ob seine Märchen als „Spiegel seiner Seele“ betrachtet werden können. Die Arbeit beleuchtet biographische Aspekte, stilistische und motivische Eigenheiten seiner Märchendichtung.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Andersens Biographie und seine Entwicklung als Dichter; Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Volksmärchen und Kunstmärchen; Analyse von Andersens Erzählstil und typischen Motiven; Interpretation ausgewählter Märchen (Den lille pige med svovlstikkerne und Den grimme ælling) im Kontext von Andersens Leben; und die Frage nach dem autobiographischen Gehalt von Andersens Märchen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: 1. Einleitung; 2. Volksmärchen und Kunstmärchen; 3. Hans Christian Andersen (Leben und Persönlichkeit); 4. Andersens Märchen (Erzählstil und Motive); 5. Analyse und Interpretation ausgewählter Märchen; und 6. Zusammenfassung.
Wie wird der Erzählstil Andersens analysiert?
Kapitel 4 analysiert Andersens Erzählstil und typische Motive in seinen Märchen. Es untersucht die Verwendung von Elementen aus Volksmärchen und die von Andersen beschrittenen neuen Wege. Der Fokus liegt auf wiederkehrenden Motiven, Sprache und Stimmung seiner Geschichten, die oft zwiespältig und ambivalent sind. Dieses Kapitel bildet die Grundlage für die detailliertere Analyse ausgewählter Märchen in Kapitel 5.
Welche Märchen werden im Detail analysiert?
Kapitel 5 analysiert und interpretiert zwei ausgewählte Märchen im Detail: Den lille pige med svovlstikkerne (Das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern) und Den grimme ælling (Das hässliche Entlein).
Wie wird die Verbindung zwischen Andersens Leben und seinen Märchen hergestellt?
Die Arbeit untersucht, inwiefern Andersens schwierige Kindheit, sein Weg nach Kopenhagen und seine Entwicklung zum bekannten Dichter seine Märchen beeinflusst haben. Sie analysiert, ob und wie sich seine persönlichen Erfahrungen und Erlebnisse in seinen literarischen Werken widerspiegeln.
Was ist der Unterschied zwischen Volksmärchen und Kunstmärchen laut dieser Arbeit?
Kapitel 2 differenziert zwischen Volksmärchen (mündliche Überlieferung, einfache Struktur, positives Ende) und Kunstmärchen (Freiheit des Dichters, oft sozialkritische Inhalte, kein garantiertes "gutes Ende"). Dies dient der Einordnung Andersens als innovativer Kunstmärchenerzähler.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Hans Christian Andersen, Märchen, Volksmärchen, Kunstmärchen, Autobiographie, Erzählstil, Motive, Sozialkritik, Biographie, Minderwertigkeitskomplexe, Den lille pige med svovlstikkerne, Den grimme ælling.
Was ist die zentrale Forschungsfrage der Arbeit?
Die zentrale Forschungsfrage ist: Inwieweit spiegeln sich die autobiographischen Elemente im Leben Hans Christian Andersens in seinen Märchen wider? Oder anders formuliert: Kann man Andersens Märchen tatsächlich als „Spiegel seiner Seele“ betrachten?
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2015, Hans Christian Andersens Märchen. Ein Spiegel seiner Seele? Erzählstil und typische Motive, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/318748