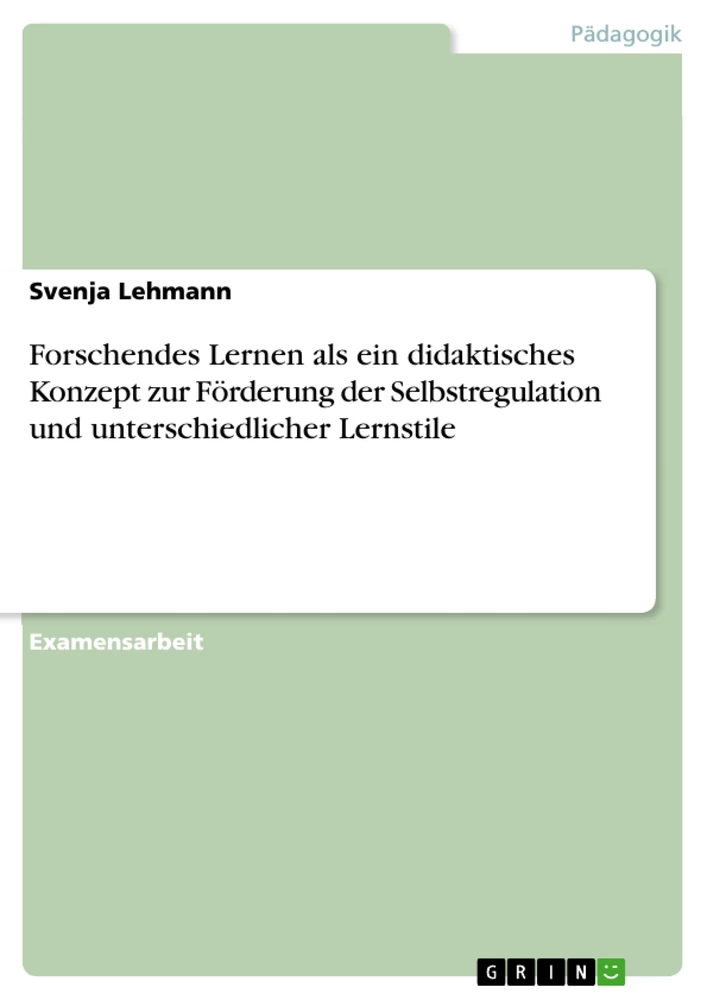Diese Arbeit untersucht, ob das forschende Lernen ein Instrument zur Förderung der Selbstregulation darstellt. Weiterhin soll herausgearbeitet werden, ob alle Schüler gleichermaßen von diesem Konzept profitieren. Dies setzt voraus, dass jeder Schüler mit seinem individuellen Lernstil die Möglichkeit hat, besser gefördert zu werden. Um diese Frage zu klären, ist es zunächst nötig, die theoretischen Grundlagen zu erläutern, um die Ergebnisse im später folgenden empirischen Teil nachvollziehen zu können.
Der Hauptteil dieser Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel. Zunächst wird sich mit dem Endeckenden Lernen auseinander gesetzt, welches als Oberkategorie des forschenden Lernens gesehen wird. Hierbei werden insbesondere die Überlegungen von Hameyer (2002) und Gudjons (2007) einbezogen. Weitergehend werden dann die unterschiedlichen Modelle zur Selbstregulation thematisiert. Besonders das Modell von Zimmerman (2000) findet große Beachtung und dient als Grundlage für die weitere Arbeit. Zum Abschluss des theoretischen Teils, beschäftigt sich das nächste Kapitel mit den Grundlagen einer Lernstilanalyse. Die Lernstilanalyse ist zum Bestimmen der jeweiligen Lerntypen bei den Schülern wichtig. Dabei soll die Theorie und der Entwurf von David Kolb (1981, 1984) als Vorbild dienen. Der Fokus des folgenden Kapitels liegt auf der Erfassung der Ausgangslage der Forschung. Hier wird der Leser über die grundlegenden Gegebenheiten informiert. An dieser Stelle geht es um die Präsentation der Schule, der Schüler sowie der Umsetzung des Konzepts des forschenden Lernens an der Schule B. in N. Darauf aufbauend werden im nächsten Kapitel beispielhaft acht Schüler der neunten Klassen analysiert. Dabei werden drei empirische Quellen miteinander in Verbindung gebracht, die Aussagen über die Fähigkeit zur Selbstregulation treffen und außerdem die einzelnen Lernstile der Schüler widerspiegeln. Schließlich sollen die gewonnenen Erkenntnisse zusammengefasst werden, um zu einem Ergebnis zu gelangen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Entdeckendes Lernen als ein didaktisches Konzept
- Ziele des entdeckenden Lernens
- Schwierigkeiten beim entdeckenden Lernen
- Phasen des entdeckenden Lernens
- Formen des entdeckenden Lernens
- Forschendes Lernen als Unterform des entdeckenden Lernens
- Selbstregulation
- Modelle zur Selbstregulation
- Selbstregulation nach Zimmerman (2000)
- Das Lernstilmodell von Kolb als Basis der Analyse
- Grundlage der Forschung: Die 9. Klassen der Schule B. in N.
- Forschungskonzept
- Einzelfallanalyse: Carolin
- Einzelfallanalyse: Christian
- Einzelfallanalyse: Jonas
- Einzelfallanalyse: Leonie
- Einzelfallanalyse: Lisa
- Einzelfallanalyse: Paul
- Einzelfallanalyse: Simon
- Einzelfallanalyse: Sophie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit analysiert das didaktische Konzept des forschenden Lernens hinsichtlich seiner Eignung zur Förderung der Selbstregulation und der Berücksichtigung unterschiedlicher Lernstile bei Schülern. Dabei wird untersucht, ob das forschende Lernen als Instrument zur Stärkung der Selbstständigkeit und des selbstgesteuerten Lernens fungiert und ob alle Schüler gleichermaßen von diesem Konzept profitieren können.- Das Konzept des entdeckenden Lernens und seine Relevanz für die Förderung kognitiver Fähigkeiten
- Die Bedeutung von Selbstregulation im Lernprozess und die wichtigsten Modelle zur Selbstregulation
- Das Lernstilmodell von Kolb als Grundlage für die Analyse individueller Lernpräferenzen
- Die praktische Umsetzung des forschenden Lernens in der Schule B. in N. und die erfahrungsbasierte Lernumgebung
- Die Analyse von Einzelfällen, um die Effekte des forschenden Lernens auf die Selbstregulation und Lernstile der Schüler zu beleuchten
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung führt in die Thematik des forschenden Lernens und die Notwendigkeit der Förderung selbstständigen Lernens in Schulen ein. Die PISA-Ergebnisse von 2000 werden als Ausgangspunkt für die Analyse des Konzepts des forschenden Lernens herangezogen. Die vorliegende Arbeit untersucht die Frage, ob das forschende Lernen ein Instrument zur Förderung der Selbstregulation darstellt und ob alle Schüler gleichermaßen davon profitieren können.
- Kapitel 2 erläutert das Konzept des entdeckenden Lernens als Oberkategorie des forschenden Lernens. Es werden die Ziele, Schwierigkeiten, Phasen und Formen des entdeckenden Lernens anhand verschiedener theoretischer Ansätze beleuchtet. Das forschende Lernen wird als eine Unterform des entdeckenden Lernens mit spezifischen Eigenschaften vorgestellt.
- Kapitel 3 beschäftigt sich mit dem Konzept der Selbstregulation und erläutert die Bedeutung dieser Schlüsselkompetenz für den Lernprozess. Es werden verschiedene Modelle zur Selbstregulation vorgestellt, wobei das Modell von Zimmerman (2000) als Basis für die weitere Analyse der Selbstregulation bei Schülern dient.
- Kapitel 4 stellt das Lernstilmodell von Kolb vor. Dieses dient als Grundlage für die Analyse individueller Lernpräferenzen der Schüler im Rahmen der Einzelfallstudien. Die verschiedenen Lernstile nach Kolb werden detailliert beschrieben.
- Kapitel 5 beleuchtet die konkrete Umsetzung des forschenden Lernens in der Schule B. in N. und stellt die erfahrungsbasierte Lernumgebung, die Lernmaterialien und die Schüler der 9. Klassen als Grundlage für die anschließende Einzelfallanalyse vor.
Schlüsselwörter
Forschendes Lernen, Entdeckendes Lernen, Selbstregulation, Lernstile, Kolb, Einzelfallanalyse, Schüler, Portfolio, Interview, Pädagogische Psychologie, Unterrichtskonzepte, Schulentwicklung.- Citation du texte
- Svenja Lehmann (Auteur), 2015, Forschendes Lernen als ein didaktisches Konzept zur Förderung der Selbstregulation und unterschiedlicher Lernstile, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/318838