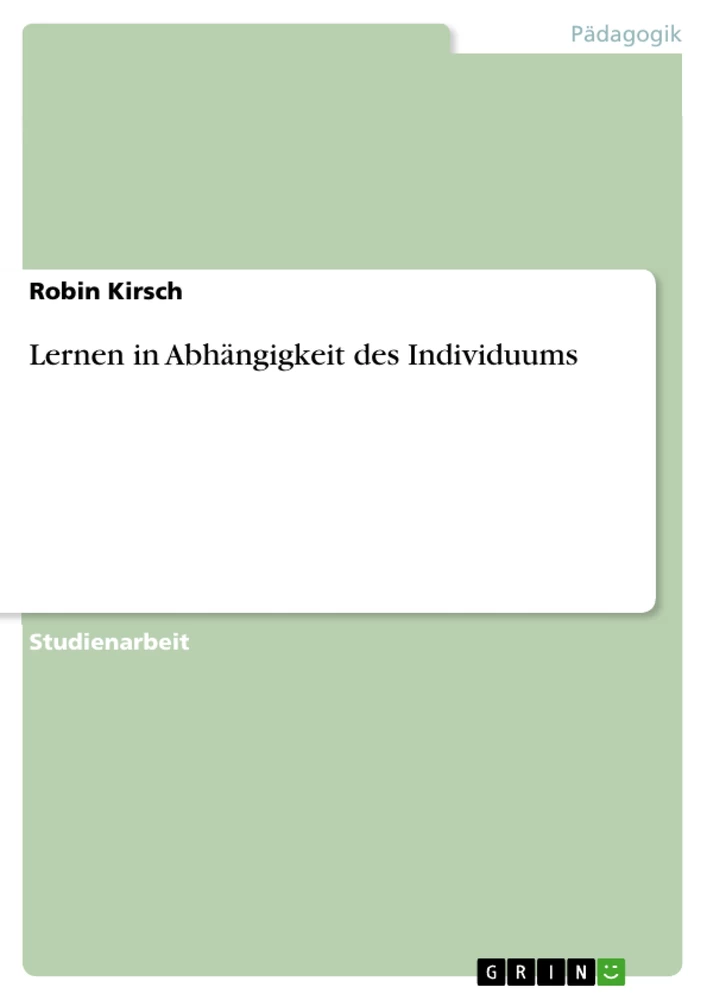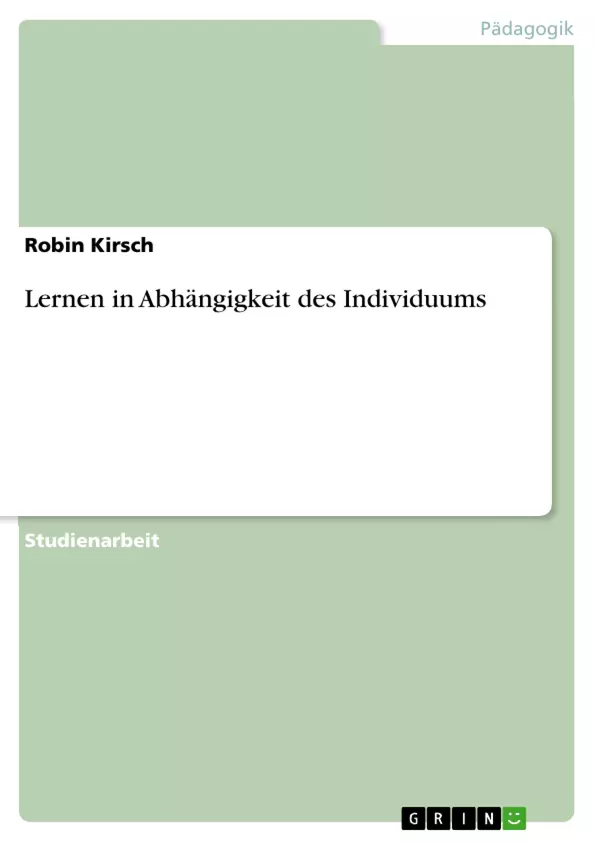Im Rahmen meiner Seminararbeit „Lernen – in Abhängigkeit des Individuums“ möchte ich der Frage nachgehen, ob Lernen als ein aktiver oder passiver Vorgang beschrieben werden kann. Kann man sich dem Lernen oder gewissen Lerngegenständen entziehen oder ist man diesen, salopp gesagt, schutzlos ausgeliefert?
Zur Beantwortung meiner Frage habe ich zwei Texte von Klaus Prange herangezogen, um einen Überblick zu bekommen, was Lernen ist, wie man den Begriff von weiteren abgrenzen muss und welche Operatoren mit diesem in Zusammenhang stehen. Als dritten flankierenden Text habe ich „Jörg Dinkelacker – Lernen“ gewählt. Vor allem die bei ihm dargestellte gesellschaftliche Bedeutung des Lernens empfand ich als wichtig und nennenswert im Zusammenhang mit der Fragestellung der vorliegenden Seminararbeit.
In der Definition wird Lernen als „absichtlicher, beiläufiger, individueller oder kollektiver Erwerb von geistigen, körperlichen und sozialen Kenntnissen und Fertigkeiten“ verstanden. Wenn wir aus lernpsychologischer Sicht argumentieren, muss der Begriff des Lernens immer als ein Prozess gefasst und verstanden werden. Die Prozesse, in denen sich Kenntnisse und Fähigkeiten verändern oder entwickeln, können unterschiedliche Gestalt annehmen. Man kann sie als Neulernen, Dazulernen und Umlernen definieren.
Welche Veränderungen diese Lernprozesse nach sich ziehen, muss aufgrund der präzisen Titulierung an dieser Stelle nicht weiter ausgeführt werden. Im Laufe eines jeden Lebens wurden verschiedene Fähigkeiten und Fertigkeiten ausgebildet, verändert und verfeinert. Der Lernbegriff als Prozess setzt also zum einen voraus, dass einige Menschen über Wissen und Fähigkeiten verfügen und andere (noch) nicht. Zum anderen spielt die Veränderlichkeit und die Veränderbarkeit von Kenntnissen und Fertigkeiten eine wichtige Rolle.
Diese Tatsache, etwas verändern zu können, ist die Betriebsprämisse für jedes pädagogische Geschehen, jedes pädagogische Handeln und begründet gleichfalls die Beeinflussbarkeit von Lernprozessen. Was aber noch wichtiger ist, um überhaupt pädagogisch handeln zu können, ist die Gegebenheit, dass jeder Mensch lernen kann. Zumeist verbindet man Lernen mit Kindern und Jugendlichen, doch Erwachsene lernen gleichwohl. Wenn dies nicht so wäre, wären Informationsveranstaltungen, Weiterbildungen, ja selbst Reklamen, Werbungen und Propaganda vergebliche Bemühungen.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Das Verhältnis von Zeigen – Lernen und Erziehen
- Drei Einsichten zur Bedeutung des Lernens
- Formen des Lernens
- Gesellschaftliche Bedeutung des Lernens
- Kontrahierende Lerntheorien
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Seminararbeit untersucht die Frage, ob Lernen als aktiver oder passiver Vorgang beschrieben werden kann. Sie analysiert, ob man sich dem Lernen entziehen kann oder ob es ein unaufhaltsamer, individueller Prozess ist. Die Arbeit beleuchtet die Beziehung zwischen Zeigen und Lernen im Kontext der Erziehung und erörtert die gesellschaftliche Bedeutung des Lernens in Bezug auf die drei Wellen der Institutionalisierung. Weiterhin werden zwei kontrahierende Lerntheorien, die Theorie des Erfahrungslernens und die subjektwissenschaftliche Lerntheorie, vorgestellt und verglichen.
- Das Verhältnis von Zeigen und Lernen in der Erziehung
- Die Bedeutung des Lernens als individueller, unvertretbarer und unableitbarer Prozess
- Die gesellschaftliche Bedeutung des Lernens und die Institutionalisierung des Lernprozesses
- Die Bedeutung des Lernens für die Gesellschaft als eine lernende Gesellschaft
- Der Vergleich von kontrahierenden Lerntheorien
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung führt in das Thema "Lernen - in Abhängigkeit des Individuums" ein und definiert Lernen als einen Prozess des Erwerbs von Wissen und Fähigkeiten. Die Arbeit stellt die Frage, ob Lernen ein aktiver oder passiver Vorgang ist und welche Rolle die Erziehung dabei spielt. Im zweiten Kapitel wird das Verhältnis von Zeigen, Lernen und Erziehen analysiert. Zeigen wird als Grundform der Erziehung betrachtet, während Lernen als ein innerer und individueller Prozess beschrieben wird. Das dritte Kapitel präsentiert drei Einsichten zur Bedeutung des Lernens, nämlich dass Lernen unableitbar vorgegeben ist, unvertretbar ist und im Wesentlichen unsichtbar ist. Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit den Formen des Lernens, die am Beispiel der Entwicklung eines Neugeborenen dargestellt werden. Das fünfte Kapitel betrachtet die gesellschaftliche Bedeutung des Lernens und beschreibt die drei Wellen der Institutionalisierung. Das sechste Kapitel stellt zwei kontrahierende Lerntheorien vor, die Theorie des Erfahrungslernens und die subjektwissenschaftliche Lerntheorie.
Schlüsselwörter (Keywords)
Lernen, Erziehen, Zeigen, Individuum, Gesellschaft, Institutionalisierung, Lerntheorie, Erfahrungslernen, Subjektwissenschaftliche Lerntheorie
Häufig gestellte Fragen
Ist Lernen ein aktiver oder passiver Vorgang?
Lernen wird oft als aktiver, individueller Prozess verstanden, dem man sich kaum entziehen kann, da wir ständig (auch beiläufig) Informationen aufnehmen und verarbeiten.
Was ist das Verhältnis von "Zeigen" und "Lernen"?
Nach Klaus Prange ist "Zeigen" die Grundform des Erziehens, während "Lernen" die notwendige Antwort des Individuums darauf ist. Ohne Zeigen gibt es keine gezielte pädagogische Vermittlung.
Was bedeutet "subjektwissenschaftliche Lerntheorie"?
Diese Theorie stellt das lernende Subjekt in den Mittelpunkt und fragt nach den Gründen, warum eine Person lernt (Lernen als Problemlösung für das eigene Leben).
Was versteht man unter der Institutionalisierung des Lernens?
Es beschreibt den gesellschaftlichen Wandel, bei dem Lernen zunehmend in festen Strukturen (Schulen, Universitäten, Weiterbildungen) organisiert wird.
Können Erwachsene genauso lernen wie Kinder?
Ja, die Fähigkeit zu lernen ist eine lebenslange Eigenschaft des Menschen. Ohne diese Fähigkeit wären Werbung, Propaganda oder berufliche Weiterbildungen wirkungslos.
- Citation du texte
- Robin Kirsch (Auteur), 2016, Lernen in Abhängigkeit des Individuums, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/319644