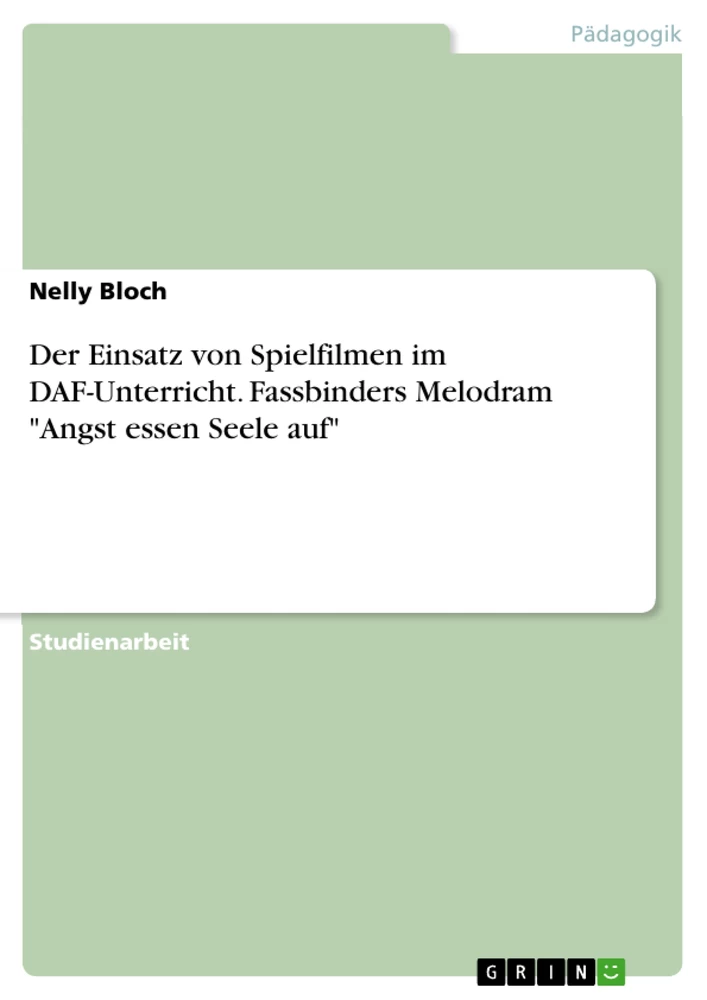Der Einsatz von Filmen im DaF-Unterricht erfreut sich weltweit immer größerer Beliebtheit. Andererseits gibt es Lehrende, die mit dem Medium Film zurückhaltend umgehen und Filme als Lückenfüller betrachten. Die fremdsprachendidaktische Literatur zur Methodik des Filmeinsatzes nennt viele überzeugende Argumente für die Arbeit mit Filmen. Filme ermöglichen einen „fertigkeits- und handlungsorientierten, auf Kognition und Emotion zielenden Fremdsprachenunterricht, den auch kulturspezifische Wahrnehmungen fokussiert“.
Eine mehrkanalige Aufnahme ist für den Menschen typisch. Der visuelle Kanal überwiegt eindeutig, denn der Mensch nimmt mit dem Auge 70-80% der Information auf. Durch das Ohr nimmt man nur 13% auf. In allen DaF-Lehrwerken wird Leseverstehen, Hörverstehen, Schriftlicher Ausdruck und Mündlicher Ausdruck trainiert. Das Hör-Seh-Verstehen ist hingegen längst keine integrierte Fähigkeit in einem Lehrwerk. Doch zunehmend wird diese Fertigkeit berücksichtigt.
Das Thema 'Ausländer in Deutschland' gehört zu einem festen Thema in DaF-Lehrbüchern. Deshalb lässt sich die Thematik anhand von Filmen vertiefen. Auch in dieser Hausarbeit geht es um Ausländer in Deutschland. Die Hauptthemen sind Vorurteile gegenüber Gastarbeitern, Fremdenfeindlichkeit und Toleranz. Anhand von Rainer Werner Fassbinders Melodram "Angst essen Seele auf" möchte ich eine Möglichkeit zeigen, wie man mit Film-Sequenzen eine Unterrichtseinheit im DaF-Unterricht gestalten kann. Das Ziel der Filmarbeit ist es, das Hör-Seh-Verstehen zu trainieren, das landeskundliche Wissen zu vertiefen und das Freie Sprechen zu üben.
Zunächst werde ich die Gründe und Ziele sowie die Phasen der Filmarbeit im DaF-Unterricht thematisieren. Daraufhin stelle ich kurz den Regisseur Rainer Werner Fassbinder und seine Werke vor. Des Weiteren thematisiere ich den historischen Kontext: Gastarbeiter in Deutschland. Im zentralen Kapitel geht es um den Einsatz des Films Angst essen Seele auf im DaF-Unterricht. Die Unterrichtsprotokolle sind in Tabellenform dargestellt. Anschließend fasse ich die zentralen Punkte zusammen. Im Anhang befindet sich das Didaktisierungsmaterial und die dazugehörenden Lösungen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Filmarbeit im DaF-Unterricht
- 2.1 Gründe und Ziele
- 2.2 Phasen der Filmarbeit
- 3. Fassbinder: Leben und Werk
- 3.1 Biografie: Rainer Werner Fassbinder
- 3.2 Historischer Kontext: Gastarbeiter in Deutschland
- 4. Der Einsatz des Spielfilms Angst essen Seele auf im DaF-Unterricht
- 4.1 Inhaltsangabe
- 4.2 Didaktische Gründe für den Einsatz des Films
- 4.3 Kursteilnehmer und Ziele
- 4.4 Unterrichtsprotokolle für den Einsatz des Spielfilms Angst essen Seele auf im DaF-Unterricht
- 4.4.1 Unterrichtsprotokoll für die erste Doppelstunde von 90 Minuten
- 4.4.2 Unterrichtsprotokoll für die zweite Doppelstunde von 90 Minuten
- 4.4.3 Unterrichtsprotokoll für die dritte Doppelstunde von 90 Minuten
- 4.4.4 Unterrichtsprotokoll für eine Unterrichtsstunde von 45 Minuten
- 4.4.5 Unterrichtsprotokoll für die fünfte Unterrichtsstunde von 100 Minuten
- 5. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Einsatz von Spielfilmen im DaF-Unterricht am Beispiel von Rainer Werner Fassbinders Melodram „Angst essen Seele auf“. Ziel ist es, die didaktischen Möglichkeiten des Films für den DaF-Unterricht aufzuzeigen und eine konkrete Unterrichtseinheit zu entwickeln.
- Die didaktischen Vorteile des Filmeinsatzes im DaF-Unterricht
- Die Biografie und das Werk von Rainer Werner Fassbinder
- Der historische Kontext „Gastarbeiter in Deutschland“
- Die Analyse und didaktische Umsetzung von „Angst essen Seele auf“ im DaF-Unterricht
- Die Entwicklung von Unterrichtsprotokollen für den Einsatz des Films
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Einsatz von Filmen im DaF-Unterricht vor und beleuchtet die didaktischen Vorteile des Mediums. Kapitel 2 behandelt die Gründe und Ziele sowie die Phasen der Filmarbeit im DaF-Unterricht. Kapitel 3 gibt einen Einblick in die Biografie von Rainer Werner Fassbinder und den historischen Kontext der Gastarbeiter in Deutschland. Kapitel 4 widmet sich dem Einsatz des Films „Angst essen Seele auf“ im DaF-Unterricht. Es werden die didaktischen Gründe für den Einsatz des Films, die Kursteilnehmer und die Ziele der Unterrichtseinheit vorgestellt. Die Unterrichtsprotokolle für die einzelnen Unterrichtseinheiten sind in Tabellenform dargestellt. Die Zusammenfassung fasst die zentralen Punkte der Arbeit zusammen.
Schlüsselwörter
DaF-Unterricht, Spielfilm, Filmanalyse, Rainer Werner Fassbinder, Angst essen Seele auf, Gastarbeiter, Vorurteile, Fremdenfeindlichkeit, Toleranz, Hör-Seh-Verstehen, Landeskunde, Unterrichtsprotokolle.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist der Einsatz von Filmen im DaF-Unterricht wertvoll?
Filme fördern das Hör-Seh-Verstehen, vermitteln landeskundliches Wissen und bieten emotionale Anreize für das freie Sprechen in der Fremdsprache.
Worum geht es in Fassbinders Film „Angst essen Seele auf“?
Der Film thematisiert die Beziehung zwischen einer älteren deutschen Putzfrau und einem jüngeren marokkanischen Gastarbeiter und beleuchtet Vorurteile und Fremdenfeindlichkeit im Deutschland der 70er Jahre.
Was ist „Hör-Seh-Verstehen“?
Es ist die Fähigkeit, Informationen gleichzeitig über den visuellen und den auditiven Kanal aufzunehmen und zu verarbeiten, was für die Kommunikation im Alltag essenziell ist.
Welche Phasen umfasst die Filmarbeit im Unterricht?
Die Filmarbeit gliedert sich meist in Vorbereitungsaufgaben (Pre-viewing), Aufgaben während des Sehens (While-viewing) und vertiefende Nachbereitungsaufgaben (Post-viewing).
Wie wird das Thema „Gastarbeiter“ landeskundlich vermittelt?
Anhand von Filmsequenzen können historische Hintergründe, gesellschaftliche Spannungen und die Lebensrealität von Migranten in Deutschland anschaulich diskutiert werden.
- Quote paper
- Nelly Bloch (Author), 2013, Der Einsatz von Spielfilmen im DAF-Unterricht. Fassbinders Melodram "Angst essen Seele auf", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/320108