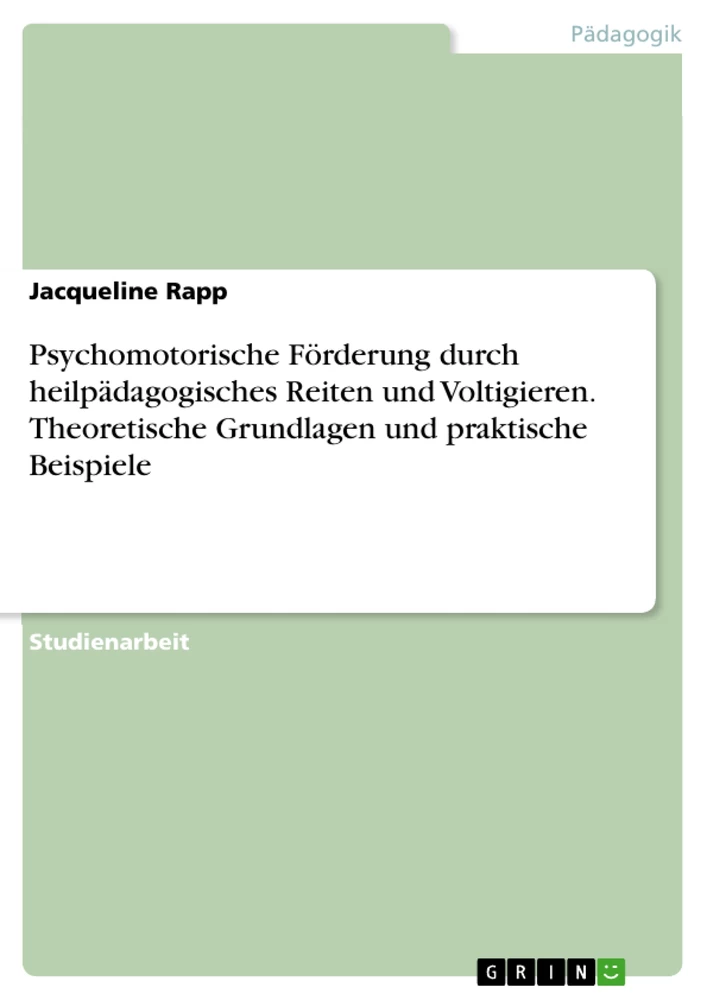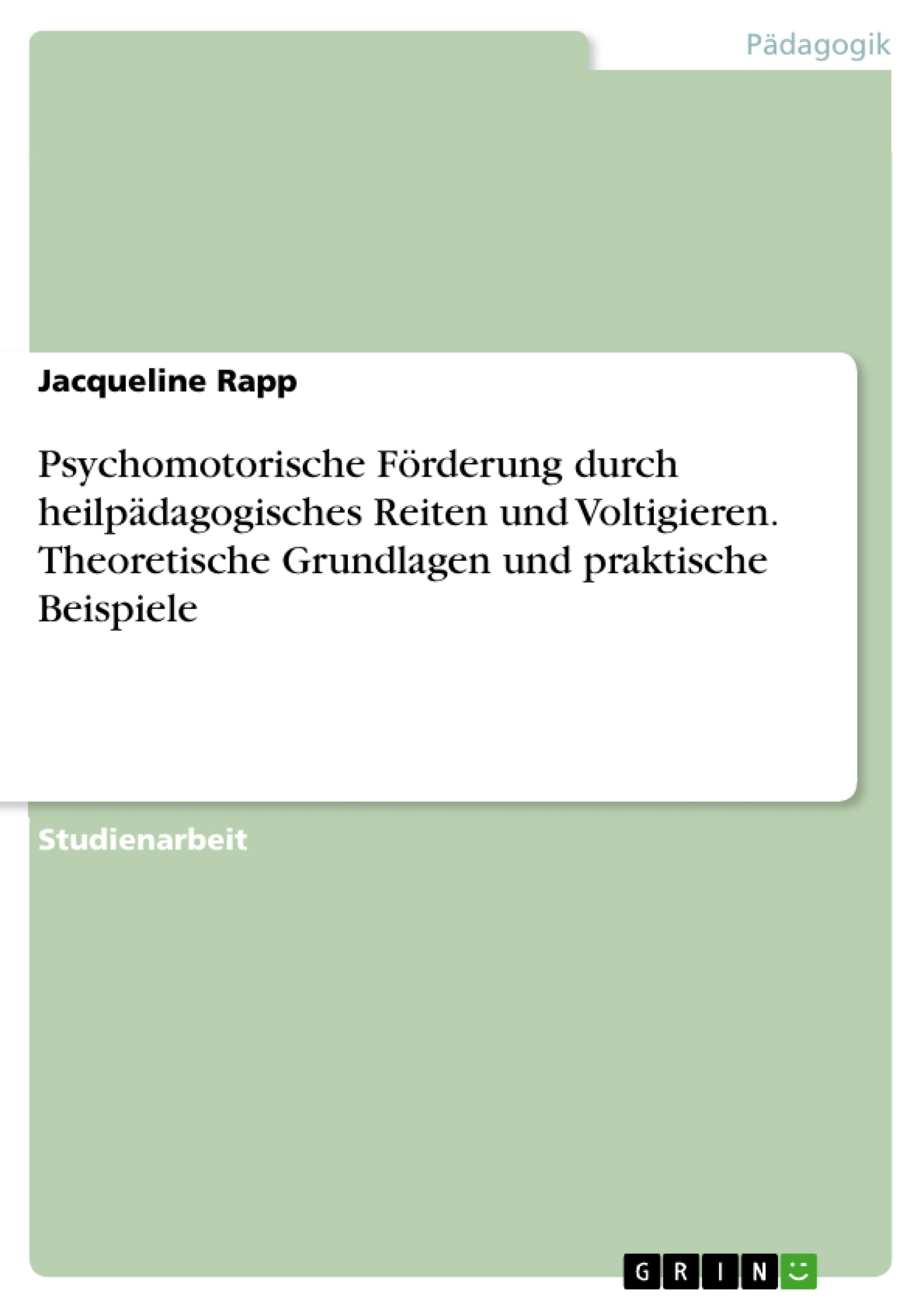Durch die moderne Gesellschaft haben sich die Entwicklungs- und Lebensbedingungen im Bewegungserleben unserer Kinder sehr verändert. Angefangen bei dem starken Ausbau der Medien sowie technischer Geräte, die vom heutigen Menschen viel weniger körperliche Anstrengung verlangen, bis hin zur Freizeitbeschäftigung, die sich meist in den Kinderzimmern vollzieht. So scheint eine Entwicklungsförderung in diesem Bereich unabdingbar.
Durch die große Anziehungskraft, die das Pferd auf Kinder ausübt, und seine physischen und sozialen Eigenschaften, lässt es sich vielseitig in der Entwicklungsförderung einsetzen, sowohl in der Hippotherapie als auch beim heilpädagogischen Reiten und Voltigieren.
In dieser Arbeit wird das pädagogische Konzept des heilpädagogischen Reitens im Hinblick auf die psychomotorische Förderung vorgestellt und konkret auf die Bewegungsförderung eines Kindes eingegangen. Insbesondere soll aufgezeigt werden, in welcher Weise das heilpädagogische Reiten nützlich und wertvoll ist und der Frage nachgegangen werden, warum gerade die Arbeit mit Pferden in der psychomotorischen Förderung so bedeutsam ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Beschreibung der Praxis
- 2. Beschreibung der Praxis in Bezug auf das Analysekriterium
- 3. Psychomotorik
- 3.1 Ziele und Inhalte der Psychomotorik
- 3.2 Begriffserklärungen
- 4. Das Heilpädagogische Reiten und Voltigieren
- 5. Der Einsatz des Pferdes unter psychomotorischen Gesichtspunkten
- 6. Praxisbeispiel
- 7. Reflexion
- 8. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Anwendung heilpädagogischen Reitens und Voltigierens zur psychomotorischen Förderung von Kindern. Das Hauptziel ist es, die Wirksamkeit dieses pädagogischen Konzepts aufzuzeigen und die Bedeutung der Arbeit mit Pferden in der psychomotorischen Entwicklung zu beleuchten. Die Arbeit stützt sich auf ein Praxisbeispiel aus einer Familiengruppe.
- Psychomotorische Förderung von Kindern
- Heilpädagogisches Reiten und Voltigieren als pädagogisches Konzept
- Bedeutung der Arbeit mit Pferden für die Bewegungsentwicklung
- Analyse eines Praxisbeispiels zur psychomotorischen Förderung
- Reflexion der theoretischen Konzepte im Hinblick auf die Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den veränderten Bewegungserlebens von Kindern in der heutigen Gesellschaft, bedingt durch den Medienkonsum, veränderte Wohnverhältnisse und zunehmende Leistungsanforderungen. Sie hebt die Bedeutung der Bewegung fördernden Maßnahmen hervor und begründet die Wahl des Themas, nämlich die Untersuchung heilpädagogischen Reitens und Voltigierens zur psychomotorischen Förderung. Der Bezug zur persönlichen Erfahrung der Autorin mit einem Praktikum in einer Familiengruppe wird hergestellt, und die zentrale Forschungsfrage nach der Nützlichkeit und dem Wert heilpädagogischen Reitens in der psychomotorischen Förderung wird formuliert.
1. Beschreibung der Praxis: Dieses Kapitel beschreibt das Praxisfeld der Autorin, eine Familiengruppe mit sieben Kindern im Alter von 3-17 Jahren. Es wird detailliert auf die Struktur und die Aufgaben der Autorin eingegangen, insbesondere auf die Betreuung eines siebenjährigen Mädchens (D.) und die Arbeit mit den Pferden der Einrichtung. Die Autorin hebt hervor, dass sie sich in dieser Arbeit auf die Arbeit mit den Pferden konzentriert und andere Tätigkeitsfelder ausklammert. Die beschränkten Möglichkeiten der Kinder, sich mit den Pferden zu beschäftigen, aufgrund der begrenzten Zeit des Personals, wird ebenfalls thematisiert.
2. Beschreibung der Praxis in Bezug auf das Analysekriterium: Dieses Kapitel analysiert die motorischen Fähigkeiten des siebenjährigen Mädchens D., bei dem Koordinations- und Bewegungsprobleme festgestellt wurden. Es wird beschrieben, wie D. sich bei sportlichen Aktivitäten zurückzog und oft als "faul" bezeichnet wurde. Die Autorin beschreibt, wie die positive Beziehung des Mädchens zu den Pferden als Ansatzpunkt für die psychomotorische Förderung genutzt wurde. Die Zielsetzung neben der psychomotorischen Förderung ist, D. zum selbstständigen kreativen Handeln anzuregen und wenig zielorientierte Vorgaben zu geben.
3. Psychomotorik: Dieses Kapitel definiert die Ziele und Inhalte der Psychomotorik als Förderung der Persönlichkeitsentwicklung durch Bewegung, die Förderung der Eigentätigkeit und des selbstständigen Handelns. Es werden die drei Kompetenzbereiche der Ich-Kompetenz, Sach-Kompetenz und Sozial-Kompetenz nach Kiphard erläutert. Die Bedeutung der Körperlichkeit als Zentrum der Persönlichkeit und die Rolle von Bewegungshandeln im Erlernen des Umgangs mit dem Körper und der Umwelt werden hervorgehoben. Der Abschnitt zu den Begriffserklärungen thematisiert die Beziehung zwischen Psychomotorik und Motopädagogik.
Schlüsselwörter
Psychomotorik, Heilpädagogisches Reiten, Voltigieren, Bewegungsförderung, Kinder, Persönlichkeitsentwicklung, Praxisbeispiel, Familiengruppe, Pferd, Motopädagogik.
Häufig gestellte Fragen zur Arbeit: Heilpädagogisches Reiten und Voltigieren zur psychomotorischen Förderung von Kindern
Was ist der Hauptfokus dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Wirksamkeit von heilpädagogischem Reiten und Voltigieren zur psychomotorischen Förderung von Kindern. Sie analysiert ein Praxisbeispiel aus einer Familiengruppe und beleuchtet die Bedeutung der Arbeit mit Pferden in der Bewegungsentwicklung.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die psychomotorische Förderung von Kindern, heilpädagogisches Reiten und Voltigieren als pädagogisches Konzept, die Bedeutung der Arbeit mit Pferden für die Bewegungsentwicklung, die Analyse eines Praxisbeispiels und die Reflexion der theoretischen Konzepte im Hinblick auf die Praxis.
Welche Kapitel beinhaltet die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in die Kapitel Einleitung, Beschreibung der Praxis, Beschreibung der Praxis in Bezug auf das Analysekriterium, Psychomotorik (mit Unterkapiteln zu Zielen/Inhalten und Begriffserklärungen), Das Heilpädagogische Reiten und Voltigieren, Der Einsatz des Pferdes unter psychomotorischen Gesichtspunkten, Praxisbeispiel, Reflexion und Fazit.
Wie wird die Praxis beschrieben?
Die Praxis beschreibt eine Familiengruppe mit sieben Kindern im Alter von 3-17 Jahren. Der Fokus liegt auf der Arbeit mit einem siebenjährigen Mädchen (D.) und den Pferden der Einrichtung. Die beschränkten Möglichkeiten der Kinder, sich mit den Pferden zu beschäftigen, aufgrund der begrenzten Zeit des Personals, wird ebenfalls thematisiert.
Was sind die wichtigsten Ergebnisse der Analyse des Praxisbeispiels?
Das Praxisbeispiel konzentriert sich auf ein siebenjähriges Mädchen mit Koordinations- und Bewegungsproblemen. Die positive Beziehung des Mädchens zu den Pferden wurde als Ansatzpunkt für die psychomotorische Förderung genutzt. Ziel war neben der psychomotorischen Förderung, das Mädchen zu selbstständigem, kreativem Handeln anzuregen.
Wie wird Psychomotorik in der Arbeit definiert?
Psychomotorik wird als Förderung der Persönlichkeitsentwicklung durch Bewegung definiert, mit Fokus auf Eigentätigkeit und selbstständigem Handeln. Die drei Kompetenzbereiche Ich-Kompetenz, Sach-Kompetenz und Sozial-Kompetenz nach Kiphard werden erläutert. Die Bedeutung der Körperlichkeit als Zentrum der Persönlichkeit und die Rolle von Bewegungshandeln werden hervorgehoben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Psychomotorik, Heilpädagogisches Reiten, Voltigieren, Bewegungsförderung, Kinder, Persönlichkeitsentwicklung, Praxisbeispiel, Familiengruppe, Pferd, Motopädagogik.
Was ist die zentrale Forschungsfrage der Arbeit?
Die zentrale Forschungsfrage untersucht die Nützlichkeit und den Wert heilpädagogischen Reitens in der psychomotorischen Förderung.
Warum wurde dieses Thema gewählt?
Die Wahl des Themas resultiert aus den veränderten Bewegungserfahrungen von Kindern in der heutigen Gesellschaft (Medienkonsum, Wohnverhältnisse, Leistungsanforderungen) und der persönlichen Erfahrung der Autorin mit einem Praktikum in einer Familiengruppe.
- Arbeit zitieren
- Jacqueline Rapp (Autor:in), 2012, Psychomotorische Förderung durch heilpädagogisches Reiten und Voltigieren. Theoretische Grundlagen und praktische Beispiele, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/320422