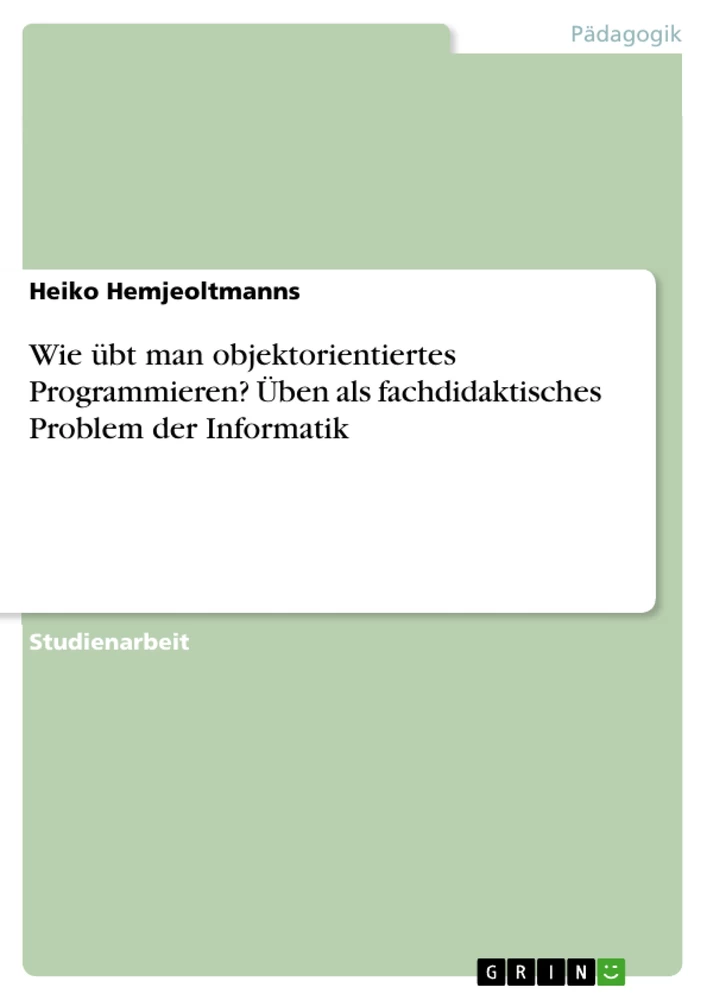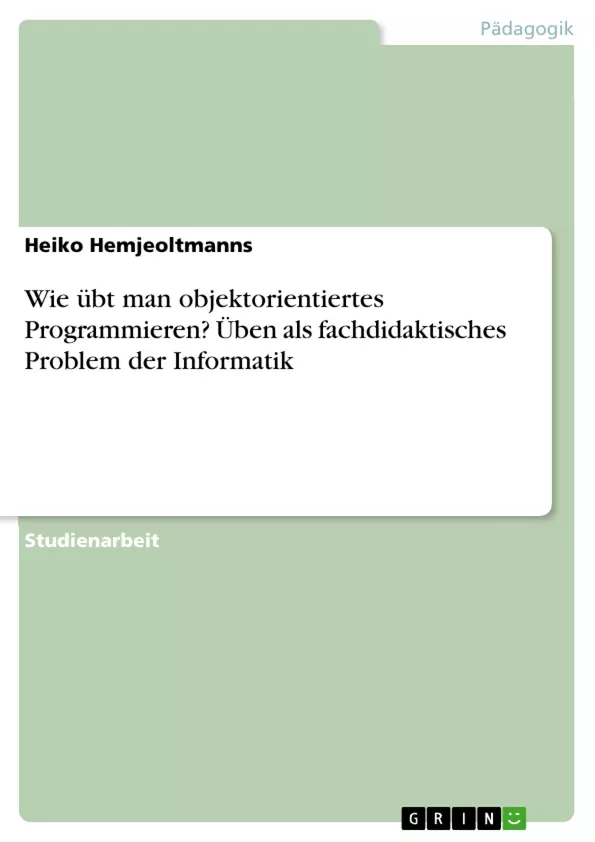Nach Jahren des Schattendaseins in der didaktischen Diskussion scheint das Thema Üben und Wiederholen zunehmend an Bedeutung zu gewinnen. Diesen Schluss legen zumindest einige Veröffentlichungen der letzten Jahre nahe.
Tatsächlich lassen sich in Übungs-, Wiederholungs- und Anwendungsphasen auch andere gern genannte didaktische Forderungen integrieren, etwa die nach selbstgesteuerten, methodischen Arbeiten, nach Handlungs- oder Produktorientierung. Je nach Lerngruppe mag hier sogar die einzige Phase des Lernprozesses sein, in der dies möglich ist.
Dass das Thema Aufmerksamkeit verdient, ist also einleuchtend. Die Frage, wie eine Übungs- und Wiederholungsphase sinnvoll gestaltet werden kann, geht jedoch über den fachdidaktischen Horizont hinaus.
Aus diesem Grund wähle ich für diese Hausarbeit zunächst einen allgemein didaktischen Blickwinkel aus, der erste Schlussfolgerungen für die sinnvolle Gestaltung von Lern- und Übungsaufgaben für das objektorientierte Programmieren zulassen soll.
Neben neueren Veröffentlichungen bezieht sich dieses Kapitel unter anderem auf die älteren Positionen H. Aeblis. Dass dies ohne große Probleme möglich ist, zeigt dabei auch, dass sich die grundlegenden Überlegungen zur Gestaltung von Übungs- und Wiederholungsphasen nicht völlig geändert haben, sondern nur wieder stärker rezipiert werden .
Auf dieser Grundlage soll eine eigentliche fachdidaktische Betrachtung des Unterrichtsgegenstandes erfolgen. Die hierbei gewonnenen relevanten Lerninhalte sollen nicht nur im Unterricht erarbeitet werden, sie bilden natürlich auch das Ziel der Übungsaufgaben. Darüber hinaus ist aber auch zu untersuchen, ob sich in der Übungs- und Wiederholungsphase eigene, für diese Phase spezifische Lerninhalte einbinden lassen. Den Abschluss dieses Kapitels sollen konkretere Anforderungen an geeignete Übungs- und Wiederholungsphasen und deren Gestaltung bilden.
Wenn möglich, soll hier eine Art Raster entwickelt werden, das schließlich die Beurteilung oder zumindest Kommentierung ausgewählter Übungsaufgaben und -formen ermöglichen soll.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Üben als didaktisches Problem: Schwierigkeiten und Besonderheiten bei der Gestaltung von Übungs- und Wiederholungsfragen
- Üben als fachdidaktisches Problem der Informatik
- Mögliche Inhalte des OOM - Unterrichts
- Umsetzung im Unterricht
- Das Üben von Kenntnissen in der OOM
- Das Üben komplexer Fähigkeiten in der OOM
- Raster zur Bewertung von Übungsaufgaben und Beispiele
- Beispiel: Üben von Kenntnissen
- Beispiel: Üben von komplexen Fähigkeiten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die didaktischen und fachdidaktischen Aspekte des Übens im Kontext des objektorientierten Programmierens (OOM). Ziel ist es, konkrete Anforderungen an die Gestaltung von Übungs- und Wiederholungsphasen zu formulieren und ein Raster zur Bewertung von Übungsaufgaben zu entwickeln. Die Arbeit stützt sich dabei auf allgemein-didaktische und lernpsychologische Grundlagen.
- Didaktische Grundlagen des Übens und Wiederholens
- Spezifische Herausforderungen des Übens im OOM-Unterricht
- Entwicklung eines Rasters zur Bewertung von Übungsaufgaben
- Beispiele für Übungsaufgaben zum Üben von Kenntnissen und komplexen Fähigkeiten
- Zusammenhang zwischen Lernpsychologie und Gestaltung effektiver Übungsphasen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses einleitende Kapitel betont die wachsende Bedeutung des Übens und Wiederholens in der didaktischen Diskussion, insbesondere im Kontext des objektorientierten Modellierens (OOM). Es skizziert den Ansatz der Arbeit, der sowohl allgemein-didaktische als auch fachdidaktische Perspektiven einbezieht und auf bestehenden lernpsychologischen Theorien aufbaut. Der Fokus liegt auf der Entwicklung von Kriterien für die Gestaltung effektiver Übungsphasen im OOM-Unterricht. Die Arbeit bezieht sich auf verschiedene Autoren und deren Thesen zur Gestaltung von Übungs- und Wiederholungsphasen.
2. Üben als didaktisches Problem: Schwierigkeiten und Besonderheiten bei der Gestaltung von Übungs- und Wiederholungsfragen: Dieses Kapitel befasst sich mit den lernpsychologischen Aspekten des Übens. Es wird erläutert, dass Üben notwendig ist, um Wissen vom Kurzzeit- ins Langzeitgedächtnis zu transferieren und es abrufbar zu machen. Der Vergleich des Gedächtnisses mit einer Bibliothek mit Karteikarten und Querverweisen verdeutlicht die Bedeutung von Vernetzung und Anwendung des Wissens. Das Kapitel führt verschiedene lernpsychologische Beobachtungen auf, die die Effektivität des Übens beeinflussen, wie die Anzahl der Wiederholungen, die Lernmethode (Ganzes vs. Teile), die Motivation und die Art der Rückmeldung. Es werden verschiedene Methoden und Strategien des intelligenten Übens diskutiert.
Schlüsselwörter
Objektorientiertes Programmieren, OOM, Üben, Wiederholen, Didaktik, Fachdidaktik, Lernpsychologie, Gedächtnis, Motivation, Übungsaufgaben, Kompetenzen, Lernmethoden, Rückmeldung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Üben im objektorientierten Programmieren"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die didaktischen und fachdidaktischen Aspekte des Übens im Kontext des objektorientierten Programmierens (OOM). Das Ziel ist die Formulierung konkreter Anforderungen an die Gestaltung von Übungs- und Wiederholungsphasen und die Entwicklung eines Rasters zur Bewertung von Übungsaufgaben. Die Arbeit basiert auf allgemein-didaktischen und lernpsychologischen Grundlagen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt didaktische Grundlagen des Übens und Wiederholens, spezifische Herausforderungen des Übens im OOM-Unterricht, die Entwicklung eines Bewertungssystems für Übungsaufgaben, Beispiele für Übungsaufgaben zum Üben von Kenntnissen und komplexen Fähigkeiten sowie den Zusammenhang zwischen Lernpsychologie und der Gestaltung effektiver Übungsphasen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, ein Kapitel über Üben als didaktisches Problem mit den Schwierigkeiten bei der Gestaltung von Übungs- und Wiederholungsfragen, ein Kapitel über Üben als fachdidaktisches Problem der Informatik (inkl. möglicher Inhalte des OOM-Unterrichts und dessen Umsetzung), ein Kapitel mit einem Raster zur Bewertung von Übungsaufgaben und abschließende Beispiele für das Üben von Kenntnissen und komplexen Fähigkeiten.
Was sind die zentralen Ergebnisse der Einleitung?
Die Einleitung betont die Bedeutung des Übens und Wiederholens im OOM-Unterricht und skizziert den Ansatz der Arbeit, der sowohl allgemein-didaktische als auch fachdidaktische Perspektiven einbezieht und auf lernpsychologischen Theorien aufbaut. Der Fokus liegt auf der Entwicklung von Kriterien für effektive Übungsphasen im OOM-Unterricht.
Welche lernpsychologischen Aspekte werden im Kapitel "Üben als didaktisches Problem" behandelt?
Dieses Kapitel behandelt den Transfer von Wissen vom Kurzzeit- ins Langzeitgedächtnis, die Bedeutung der Vernetzung von Wissen, den Einfluss von Faktoren wie Anzahl der Wiederholungen, Lernmethoden (Ganzes vs. Teile), Motivation und Rückmeldung auf die Effektivität des Übens sowie verschiedene Strategien des intelligenten Übens.
Was beinhaltet das Kapitel über das Üben im OOM-Unterricht?
Dieses Kapitel befasst sich mit den spezifischen Herausforderungen des Übens im Kontext des objektorientierten Programmierens. Es beinhaltet mögliche Inhalte des OOM-Unterrichts und deren Umsetzung im Unterricht, unterscheidet zwischen dem Üben von Kenntnissen und dem Üben komplexer Fähigkeiten.
Wie werden Übungsaufgaben bewertet?
Die Arbeit entwickelt ein Raster zur Bewertung von Übungsaufgaben, das im entsprechenden Kapitel detailliert beschrieben und anhand von Beispielen illustriert wird. Dieses Raster hilft, die Qualität und Effektivität von Übungsaufgaben zu beurteilen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Die Arbeit wird durch folgende Schlüsselwörter charakterisiert: Objektorientiertes Programmieren, OOM, Üben, Wiederholen, Didaktik, Fachdidaktik, Lernpsychologie, Gedächtnis, Motivation, Übungsaufgaben, Kompetenzen, Lernmethoden, Rückmeldung.
- Citar trabajo
- Heiko Hemjeoltmanns (Autor), 2006, Wie übt man objektorientiertes Programmieren? Üben als fachdidaktisches Problem der Informatik, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/320706