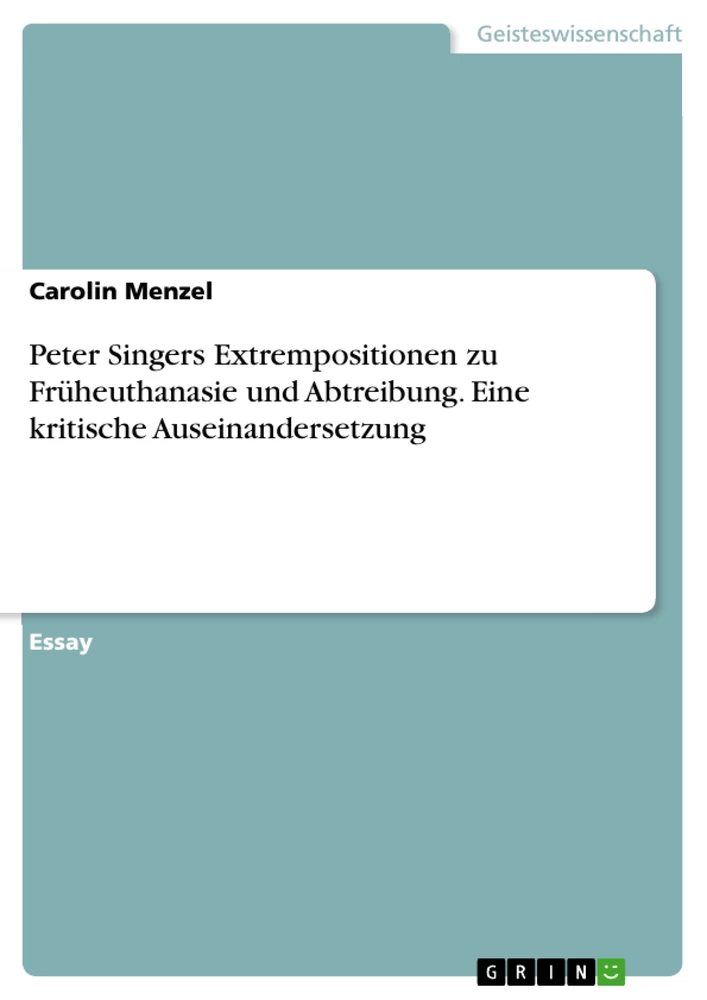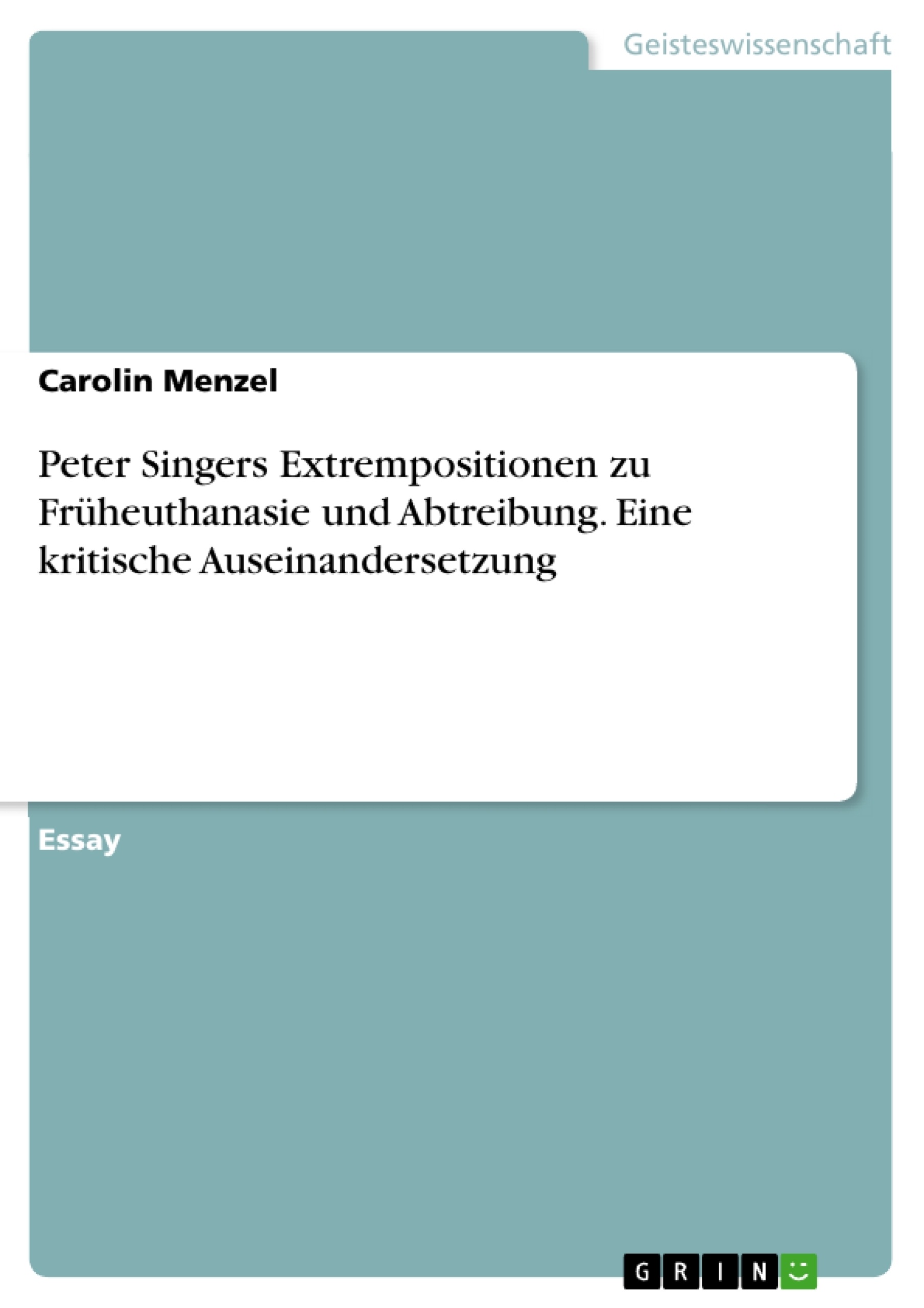Insbesondere Singers Aussagen zur Früheuthanasie von behinderten Säuglingen und zu Schwangerschaftsabbrüchen haben heftige Kritik provoziert.
In diesem Essay wird der Standpunkt des Utilitaristen Peter Singers beleuchtet. Dabei wird auf seine Extrempositionen eingegangen und die ihm vorgeworfene Kritik diskutiert.
Inhaltsverzeichnis
- Peter Singers Extrempositionen
- Der Utilitarismus als Fundament
- Das Tötungsverbot im Utilitarismus
- Bewusstsein, Schmerzempfinden und die Personendefinition
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Essay befasst sich kritisch mit den Positionen von Peter Singer, insbesondere im Hinblick auf die Legitimität der Tötung von Ungeborenen und behinderten Säuglingen. Dabei werden die Argumentationslinien Singers im Kontext des Utilitarismus beleuchtet und seine Ansichten zur Früheuthanasie und Abtreibung analysiert.
- Die Rechtfertigung von Tötung im Utilitarismus
- Die Rolle von Bewusstsein und Schmerzempfinden in Singers Argumentation
- Die Unterscheidung zwischen Lebewesen und Personen
- Die ethische Bewertung von Abtreibung und Infantizid
- Singers Positionen im Kontext der modernen Bioethik
Zusammenfassung der Kapitel
- Peter Singers Extrempositionen: Dieser Abschnitt stellt die kontroversen Positionen von Peter Singer vor und beleuchtet die Reaktionen auf seine Thesen.
- Der Utilitarismus als Fundament: Hier wird der Utilitarismus als ethische Theorie erläutert und seine Grundprinzipien sowie seine Relevanz für Singers Argumentation dargestellt.
- Das Tötungsverbot im Utilitarismus: Dieser Abschnitt behandelt die verschiedenen Argumente gegen die Tötung im Utilitarismus und zeigt die Problematik der Abwägung von Lebensqualität und Leid.
- Bewusstsein, Schmerzempfinden und die Personendefinition: Dieser Abschnitt erläutert Singers Definition von „Person“ und die Bedeutung von Bewusstsein und Schmerzempfinden in diesem Zusammenhang.
Schlüsselwörter
Utilitarismus, Peter Singer, Tötungsverbot, Lebensqualität, Bewusstsein, Schmerzempfinden, Personendefinition, Abtreibung, Infantizid, Früheuthanasie, Bioethik.
Häufig gestellte Fragen
Warum sind Peter Singers Positionen so kontrovers?
Singer vertritt utilitaristische Thesen, die unter bestimmten Bedingungen die Tötung von behinderten Säuglingen (Früheuthanasie) und ungeborenem Leben als ethisch zulässig betrachten.
Wie definiert Peter Singer eine "Person"?
Für Singer ist eine Person ein Wesen mit Selbstbewusstsein, Rationalität und der Fähigkeit, Wünsche für die Zukunft zu haben – ein Status, den er Föten und Neugeborenen abspricht.
Was ist die Grundlage von Singers Utilitarismus?
Sein ethisches Fundament ist die Maximierung von Glück und die Minimierung von Leid für alle betroffenen empfindungsfähigen Wesen.
Wie rechtfertigt Singer Abtreibung?
Er argumentiert, dass das Lebensrecht an das Personenbewusstsein geknüpft ist; da Föten dieses nicht besitzen, wiege das Selbstbestimmungsrecht der Frau oder die Vermeidung von Leid schwerer.
Welche Rolle spielt das Schmerzempfinden in seiner Ethik?
Schmerzempfinden ist für Singer das Kriterium für moralische Berücksichtigung, unterscheidet aber nicht zwingend zwischen dem Lebensrecht von "Wesen" und "Personen".
- Citar trabajo
- Carolin Menzel (Autor), 2015, Peter Singers Extrempositionen zu Früheuthanasie und Abtreibung. Eine kritische Auseinandersetzung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/320787