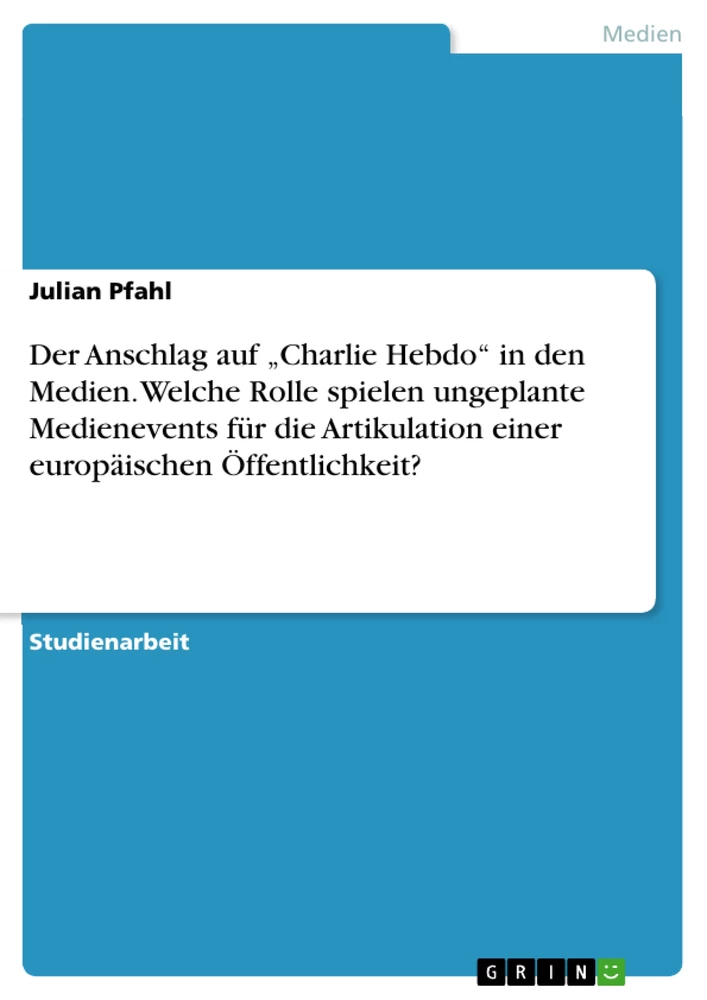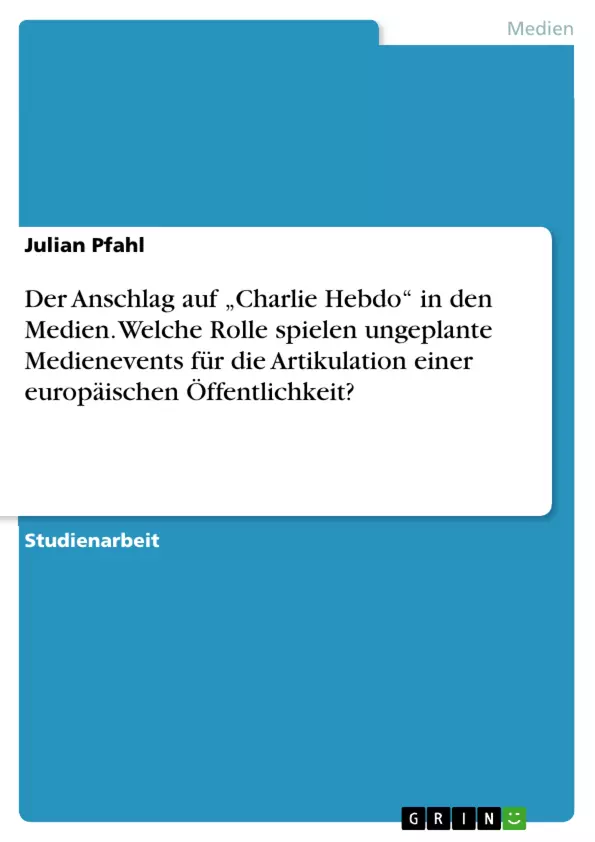Diese Arbeit geht der Frage nach, was genau dazu geführt hat, dass einen knappen Monat nach den grausamen Anschlägen vom 7. Januar in Paris selbst eine Millionenauflage der französischen Zeitschrift nicht ausreichte, um auch nur einen Bruchteil der europaweit gewillten Käufer zu bedienen. Es wird sich zeigen, dass das aus den grausamen Anschlägen entstandene Medienevent temporär eine als gemeinsam empfundene Basis der europäischen Öffentlichkeit artikuliert hat, die nicht allein EU-politisch relevante Akteure und die Medien, sondern eine den europäischen Raum umfassende Öffentlichkeit aktiv teilten.
Am vorliegenden Beispiel soll dabei deutlich gemacht werden, welche Rolle gerade ungeplante Medienevents für die Artikulation einer europäischen Öffentlichkeit besitzen. Denn insbesondere europäische Öffentlichkeit steht immer wieder dafür in der Kritik, ein künstliches Konstrukt zu sein, welches von Akteuren der EU erzwungen werde. Die Ereignisse um „Charlie Hebdo“ jedoch waren offensichtlich weder von Seiten der Institution EU geplant oder gar vorhergesehen.
Der erste Teil der Arbeit beschäftigt sich mit der Klärung der notwendigen Begriffe „europäische Öffentlichkeit“ und „Medienevent“, bevor die Rolle des Medienevents für die Artikulation einer europäischen Öffentlichkeit hinterfragt wird. Die dort erlangten Schlüsse werden im Anschluss am Beispiel der Ereignisse rund um „Charlie Hebdo“ überprüft. Dabei wird nicht nur untersucht, ob es sich bei genanntem Beispiel um ein Medienevent handelt und ob dieses eine europäische Öffentlichkeit artikuliert, sondern weiterhin auf welche zentralen Narrative sich die entstandene Öffentlichkeit stützt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsklärung
- Öffentlichkeit
- Europäische Öffentlichkeit
- Medienevents
- Medienevents und ihre Bedeutung für Europa
- ,,Charlie Hebdo“ als Medienevent
- Zwei Anschläge, 20 Tötungen: Überblick über die Ereignisse in Paris
- Live-Ticker und Sondersendungen: Betonung
- Ein Angriff auf die Freiheit Europas: Performativität & Loyalität
- ,,Je Suis Charlie“: Geteilte Erfahrung
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Artikulation einer europäischen Öffentlichkeit durch ungeplante Medienevents am Beispiel des Anschlags auf „Charlie Hebdo“. Ziel ist es, zu verstehen, wie ein solches Ereignis eine gemeinsame europäische Öffentlichkeit schaffen kann, obwohl diese oft als künstliches Konstrukt kritisiert wird.
- Die Rolle von Medienevents bei der Schaffung einer europäischen Öffentlichkeit
- Die Bedeutung des Anschlags auf „Charlie Hebdo“ als Medienevent
- Die Narrative, die die entstandene Öffentlichkeit prägten
- Die Frage, ob eine europäische Öffentlichkeit tatsächlich existiert
- Die Bedeutung von Öffentlichkeit für die Legitimation der Europäischen Union
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt die Forschungsfrage und den Untersuchungsgegenstand vor. Sie beleuchtet die Bedeutung von ungeplanten Medienevents für die Artikulation einer europäischen Öffentlichkeit.
- Begriffsklärung: Dieses Kapitel definiert die zentralen Begriffe „Öffentlichkeit“, „Europäische Öffentlichkeit“ und „Medienevents“. Dabei werden verschiedene Perspektiven und Definitionen diskutiert.
- Medienevents und ihre Bedeutung für Europa: Dieses Kapitel untersucht die Rolle von Medienevents für die Artikulation einer europäischen Öffentlichkeit. Es wird analysiert, wie Medienevents zu einem Gefühl von Gemeinsamkeit und Solidarität beitragen können.
- ,,Charlie Hebdo“ als Medienevent: Dieses Kapitel analysiert den Anschlag auf „Charlie Hebdo“ als Medienevent. Es wird untersucht, wie das Ereignis eine europäische Öffentlichkeit artikuliert hat und welche Narrative dabei eine Rolle spielten.
Schlüsselwörter
Europäische Öffentlichkeit, Medienevents, Charlie Hebdo, Anschlag, Artikulation, Performativität, Solidarität, Narrative, Gemeinsamkeit, Legitimation, Europäische Union.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter einem "ungeplanten Medienevent"?
Es handelt sich um unvorhergesehene Ereignisse, wie den Anschlag auf Charlie Hebdo, die durch massive mediale Berichterstattung zu einem kollektiven Erlebnis werden.
Wie fördern Medienevents eine europäische Öffentlichkeit?
Sie schaffen temporär eine gemeinsam empfundene Basis und Solidarität über nationale Grenzen hinweg, die über rein politische Strukturen hinausgeht.
Was war die Bedeutung des Slogans "Je Suis Charlie"?
Der Slogan diente als zentrales Narrativ einer geteilten Erfahrung und drückte die Loyalität zu europäischen Werten wie der Pressefreiheit aus.
Ist die europäische Öffentlichkeit ein künstliches Konstrukt?
Oft wird sie als solches kritisiert; die Arbeit zeigt jedoch, dass sie durch Ereignisse wie Charlie Hebdo organisch und aktiv von den Bürgern geteilt werden kann.
Welche Rolle spielen Live-Ticker bei solchen Ereignissen?
Live-Ticker und Sondersendungen verstärken die Performativität und Unmittelbarkeit des Ereignisses, was die Bildung einer gemeinsamen Öffentlichkeit beschleunigt.
- Citar trabajo
- Julian Pfahl (Autor), 2015, Der Anschlag auf „Charlie Hebdo“ in den Medien. Welche Rolle spielen ungeplante Medienevents für die Artikulation einer europäischen Öffentlichkeit?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/321634